Die Mutter des Buchdorfs
Als die DDR zusammenbrach, wanderte Heidi Dehne aus dem Rheinland ins rußig-schwarze Bitterfeld in Sachsen-Anhalt aus, arbeitete als Altenpflegerin und gründete schließlich in der Nachbargemeinde ein Buchdorf – mit mittlerweile 80.000 Büchern.
Auf dem ersten Haus am Ortseingang von Mühlbeck, einem einstöckigen Ziegelbau, steht "Bücher Consum". Consum mit "C" im Unterschied zum Konsum-Laden, der bis zur Wende hier untergebracht war. Der Bücherconsum ist eines von zehn Antiquariaten in der Doppelgemeinde Mühlbeck-Friedersdorf.
Beim Eintreten übersieht man sie fast: Heidi Dehne, die Seele des Buchdorfs und Ladeninhaberin, die umgeben von hohen Regalen und Bananenkartons voll Lesestoff vor dem Computer an der Kasse sitzt.
"Wenn unsere Gäste hier reinkommen, sind die erst einmal erstaunt, dass bei uns zwar Ordnung herrscht, und zwar eine sehr penible, aber überall Bananenkartons herumstehen. Und ich habe gelernt, dass weltweit Antiquare Bananenkartons nutzen, weil die durch die doppelte Verstärkung an den Kanten durch Deckel und Boden fast ´ne Treppe bauen könnten aus den Kartons."
Über 80.000 Bücher verfügt ihr Laden, 27.000 davon sind schon erfasst, die anderen warten noch in den Kartons. Bis zu diesem Riesenbestand war es ein weiter Weg: Er begann mit dem Fall der Mauer. Ihn erlebte die Kinderbuchlektorin Heidi Dehne daheim im Rheinland am Fernsehschirm mit.
"Und da habe ich gesagt: So. Wenn jetzt die Wiedervereinigung kommt, dann musst du da hin. Da musst du hin. Da ist so viel los. Und dann bin ich hierhin. Aus Überzeugung, dass ich hier noch was schaffen kann, was im Westen in der Form nicht mehr möglich war. Weil - da war ja alles fertig, was sollte ich da? Das war mit Sicherheit nicht die Flucht in den Osten, sondern die Überzeugung, dass hier im Osten unendlich viel Arbeit ist."
Mit 52 Jahren machte sie sich, geschieden, die Kinder bereits erwachsen, 1994 auf nach Bitterfeld, wo nach der Leiterin eines Altenheims für eineinhalb Jahre gesucht wurde. Es war offenbar Liebe auf den ersten Blick, denn Heidi Dehne mietete ein kleines Haus noch bevor sie den Arbeitsvertrag in der Tasche hatte.
Beim Eintreten übersieht man sie fast: Heidi Dehne, die Seele des Buchdorfs und Ladeninhaberin, die umgeben von hohen Regalen und Bananenkartons voll Lesestoff vor dem Computer an der Kasse sitzt.
"Wenn unsere Gäste hier reinkommen, sind die erst einmal erstaunt, dass bei uns zwar Ordnung herrscht, und zwar eine sehr penible, aber überall Bananenkartons herumstehen. Und ich habe gelernt, dass weltweit Antiquare Bananenkartons nutzen, weil die durch die doppelte Verstärkung an den Kanten durch Deckel und Boden fast ´ne Treppe bauen könnten aus den Kartons."
Über 80.000 Bücher verfügt ihr Laden, 27.000 davon sind schon erfasst, die anderen warten noch in den Kartons. Bis zu diesem Riesenbestand war es ein weiter Weg: Er begann mit dem Fall der Mauer. Ihn erlebte die Kinderbuchlektorin Heidi Dehne daheim im Rheinland am Fernsehschirm mit.
"Und da habe ich gesagt: So. Wenn jetzt die Wiedervereinigung kommt, dann musst du da hin. Da musst du hin. Da ist so viel los. Und dann bin ich hierhin. Aus Überzeugung, dass ich hier noch was schaffen kann, was im Westen in der Form nicht mehr möglich war. Weil - da war ja alles fertig, was sollte ich da? Das war mit Sicherheit nicht die Flucht in den Osten, sondern die Überzeugung, dass hier im Osten unendlich viel Arbeit ist."
Mit 52 Jahren machte sie sich, geschieden, die Kinder bereits erwachsen, 1994 auf nach Bitterfeld, wo nach der Leiterin eines Altenheims für eineinhalb Jahre gesucht wurde. Es war offenbar Liebe auf den ersten Blick, denn Heidi Dehne mietete ein kleines Haus noch bevor sie den Arbeitsvertrag in der Tasche hatte.
Sie mietete ein Auto und holte die Kartons persönlich ab
Sie wollte hier bleiben, auch als der Vertrag auslief. Deshalb gründete sie eine Personal-Dienstleistungs- und Handels-Gesellschaft, und just als sich erste Erfolge einstellten, las sie 1996 in der Osterausgabe einer Zeitung einen Bericht über die englische Booktown Hay-on-Wye. Sie beschloss, sich das anzusehen.
"Und da habe ich übrigens meine Mutter mitgenommen, weil das immer praktisch war. Die Frau hatte gesunden Menschenverstand, und die stand mit zwei Füßen fest auf der Erde. Wenn ich also schon mal Höhenflüge hatte, hat die mich runtergeholt. Und in Hay habe ich so klare Fragen gestellt, die eigentlich schon unhöflich waren. Nach Geld, und Büchermenge, und auch wie lange gewartet, alles, was man fragt.
Und dann bin zurückgekommen und habe gesagt: Was die können, können wir auch. Und habe hier in Mühlbeck bei diesem Bürgermeister den Mann gefunden, der zufällig im Fernsehen über Redu in Belgien einen Film gesehen hatte, ein paar Tage bevor ich kam. Der wusste, was ein Buchdorf ist, und hat an diesem Film erkannt, dass ein Buchdorf eine von mehreren Möglichkeiten ist, um in einer toten ländlichen Region Leben zu erwecken."
Damit begann es für Heidi Dehne in Mühlbeck-Friedersdorf. Mit ihrer Firma ließ sie 25.000 Handzettel drucken, die sie am Leipziger Kirchentag verteilte: Man wolle ein Buchdorf gründen und suche dafür gebrauchte Bücher. Dann mietete sie ein Auto und holte die literarischen Hinterlassenschaften aus Erbe oder Umzug kartonweise aus ganz Deutschland nach Sachsen-Anhalt. Und hatte 1997, mit Start des Buchdorfs, 70.000 Bücher, um mögliche Antiquariate damit auszustatten. Nicht nur das.
"Und bis dahin sind aus irgendwelchen Ecken sechs Kollegen gekommen, unter anderem der Wirt aus dem Dorf, ich weiß bis heute noch nicht, wie die Story und die Geschichte zu denen gelandet ist. Sie waren jedenfalls da. Wir waren zum Eröffnen sieben Zwerge."
"Und da habe ich übrigens meine Mutter mitgenommen, weil das immer praktisch war. Die Frau hatte gesunden Menschenverstand, und die stand mit zwei Füßen fest auf der Erde. Wenn ich also schon mal Höhenflüge hatte, hat die mich runtergeholt. Und in Hay habe ich so klare Fragen gestellt, die eigentlich schon unhöflich waren. Nach Geld, und Büchermenge, und auch wie lange gewartet, alles, was man fragt.
Und dann bin zurückgekommen und habe gesagt: Was die können, können wir auch. Und habe hier in Mühlbeck bei diesem Bürgermeister den Mann gefunden, der zufällig im Fernsehen über Redu in Belgien einen Film gesehen hatte, ein paar Tage bevor ich kam. Der wusste, was ein Buchdorf ist, und hat an diesem Film erkannt, dass ein Buchdorf eine von mehreren Möglichkeiten ist, um in einer toten ländlichen Region Leben zu erwecken."
Damit begann es für Heidi Dehne in Mühlbeck-Friedersdorf. Mit ihrer Firma ließ sie 25.000 Handzettel drucken, die sie am Leipziger Kirchentag verteilte: Man wolle ein Buchdorf gründen und suche dafür gebrauchte Bücher. Dann mietete sie ein Auto und holte die literarischen Hinterlassenschaften aus Erbe oder Umzug kartonweise aus ganz Deutschland nach Sachsen-Anhalt. Und hatte 1997, mit Start des Buchdorfs, 70.000 Bücher, um mögliche Antiquariate damit auszustatten. Nicht nur das.
"Und bis dahin sind aus irgendwelchen Ecken sechs Kollegen gekommen, unter anderem der Wirt aus dem Dorf, ich weiß bis heute noch nicht, wie die Story und die Geschichte zu denen gelandet ist. Sie waren jedenfalls da. Wir waren zum Eröffnen sieben Zwerge."
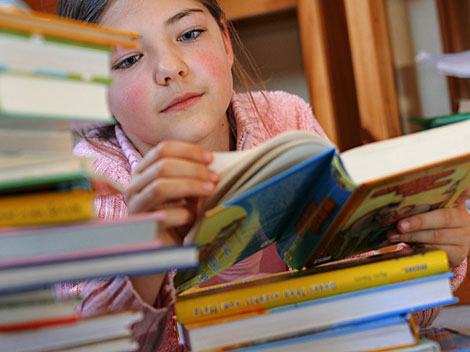
Lesendes Kind© picture alliance / dpa / Jens Büttner
"Mich hat das Ost-West-Gequake nie interessiert"
Und Mühlbeck-Friedersdorf, Deutschlands erstes Buchdorf, war das wach zu küssende Dornröschen. Nicht, dass nun alle mitgetan hätten. Doch auch anfängliche Reserviertheit gibt es heute nicht mehr: Das Buchdorf ist im Buchdorf heute unbestritten. Sie sei freundlich bis freundschaftlich in ihrer neuen Heimat aufgenommen worden, sagt Heidi Dehne.
"Mich hat das Ost-West-Gequake sowieso nie interessiert. Was kann ich dafür, dass ich zufällig im Rheinland geboren bin, was kann jemand anders dafür, der hier geboren ist? Und außerdem ich bin ja freiwillig hier und immer noch absolut überzeugt, im richtigen Teil von Deutschland jetzt zu wohnen, was nicht heißt, dass ich das Rheinland nicht schätze, nach wie vor. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin in einem Kulturumfeld – ich hab' das mal so formuliert: Als man hier schon mit Federkiel und Tinte schreiben konnte, sind wir im Rheinland noch im Bärenfell 'rumgehüpft und haben mit Pfeil und Bogen geschossen. Ist nicht schlimm, ist ja auch bis dahin noch was aus uns geworden, das macht nichts."
Heute liegt die Doppelgemeinde Mühlbeck-Friedersdorf sowohl am Lutherweg wie an der Straße der deutschen Sprache. Trotz neuem Tourismus ist es ein etwas verschlafener Ort geblieben. Viel hat Heidi Dehne, die alsbald in den Gemeinderat gewählt wurde, im Dorf initiiert. Etwa die Reihe "Showfenster", einmal im Monat, am so genannten Schnapsdatum: Am 1.1., 2.2. und so fort, leicht zu merken.
Es gibt Lesungen, Wettbewerbe, Konzerte, Religionsfeste, Teeverkostungen mit Buchdorftee. Bei ihrer täglichen Arbeit ist die Neu-Ostdeutsche aber auch auf eine Menge ihr Unbekanntes gestoßen, erzählt die Antiquarin bei einem Gang durch ihren Laden.
"Was ich als Wessi überhaupt nicht wusste, dass es die Reihe 'Erkundungen' gibt, und die ist fantastisch. Das sind Anthologien mit, sagen wir mal, 15, 20, 30, 40 Erzählungen aus den jeweiligen Ländern, und das ist ein ganz, ganz hervorragender Querschnitt. Und dann gibt es noch "Erlesenes" und es gibt "ad Libitum". Das sind Sachen, die waren für mich ganz neu, und da bin ich sehr glücklich darüber."
"Mich hat das Ost-West-Gequake sowieso nie interessiert. Was kann ich dafür, dass ich zufällig im Rheinland geboren bin, was kann jemand anders dafür, der hier geboren ist? Und außerdem ich bin ja freiwillig hier und immer noch absolut überzeugt, im richtigen Teil von Deutschland jetzt zu wohnen, was nicht heißt, dass ich das Rheinland nicht schätze, nach wie vor. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin in einem Kulturumfeld – ich hab' das mal so formuliert: Als man hier schon mit Federkiel und Tinte schreiben konnte, sind wir im Rheinland noch im Bärenfell 'rumgehüpft und haben mit Pfeil und Bogen geschossen. Ist nicht schlimm, ist ja auch bis dahin noch was aus uns geworden, das macht nichts."
Heute liegt die Doppelgemeinde Mühlbeck-Friedersdorf sowohl am Lutherweg wie an der Straße der deutschen Sprache. Trotz neuem Tourismus ist es ein etwas verschlafener Ort geblieben. Viel hat Heidi Dehne, die alsbald in den Gemeinderat gewählt wurde, im Dorf initiiert. Etwa die Reihe "Showfenster", einmal im Monat, am so genannten Schnapsdatum: Am 1.1., 2.2. und so fort, leicht zu merken.
Es gibt Lesungen, Wettbewerbe, Konzerte, Religionsfeste, Teeverkostungen mit Buchdorftee. Bei ihrer täglichen Arbeit ist die Neu-Ostdeutsche aber auch auf eine Menge ihr Unbekanntes gestoßen, erzählt die Antiquarin bei einem Gang durch ihren Laden.
"Was ich als Wessi überhaupt nicht wusste, dass es die Reihe 'Erkundungen' gibt, und die ist fantastisch. Das sind Anthologien mit, sagen wir mal, 15, 20, 30, 40 Erzählungen aus den jeweiligen Ländern, und das ist ein ganz, ganz hervorragender Querschnitt. Und dann gibt es noch "Erlesenes" und es gibt "ad Libitum". Das sind Sachen, die waren für mich ganz neu, und da bin ich sehr glücklich darüber."
"Ich hab' ja die Ungnade der westlichen Geburt"
Bücher mit Erzählungen von ungarischen, argentinischen oder finnischen Schriftstellern finden sich in den "Erkundungen." "Erlesenes" sind Novellensammlungen, und "Ad libitum" ist Zerstreuungsliteratur des Verlags Volk und Welt.
"Ich hab' ja die Ungnade der westlichen Geburt, um den Herrn Kohl mal abartig zu zitieren. Ich wollte wissen, wie DDR tickt. Und das kann man am allerbesten aus Schulbüchern erfahren. Wie mit Wissen umgegangen wird, wie es Kindern beigebracht wird – das sagt fast alles über ein Land, seine Denke, seine Fühle, alles aus."
Heidi Dehne war ursprünglich Kinderbuchlektorin. Heute ist einmal im Monat der örtliche Kindergarten zu Besuch im Bücher Consum. Als sie die Kleinen kürzlich fragte, wem daheim von den Eltern vorgelesen wird, reckten sich 13 Hände von 14 Kindern in die Höhe. Bücher kommen also doch nicht aus der Mode, auch wenn man im Antiquariat den Staub riecht, das vergilbte Papier, den bräunlichen Zahn der Zeit.
Es sind Hochregallager der Buchstaben und Worte, die im ehemaligen Dorfkaufhaus hintereinander stehen. Sie bergen den Lesestoff von gestern oder eben erst. Grell fordernd ist er oder schweigend farblos und eintönig, abgegriffen und elegant. Weitgereist sind die Werke oder aus dem Nachlass von nebenan. Gleichberechtigt stehen sie hier Rücken an Rücken, oft einander fremd in Inhalt und Herkunft. Dünne Novellenbändchen gegenüber umfangreichen Abhandlungen. Sie sind Reisende im Transitraum, für mal kürzer, mal länger, im Zwischenstopp oder als Ladenhüter.
Wenn sie ein Buch nach 15 Jahren noch immer für einen Euro verkauft, hat sie eigentlich Geld draufgelegt, sagt Heidi Dehne, die Geschäftsfrau. So manches Buch hat schon lange keine Menschenhand mehr berührt, kein Finger die Seiten umgeblättert, sich kein Bücherwurm über die Zeilen gefressen. Stumm warten sie alle einen Liebhaber zu finden, warten auf ein neues Zuhause: Flaubert, Shakespeare, Ebner-Eschenbach, Fallada, Anzengrubers "Steinklopfer Hannes". Sternheims frühe Dramen. Oder, nach Sprachen sortiert: Jiddisch, Kasachisch, Latein, Litauisch, viel Russisch.
"Ich hab' ja die Ungnade der westlichen Geburt, um den Herrn Kohl mal abartig zu zitieren. Ich wollte wissen, wie DDR tickt. Und das kann man am allerbesten aus Schulbüchern erfahren. Wie mit Wissen umgegangen wird, wie es Kindern beigebracht wird – das sagt fast alles über ein Land, seine Denke, seine Fühle, alles aus."
Heidi Dehne war ursprünglich Kinderbuchlektorin. Heute ist einmal im Monat der örtliche Kindergarten zu Besuch im Bücher Consum. Als sie die Kleinen kürzlich fragte, wem daheim von den Eltern vorgelesen wird, reckten sich 13 Hände von 14 Kindern in die Höhe. Bücher kommen also doch nicht aus der Mode, auch wenn man im Antiquariat den Staub riecht, das vergilbte Papier, den bräunlichen Zahn der Zeit.
Es sind Hochregallager der Buchstaben und Worte, die im ehemaligen Dorfkaufhaus hintereinander stehen. Sie bergen den Lesestoff von gestern oder eben erst. Grell fordernd ist er oder schweigend farblos und eintönig, abgegriffen und elegant. Weitgereist sind die Werke oder aus dem Nachlass von nebenan. Gleichberechtigt stehen sie hier Rücken an Rücken, oft einander fremd in Inhalt und Herkunft. Dünne Novellenbändchen gegenüber umfangreichen Abhandlungen. Sie sind Reisende im Transitraum, für mal kürzer, mal länger, im Zwischenstopp oder als Ladenhüter.
Wenn sie ein Buch nach 15 Jahren noch immer für einen Euro verkauft, hat sie eigentlich Geld draufgelegt, sagt Heidi Dehne, die Geschäftsfrau. So manches Buch hat schon lange keine Menschenhand mehr berührt, kein Finger die Seiten umgeblättert, sich kein Bücherwurm über die Zeilen gefressen. Stumm warten sie alle einen Liebhaber zu finden, warten auf ein neues Zuhause: Flaubert, Shakespeare, Ebner-Eschenbach, Fallada, Anzengrubers "Steinklopfer Hannes". Sternheims frühe Dramen. Oder, nach Sprachen sortiert: Jiddisch, Kasachisch, Latein, Litauisch, viel Russisch.
Kochbücher gehen weg, bevor sie noch eingeordnet sind
Die "Ökonomische Strategie der SED" gibt es zweimal. Ukrainische Volkskunst ist dem mexikanischen Realismus benachbart. Im Buch "Vermögensbildung – Bilanz und Perspektiven, Köln 1975" findet sich ein Stempel: "Aus dem Bestand der Geschwister-Scholl-Schule ausgeschieden." Kochbücher gehen weg, bevor sie noch eingeordnet sind, sagt Heidi Dehne zwischen den Regalen.
"Ich habe eine Riesensammlung von Geo. Das ist zwar nichts, was sich wie Butter, Eier, Käse umschlägt. Aber wir machen uns die Mühe und nehmen die Hauptthemen auf. Und die sind bei einer Volltextsuche, wenn man bei uns durch den Bestand im Netz geht, natürlich kommen die hoch. Oder wenn hier jetzt jemand fragt, haben Sie über Nofretete irgendwas, dann kann ich das eingeben, und wenn das in irgendeinem Geo-Heft steht oder so, kommt's hoch."
Akkuratesse ist eine der Frau Dehne auch von der Branche bescheinigten Eigenschaften. Eine halbe Stunde benötigen sie oder ihre Mitarbeiterin, Bärbel Franz, um ein Buch im Computer aufzunehmen. Da geht es dann nicht nur um Titel, Autor und Verlag: Heidi Dehne hat eine eigene Maske entworfen, in der auch die Farbe des Buchrückens, um das Werk leichter im Regal finden zu können, angegeben ist. Wo Höhe und Breite, Zustand des Exemplars, Seitenanzahl, Auflage und vieles mehr eingetragen werden.
Es sind die sowohl praktischen wie pfiffigen Überlegungen der Antiquarin, die einem immer wieder begegnen: Ob es die ausleihbaren Lesebrillen am Eingang sind, oder das Café nebenan: Vom Trinknapf für den Hund über die Tischlektüre bis zum Kindersitz auf der Toilette ist für alles gesorgt. An der Fassade des Hauses baumelt ein unscheinbares Kabel: Für eine mögliche Elektro-Tankstelle, meint die ideenreiche Unternehmerin. Das Café, das vor ein paar Jahren dazu gekommen ist, eine umgebaute Scheune neben dem Bücher-Consum, hat sie KaffeeSatz getauft. Auch aus Kaffeesatz lässt sich bekanntlich lesen. Von hier sieht man quer über den Garten zum hintersten Raum des Antiquariats.
"Ich habe eine Riesensammlung von Geo. Das ist zwar nichts, was sich wie Butter, Eier, Käse umschlägt. Aber wir machen uns die Mühe und nehmen die Hauptthemen auf. Und die sind bei einer Volltextsuche, wenn man bei uns durch den Bestand im Netz geht, natürlich kommen die hoch. Oder wenn hier jetzt jemand fragt, haben Sie über Nofretete irgendwas, dann kann ich das eingeben, und wenn das in irgendeinem Geo-Heft steht oder so, kommt's hoch."
Akkuratesse ist eine der Frau Dehne auch von der Branche bescheinigten Eigenschaften. Eine halbe Stunde benötigen sie oder ihre Mitarbeiterin, Bärbel Franz, um ein Buch im Computer aufzunehmen. Da geht es dann nicht nur um Titel, Autor und Verlag: Heidi Dehne hat eine eigene Maske entworfen, in der auch die Farbe des Buchrückens, um das Werk leichter im Regal finden zu können, angegeben ist. Wo Höhe und Breite, Zustand des Exemplars, Seitenanzahl, Auflage und vieles mehr eingetragen werden.
Es sind die sowohl praktischen wie pfiffigen Überlegungen der Antiquarin, die einem immer wieder begegnen: Ob es die ausleihbaren Lesebrillen am Eingang sind, oder das Café nebenan: Vom Trinknapf für den Hund über die Tischlektüre bis zum Kindersitz auf der Toilette ist für alles gesorgt. An der Fassade des Hauses baumelt ein unscheinbares Kabel: Für eine mögliche Elektro-Tankstelle, meint die ideenreiche Unternehmerin. Das Café, das vor ein paar Jahren dazu gekommen ist, eine umgebaute Scheune neben dem Bücher-Consum, hat sie KaffeeSatz getauft. Auch aus Kaffeesatz lässt sich bekanntlich lesen. Von hier sieht man quer über den Garten zum hintersten Raum des Antiquariats.
Götter und Philosophen stehen zusammen
"Raum 4 hat die Götter und Gelehrten, sprich die gesamte Theologie, die ich als einzige bei uns im Buchdorf übernommen habe, weil die Kollegen, die hier groß geworden sind, das nicht übernehmen wollten. Ich habe einen sehr großen Bestand an theologischer Literatur, die leider auch noch daran krankt, dass ich sie nicht komplett aufnehmen konnte. Das ist so viel, ich bin da noch dran. Und hier hinten, im Anschluss an die Götter, haben wir die Philosophen stehen, weil ich gesagt habe, die passen zusammen. Und wir haben natürlich Marx-Engels und alles was sich drum rum schart, oder auch davor oder danach war. Das ist eigentlich unser Bestand. Und ich muss sagen, wenn keiner uns, in Anführungsstrichen, foppt und ein Buch aus der Theaterwissenschaft zwischen die Bücher über den Papst schummelt, dann finden wir auch, was wir hier haben."
Seife zu Milch nennt die Antiquarin die aus Supermärkten bekannte Unart der Kunden, entnommene Artikel anderswo abzustellen. Das ist besonders bei Raritäten ärgerlich. Auch die gibt es im Buchdorf.
"Bei mir gab es ein Blatt in A4-Größe, zweimal gebogen, über die Grabbelegung des Friedhofs in Weimar. Kein normaler Antiquar nimmt das ins Netz auf. Ich hab das gemacht. Ich hab's auch verkauft. Das ist 'ne Rarität. Die gibt´s nicht mehr, das Blatt ist ja ewig weg. Und solche Sachen machen mir Riesenspaß. Oder eine Schiffsspeisekarte von irgendeinem Fährschiff. Wer hat die denn noch?"
Ihr Verhältnis zu Büchern ist noch bewusster geworden, sagt Heidi Dehne, die seit nun mehr als anderthalb Jahrzehnten tagein, tagaus von Büchern umgeben ist.
"Als ich dann mit Buchdorf angefangen habe, habe ich die ersten fünf Jahre Staub gewischt, Preise gemacht, geputzt, eingeräumt, umgeräumt und geschlafen. Neben diesen 16 bis 18 Stunden, die ich jeden Tag gearbeitet habe, war ich viel zu müde, um irgendein ein Buch zu lesen.
Ich habe den Titel angekuckt, wie viel Seiten hat das Buch, ist es ordentlich geschrieben, ist es schmutzig, ist es nicht schmutzig, fertig. Inzwischen ist es so, ich lese wieder. Seit ungefähr fünf Jahren habe ich beschlossen: Wenn ich nun schon ein Buchdorf habe, will ich auch lesen. Und ich sitze ja an der Quelle. Ich wohne im selben Haus wie mein Geschäft ist. Ich kann die Bücher mit nach oben nehmen, setze mich aufs Sofa und kucke rein: Will ich das lesen oder will ich das nicht lesen? Und wenn ich es will, dann behalte ich es mindestens so lange, bis ich es gelesen habe, und ab und zu wandert es dann auch in meinen eigenen Bücherschrank. Ich lese Reisebücher, ich lese Biografien und ich lese Sachbücher."
Lieblingsbücher hat sie nicht. Nicht mehr, das Interesse ist zu breit geworden. Nur Wörterbücher oder Spracherklärungsbücher kann sie nicht liegen lassen.
"Ich habe zehn laufende Meter von Sprachen, die ich entweder schon gelernt habe oder noch lernen möchte. Ich brauche also noch ungefähr 30 Jahre, um das zu bewältigen, aber das werde ich wohl noch schaffen."
Seife zu Milch nennt die Antiquarin die aus Supermärkten bekannte Unart der Kunden, entnommene Artikel anderswo abzustellen. Das ist besonders bei Raritäten ärgerlich. Auch die gibt es im Buchdorf.
"Bei mir gab es ein Blatt in A4-Größe, zweimal gebogen, über die Grabbelegung des Friedhofs in Weimar. Kein normaler Antiquar nimmt das ins Netz auf. Ich hab das gemacht. Ich hab's auch verkauft. Das ist 'ne Rarität. Die gibt´s nicht mehr, das Blatt ist ja ewig weg. Und solche Sachen machen mir Riesenspaß. Oder eine Schiffsspeisekarte von irgendeinem Fährschiff. Wer hat die denn noch?"
Ihr Verhältnis zu Büchern ist noch bewusster geworden, sagt Heidi Dehne, die seit nun mehr als anderthalb Jahrzehnten tagein, tagaus von Büchern umgeben ist.
"Als ich dann mit Buchdorf angefangen habe, habe ich die ersten fünf Jahre Staub gewischt, Preise gemacht, geputzt, eingeräumt, umgeräumt und geschlafen. Neben diesen 16 bis 18 Stunden, die ich jeden Tag gearbeitet habe, war ich viel zu müde, um irgendein ein Buch zu lesen.
Ich habe den Titel angekuckt, wie viel Seiten hat das Buch, ist es ordentlich geschrieben, ist es schmutzig, ist es nicht schmutzig, fertig. Inzwischen ist es so, ich lese wieder. Seit ungefähr fünf Jahren habe ich beschlossen: Wenn ich nun schon ein Buchdorf habe, will ich auch lesen. Und ich sitze ja an der Quelle. Ich wohne im selben Haus wie mein Geschäft ist. Ich kann die Bücher mit nach oben nehmen, setze mich aufs Sofa und kucke rein: Will ich das lesen oder will ich das nicht lesen? Und wenn ich es will, dann behalte ich es mindestens so lange, bis ich es gelesen habe, und ab und zu wandert es dann auch in meinen eigenen Bücherschrank. Ich lese Reisebücher, ich lese Biografien und ich lese Sachbücher."
Lieblingsbücher hat sie nicht. Nicht mehr, das Interesse ist zu breit geworden. Nur Wörterbücher oder Spracherklärungsbücher kann sie nicht liegen lassen.
"Ich habe zehn laufende Meter von Sprachen, die ich entweder schon gelernt habe oder noch lernen möchte. Ich brauche also noch ungefähr 30 Jahre, um das zu bewältigen, aber das werde ich wohl noch schaffen."
Manchmal kommt eine Busladung voller Gäste
Heidi Dehne wird in diesem Jahr 71 Jahre alt. Den Vorsitz im Förderverein Buchdorf hat sie vor zwei Jahren abgegeben. Dennoch bleibt das Arbeitsprogramm beachtlich. Denn zur Buchhandlung ist das Café dazugekommen, wo sich schon mal eine Busladung Gäste zur Jause anmeldet und sie mit ihrer Mitarbeiterin Kaffee und Kuchen servieren muss. Außerdem vermietet Heidi Dehne Zimmer über dem Antiquariat und dem Café.
"Ich gehe zwischen eins und zwei ins Bett und ich stehe im Winter um sechs auf, im Sommer um halb sechs. Und Napoleon hat auch viele Siege errungen, bis Waterloo."
Ihrer Gemeinde hat sie zu einem Alleinstellungsmerkmal verholfen, sie unverwechselbar gemacht. Es gibt aber auch Tage wie diesen, an denen selbst mit Büchern nichts los ist: Es regnet heute immer wieder. Niemand ist auf den holprigen Straßen Mühlbecks unterwegs. Sie tragen noch Namen aus vergangener Zeit wie Karl-Marx-Straße oder Friedensstraße, weisen aber auch auf die eigene Bedeutung in der Gegenwart hin: Pergamentstraße und Papierweg.
In der Dorfmitte liegt ein von einem Mäuerchen eingefasster Seerosenteich zwischen Schilf, hohem Gras und Klee. Niedrige Häuser ducken sich rundum. Eine große Tafel mit Ortsplan kündet von Deutschlands erstem Buchdorf. Schilder weisen zum Antiquariat Alte Schule oder zum Buch- und Luftfahrtantiquariat. Im Nachbarort Friedersdorf stehen Bücher dicht gedrängt in den kleinen Fenstern des Buch- und Antikgasthofs Stern.
Im "KaffeeSatz" brummt die Kaffeemaschine heute nur für den Gast vom Radio. Wer ins Buchdorf kommt, tut dies gezielt. Aber auch nicht bei diesem Wetter. Gestern saß noch ein Professor aus den Niederlanden vor dem Lokal und schmökerte in literarischer Second-Hand-Ware. Er hält sich zur Erforschung der Bienen im Lande auf. Durchaus kommen die Kunden von weither, erzählt Heidi Dehne. Einmal trat ein Gastprofessor in Heidelberg ins Geschäft, der in einer Alumnen-Zeitung in seiner kalifornischen Heimat über das Buchdorf Mühlbeck-Friedersdorf gelesen hatte und es sich nun, da er in Deutschland weilte, ansehen wollte. Zum zehnjährigen Jubiläum des Buchdorfs war ein Interessent eigens aus Südkorea angereist. Die Radtouristen, die um die neuen Seen strampeln, verirren sich hingegen kaum in die Buchhandlung. Natürlich gibt es auch Stammkunden, Wiederholungstäter wie sie Heidi Dehne nennt. Seit 2002, als sie begann die Bücher auch im Internet zu vertreiben, hat sich diese Internationalität weiter verstärkt.
"Der Onlinehandel ist für mich das geschickteste Medium der Öffentlichkeitsarbeit. Wir verkaufen Bücher von einem Euro aufwärts, und jede Sendung bekommt die Information übers Buchdorf dazu, oder wenn ich mir ankucke, was jemand bestellt hat, dann vielleicht auch die eine oder andere Zusatzinformation, lege ich dazu."
"Ich gehe zwischen eins und zwei ins Bett und ich stehe im Winter um sechs auf, im Sommer um halb sechs. Und Napoleon hat auch viele Siege errungen, bis Waterloo."
Ihrer Gemeinde hat sie zu einem Alleinstellungsmerkmal verholfen, sie unverwechselbar gemacht. Es gibt aber auch Tage wie diesen, an denen selbst mit Büchern nichts los ist: Es regnet heute immer wieder. Niemand ist auf den holprigen Straßen Mühlbecks unterwegs. Sie tragen noch Namen aus vergangener Zeit wie Karl-Marx-Straße oder Friedensstraße, weisen aber auch auf die eigene Bedeutung in der Gegenwart hin: Pergamentstraße und Papierweg.
In der Dorfmitte liegt ein von einem Mäuerchen eingefasster Seerosenteich zwischen Schilf, hohem Gras und Klee. Niedrige Häuser ducken sich rundum. Eine große Tafel mit Ortsplan kündet von Deutschlands erstem Buchdorf. Schilder weisen zum Antiquariat Alte Schule oder zum Buch- und Luftfahrtantiquariat. Im Nachbarort Friedersdorf stehen Bücher dicht gedrängt in den kleinen Fenstern des Buch- und Antikgasthofs Stern.
Im "KaffeeSatz" brummt die Kaffeemaschine heute nur für den Gast vom Radio. Wer ins Buchdorf kommt, tut dies gezielt. Aber auch nicht bei diesem Wetter. Gestern saß noch ein Professor aus den Niederlanden vor dem Lokal und schmökerte in literarischer Second-Hand-Ware. Er hält sich zur Erforschung der Bienen im Lande auf. Durchaus kommen die Kunden von weither, erzählt Heidi Dehne. Einmal trat ein Gastprofessor in Heidelberg ins Geschäft, der in einer Alumnen-Zeitung in seiner kalifornischen Heimat über das Buchdorf Mühlbeck-Friedersdorf gelesen hatte und es sich nun, da er in Deutschland weilte, ansehen wollte. Zum zehnjährigen Jubiläum des Buchdorfs war ein Interessent eigens aus Südkorea angereist. Die Radtouristen, die um die neuen Seen strampeln, verirren sich hingegen kaum in die Buchhandlung. Natürlich gibt es auch Stammkunden, Wiederholungstäter wie sie Heidi Dehne nennt. Seit 2002, als sie begann die Bücher auch im Internet zu vertreiben, hat sich diese Internationalität weiter verstärkt.
"Der Onlinehandel ist für mich das geschickteste Medium der Öffentlichkeitsarbeit. Wir verkaufen Bücher von einem Euro aufwärts, und jede Sendung bekommt die Information übers Buchdorf dazu, oder wenn ich mir ankucke, was jemand bestellt hat, dann vielleicht auch die eine oder andere Zusatzinformation, lege ich dazu."

Die Goitzsche bei Bitterfeld© BUND
Durchs Internet ist das Buchdorf bekannter geworden
Online ist zum zweiten, wetterunabhängigen Vertriebskanal geworden. Außerdem benutzt ihn Heidi Dehne auch zur Werbung für ihre neue Heimat, die ihr so ans Herz gewachsen ist. Um das zu unterstreichen und weil an diesem Tag ohnedies kein Kunde in den Laden kommt, führt sie mich zu einem der neuen Wahrzeichen der Region, dem Bitterfelder Bogen, einer begehbaren Skulptur, die zwei ineinandergreifende Baggerschaufeln darstellen soll und eigentlich ein moderner Aussichtsturm mit 30 Metern Höhe auf einem Abraumberg ist. Und dann zeigt sie auf die andere Seite, wo seit einigen Jahren Bitterfeld, einst Europas schmutzigste Stadt der Chemie und des Bergbaus, zur Stadt am See geworden ist: Marina statt Chemiewerk. Der ehemalige Tagebau wurde geflutet. Mühlbeck-Friedersdorf liegt nun auf einem etwa zwei Kilometer breiten Damm zwischen der Goitzsche und dem Muldestausee.
"Und ich habe eine wunderbare Erinnerung an die Geburt dieses Sees. Wir haben Muldewasser aus der Mulde hier rücklaufen lassen, und ich bin neben den Tropfen, es waren buchstäblich Tropfen, hergelaufen, als der See in 70 Meter Tiefe angefangen hat ein See zu werden. Und jetzt haben wir dann die Höhe."
Heidi Dehne spricht von einer Reinkarnation Bitterfelds nach seiner Zeit im Chemiedreieck der DDR. Ein besonderes Mikroklima habe sich rund um das Buchdorf entwickelt, das gesund für die Atemwege sei. Und am und im Goiztsche-See könne man jegliche Art von Sport betreiben. Deshalb ist es klar, dass die Antwort auf die Frage, ob sie das alles noch einmal machen würde, nur lauten kann:
"Sofort. Sofort."
Dennoch bleibt Heidi Dehne kühl realistisch, deutet an, sich zurückziehen zu wollen, träumt vom Reisen und davon, Werbung für das Buchdorf ohne die tägliche Arbeit im Laden zu machen. Kann sie loslassen, von dem, was sie in Mühlbeck-Friedersdorf geschaffen hat?
"Ich gehöre zu den Eltern, die ihre Kinder groß gezogen haben, damit sie lebensfähig sind. Und wenn ich bitte mal die Analogie gebrauchen darf, das Buchdorf ist mein Kind, aber ich habe das ja großgezogen, damit es lebensfähig ist. Das beantwortet hoffentlich Ihre Frage."
"Und ich habe eine wunderbare Erinnerung an die Geburt dieses Sees. Wir haben Muldewasser aus der Mulde hier rücklaufen lassen, und ich bin neben den Tropfen, es waren buchstäblich Tropfen, hergelaufen, als der See in 70 Meter Tiefe angefangen hat ein See zu werden. Und jetzt haben wir dann die Höhe."
Heidi Dehne spricht von einer Reinkarnation Bitterfelds nach seiner Zeit im Chemiedreieck der DDR. Ein besonderes Mikroklima habe sich rund um das Buchdorf entwickelt, das gesund für die Atemwege sei. Und am und im Goiztsche-See könne man jegliche Art von Sport betreiben. Deshalb ist es klar, dass die Antwort auf die Frage, ob sie das alles noch einmal machen würde, nur lauten kann:
"Sofort. Sofort."
Dennoch bleibt Heidi Dehne kühl realistisch, deutet an, sich zurückziehen zu wollen, träumt vom Reisen und davon, Werbung für das Buchdorf ohne die tägliche Arbeit im Laden zu machen. Kann sie loslassen, von dem, was sie in Mühlbeck-Friedersdorf geschaffen hat?
"Ich gehöre zu den Eltern, die ihre Kinder groß gezogen haben, damit sie lebensfähig sind. Und wenn ich bitte mal die Analogie gebrauchen darf, das Buchdorf ist mein Kind, aber ich habe das ja großgezogen, damit es lebensfähig ist. Das beantwortet hoffentlich Ihre Frage."
