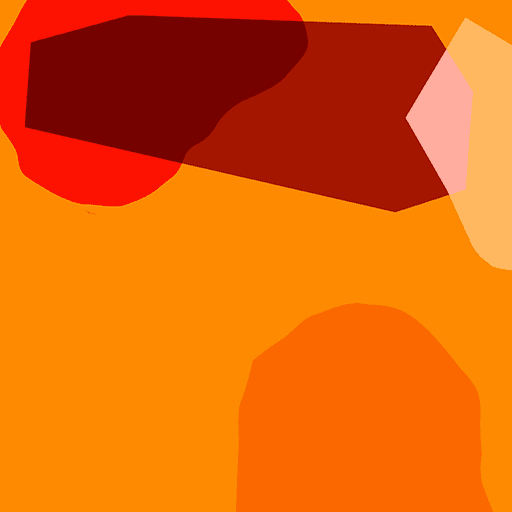„Die halbe Antike in eineinhalb Opern“
Sie ist eine der längsten und schwierigsten Opern des gesamten Repertoires: „Les Troyens“ von Hector Berlioz kam zu Lebzeiten des Komponisten nur in verstümmelter Form auf die Bühne und ist auch heute ein höchst seltener Gast auf den Spielplänen. Der britische Regisseur David Pountney hat sich dieser Herausforderung gestellt und Berlioz‘ „Trojaner“ an der Deutschen Oper Berlin inszeniert.
Zum ersten Mal seit 1930 kommen die „Trojaner“ von Hector Berlioz wieder auf eine Berliner Opernbühne, und damit ist schon viel über die Interpretationsgeschichte dieser besonderen „Grand Opéra“ gesagt. In den Jahren 1856 bis 1858 erfüllte sich der französische Komponist Hector Berlioz einen Lebenstraum und komponierte diese Oper nach der „Aeneis“ seines Lieblingsdichters Vergil.
In fünf Akten durchmisst Berlioz einen beträchtlichen Teil der antiken Mythologie, schildert in den ersten beiden Akten die Einnahme Trojas durch die Griechen und in den Akten drei bis fünf die unglückliche Liebe zwischen dem schiffbrüchigen Äneas und der Königin Dido von Karthago.
Der trojanische und der karthagische Teil des Werkes unterscheiden sich sowohl inhaltlich als auch musikalisch erheblich voneinander: Währen der erste Teil im Stil der Opern Glucks gehalten ist, erinnert der zweite mit seinen Massenszenen und langen Balletteinlagen an die Form der „Grand Opéra“, wie sie vor allem Giacomo Meyerbeer zu Berlioz‘ Zeiten in Paris etabliert hatte. Die Einheit des Werkes wurde von Berlioz selbst aufgegeben, um eine Aufführung zu ermöglichen, und sie wurde im Laufe der Aufführungsgeschichte immer wieder angezweifelt. Erst 1969 wurde das Werk erst mals vollständig aufgeführt – in Glasgow.
Tatsächlich sind es vor allem britische Künstler, die sich für Berlioz starkgemacht haben. 1947 war Sir Thomas Beecham der erste Dirigent, der die „Trojaner“ halbwegs vollständig einspielte; aus dem Royal Opera House Covent Garden existiert ein Mitschnitt unter Rafael Kubelik von 1957 – aber der große Durchbruch kam erst durch den unermüdlichen Sir Colin Davis, der sich die (Wieder-) Entdeckung der Berliozschen Musik zur Lebensaufgabe gemacht hat. Unser Gesprächspartner David Pountney, Regisseur und Intendant der Bregenzer Festspiele, ist ebenfalls einer jener Briten, die für die Interpretation des grandiosen (und grandios schwierigen) Werkes von Hector Berlioz einstehen.
In fünf Akten durchmisst Berlioz einen beträchtlichen Teil der antiken Mythologie, schildert in den ersten beiden Akten die Einnahme Trojas durch die Griechen und in den Akten drei bis fünf die unglückliche Liebe zwischen dem schiffbrüchigen Äneas und der Königin Dido von Karthago.
Der trojanische und der karthagische Teil des Werkes unterscheiden sich sowohl inhaltlich als auch musikalisch erheblich voneinander: Währen der erste Teil im Stil der Opern Glucks gehalten ist, erinnert der zweite mit seinen Massenszenen und langen Balletteinlagen an die Form der „Grand Opéra“, wie sie vor allem Giacomo Meyerbeer zu Berlioz‘ Zeiten in Paris etabliert hatte. Die Einheit des Werkes wurde von Berlioz selbst aufgegeben, um eine Aufführung zu ermöglichen, und sie wurde im Laufe der Aufführungsgeschichte immer wieder angezweifelt. Erst 1969 wurde das Werk erst mals vollständig aufgeführt – in Glasgow.
Tatsächlich sind es vor allem britische Künstler, die sich für Berlioz starkgemacht haben. 1947 war Sir Thomas Beecham der erste Dirigent, der die „Trojaner“ halbwegs vollständig einspielte; aus dem Royal Opera House Covent Garden existiert ein Mitschnitt unter Rafael Kubelik von 1957 – aber der große Durchbruch kam erst durch den unermüdlichen Sir Colin Davis, der sich die (Wieder-) Entdeckung der Berliozschen Musik zur Lebensaufgabe gemacht hat. Unser Gesprächspartner David Pountney, Regisseur und Intendant der Bregenzer Festspiele, ist ebenfalls einer jener Briten, die für die Interpretation des grandiosen (und grandios schwierigen) Werkes von Hector Berlioz einstehen.