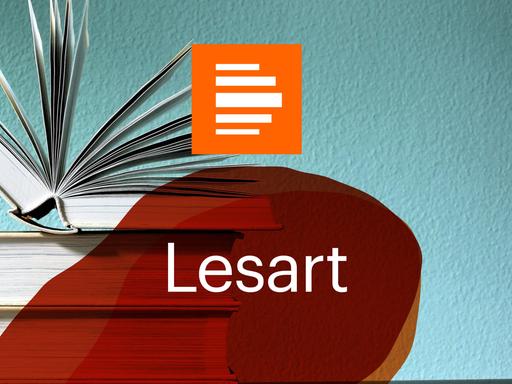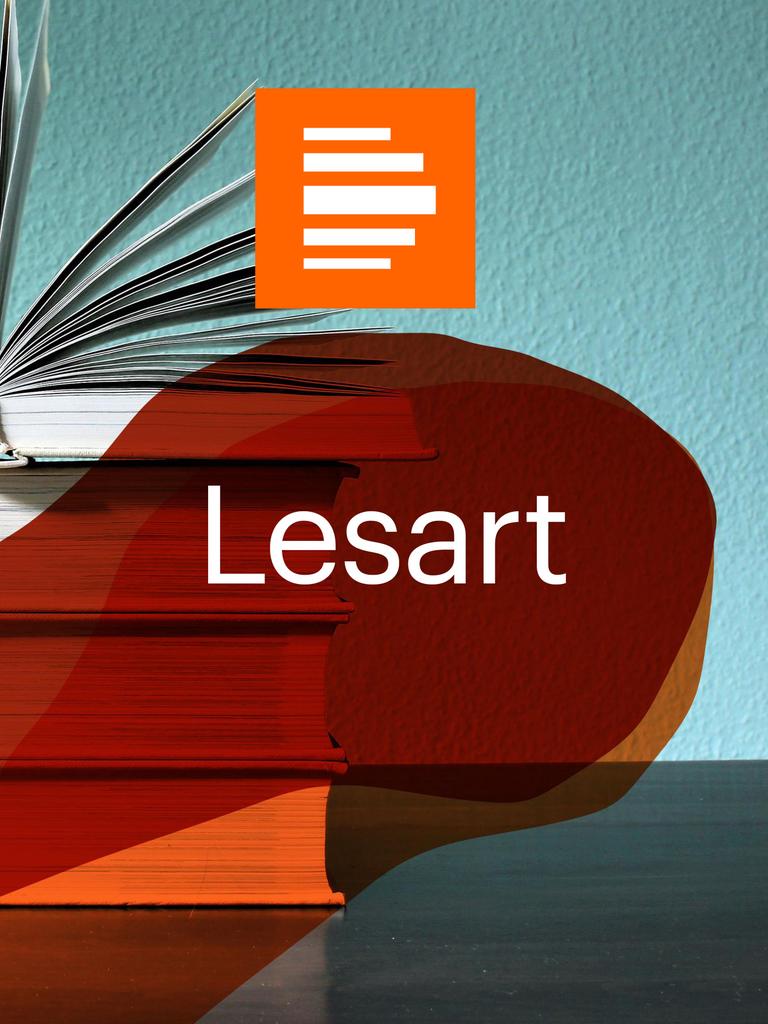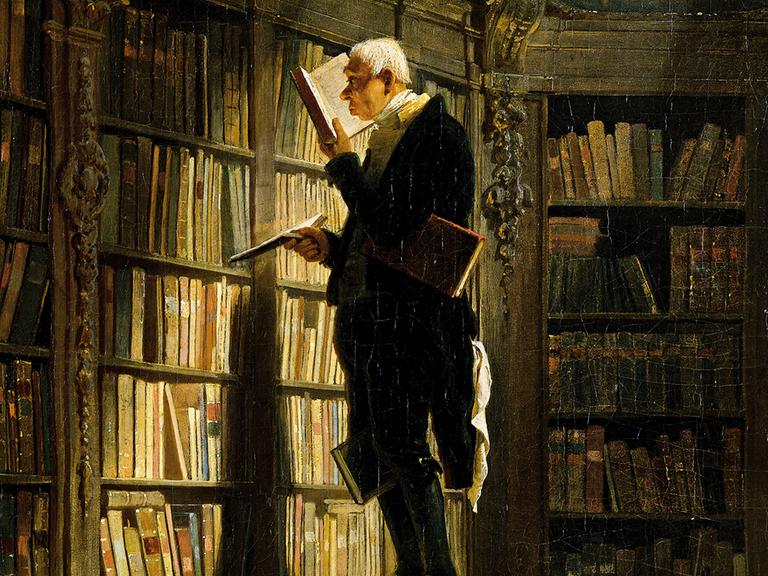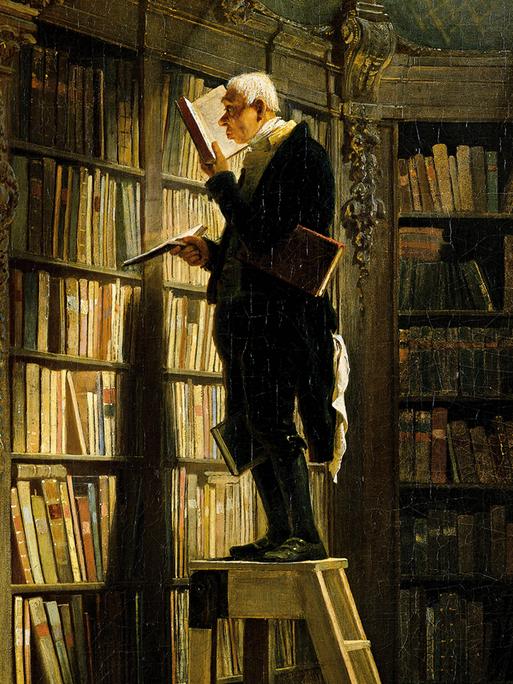Shortlist

Die Shortlist-Titel des Deutschen Buchpreises gelten als sichere Verkaufsschlager – kaum verkündet, werden in den Verlagen schon Nachdrucke geordert. © Christof Jakob
Unsere Favoriten für den Deutschen Buchpreis 2025

Sechs Romane konkurrieren in diesem Jahr um den wichtigsten Literaturpreis des Landes. Mit zwei Debüts, neuen Stimmen und bekannten Namen setzt die Jury auf Vielfalt und gesellschaftliche Relevanz – und trifft damit eine risikofreudige Wahl.
Die Jury des Deutschen Buchpreises 2025 hat sechs Romane aus der Longlist ausgewählt – eine Mischung aus etablierten und neuen Stimmen. Neben erfahrenen Autoren wie Dorothee Elmiger, Christine Wunnicke und Thomas Melle stehen drei neuere Namen: Kaleb Erdmann mit seinem zweiten Roman „Die Ausweichschule“ sowie die beiden Debütantinnen Jehona Kicaj mit ihrem Roman „ë“ und Fiona Sironic mit ihrem Buch „Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft“.
Die Auswahl blickt tief in psychologische, gesellschaftliche und politische Themen – von Depression und Suizid über Gewalt bis hin zu Fragen von Sprache, Herkunft und Identität. Unsere Literaturredakteurinnen und -redakteure erzählen, welche Titel ihre Favoriten sind.
Kaleb Erdmann: „Die Ausweichschule“
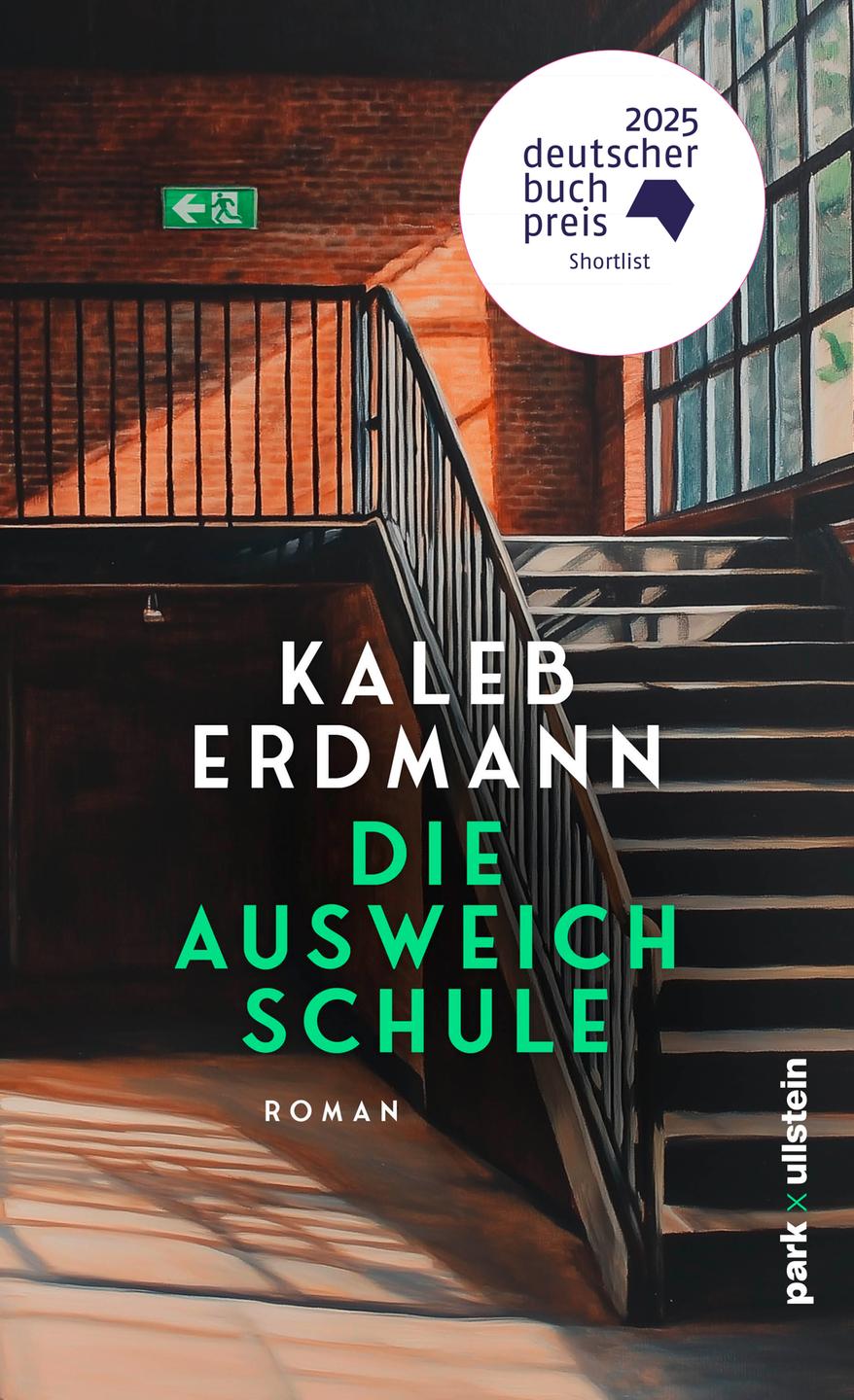
Der Autor Kaleb Erdmann, selbst Zeitzeuge des Erfurter Amoklaufs, verarbeitet in seinem Roman die Folgen des Traumas.© Ullstein Verlag
Woran denken wir, wenn wir Erfurt hören, also den Namen der Landeshauptstadt von Thüringen? Nicht wenige Menschen denken an etwas Unvorstellbares – darunter auch der namenlose Erzähler, ein Schriftsteller in Kaleb Erdmanns autofiktionalem Roman „Die Ausweichschule“.
Dieses Unvorstellbare liegt gut 20 Jahre zurück. Er sitzt in der Schule, er ist ein Fünftklässler, und er schreibt eine Kurzarbeit über Pinguine. Als es irgendwo in der Schule rumst, vielleicht von einer Baustelle, dann poltert etwas – und dann geht die Tür auf, und ein vermummter Typ sieht ins Klassenzimmer. Er ist bewaffnet. Er sieht sich um, und dann geht er wieder raus.
Kaleb Erdmann selbst und sein Alter Ego im Roman erzählen das nicht so wie ich jetzt. Denn das ist eben kein True-Crime-Plot. Trotzdem ist der Roman spannend, denn er macht das Unvorstellbare nach dem Unvorstellbaren lesbar: die Überforderung, das Verdrängen und das Nichtvergessen nach einem Mordanschlag auf Menschen in einer Schule in Erfurt.
Am 26. April 2002 wurden dabei 17 Menschen getötet und Hunderte traumatisiert. Und dieses Trauma ist für den Erzähler im Roman eine Odyssee, die ich erst dank dieses Buches verstehe. Er hat Panikattacken auf dem siffigen ICE-Klo. Er hat Zwänge, die sehr peinlich werden können, wenn er dabei ertappt wird. Er schläft nicht, er recherchiert sich kaputt.
Wir kommen ihm sehr nah, bleiben aber auch auf Distanz – was mich beeindruckt hat. Allein der Titel schreit Distanz: Ausweichschule. Was für ein Wort. Wohin ist da wer ausgewichen? Bitte lesen! (Lydia Harms)
Kaleb Erdmann: „Die Ausweichschule“
park x ullstein Verlag, Berlin, 2025
304 Seiten, 22 Euro
Christine Wunnicke: „Wachs“
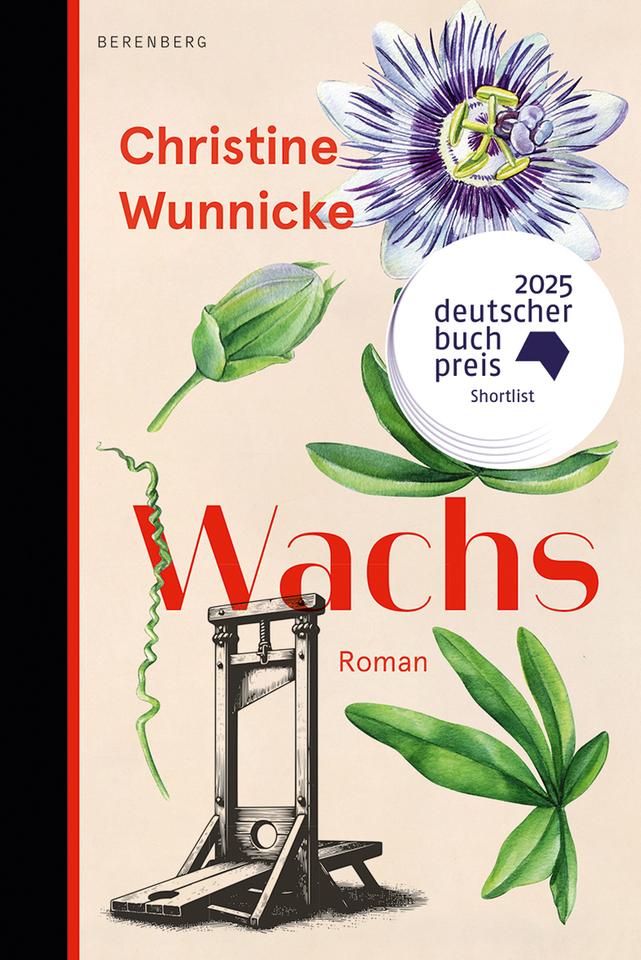
Die vielfach ausgezeichnete Autorin Christine Wunnicke erzählt von zwei Frauen, die im Paris des 18. Jahrhunderts zwischen Kunst und Wissenschaft ihren Weg suchen.© Berenberg Verlag
Im Grunde genommen ist es beim Lesen wie beim Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen See. So wie man vorsichtig einen Fuß auf das gefrorene Wasser setzt und schaut, ob das Eis auch trägt, prüfe ich, wenn ich ein Buch aufschlage und die erste Seite lese, ob ich auf festem Grund stehe.
Ich habe den Roman „Wachs“ von Christine Wunnicke im Frühjahr gelesen und sofort gespürt: Diese Autorin weiß, was sie tut.
Und dann ist das auch noch eine interessante Geschichte, die mir Christine Wunnicke in ihrem Roman erzählt. Es geht um die Liebe zweier Frauen im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Die eine ist Anatomin, seziert Leichen, obwohl man das als Frau zu der Zeit noch gar nicht darf. Und die andere? Sie zeichnet Blumenbilder für den französischen König aufs Papier. Ich wünsche mir, dass Christine Wunnicke in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis erhält, weil „Wachs“ ein literarisch herausragendes Buch ist. (Nora Karches)
Christine Wunnicke: "Wachs"
Berenberg Verlag, Berlin 2025
192 Seiten, 24 Euro.
Fiona Sironic: „Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft“
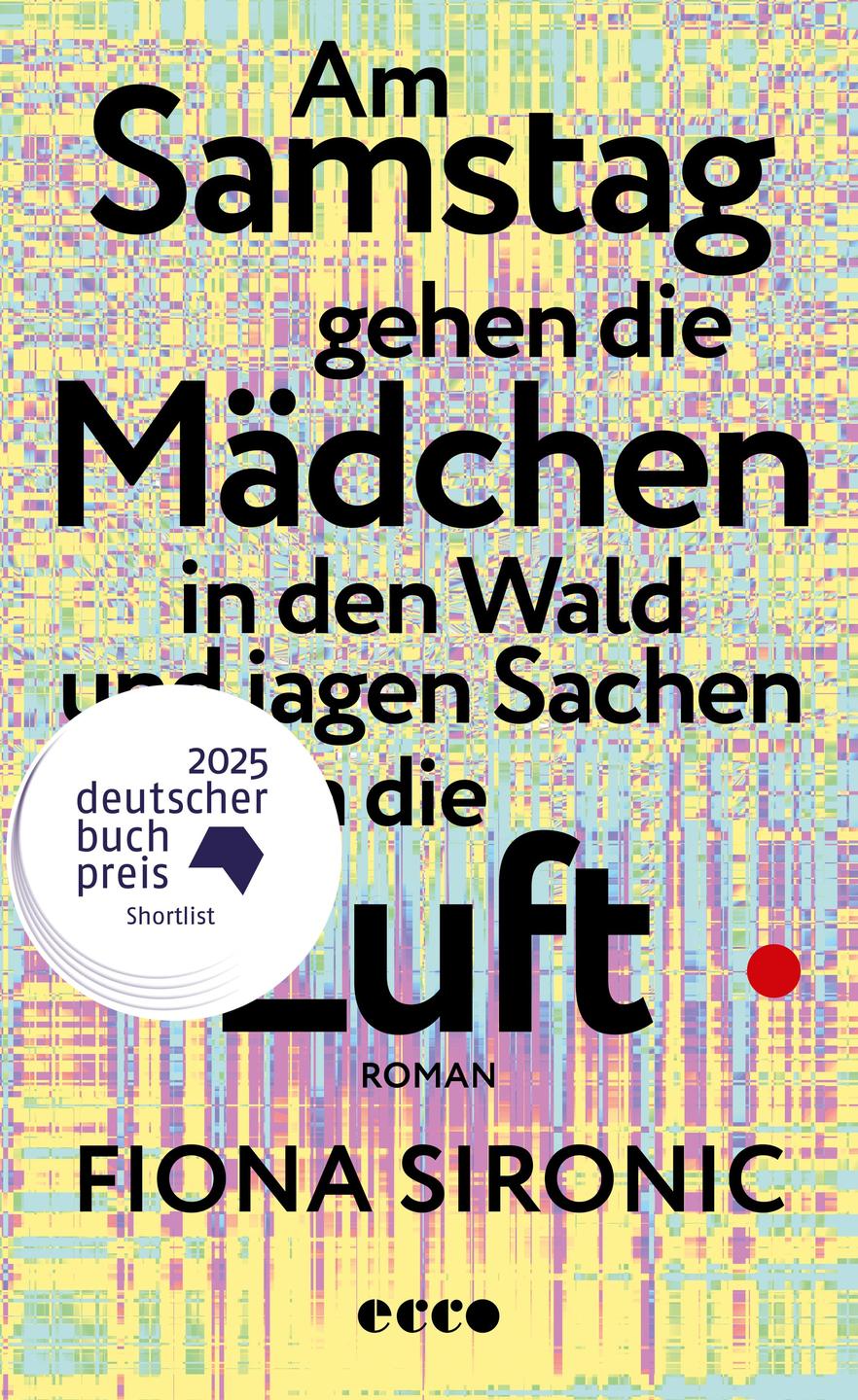
In Fiona Sironics Debüt trotzen Mädchen dem Untergang einer Welt. Ein Roman über Katastrophen und den Versuch, Hoffnung zu bewahren.© Ecco Verlag
Ich liebe das Feuerwerk an Lakonie, das dieses Buch zündet – und das geht gleich am Anfang los: Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Pappbecher, Aludosen, Plastikflaschen. Die Luft ist warm, der Wald voller Kiefern – ist das nicht fantastisch? Knapp und cool gemacht.
Ganz hervorragend finde ich auch, dass dieser Roman die Katastrophen, von denen er erzählt, weder bejault noch bejammert und schon gar nicht pädagogisiert, sondern sie wie nebenbei aufzeichnet – und einem damit gerade unter die Haut geht.
Die Katastrophen, das sind die Exzesse der digitalen Revolution, der Klimawandel und das Artensterben. Und das notiert die Erzählerin Ära ganz still, am Beispiel der Vögel: Heute ist die letzte Turteltaube gestorben, heute die letzte Feldlerche, der letzte Buntspecht, die letzte Dohle und immer so weiter. Das schnürt einem den Hals zu. Das ist die Zukunft.
Fiona Sironic holt aber noch sehr viel mehr Zeitreihen in ihren Roman, weil sie ihre Geschichte ganz gekonnt einbettet in den großen Strom der Erdgeschichte, in Massenaussterbe-Ereignisse vor hundert Millionen Jahren.
Und es gibt keine männlichen Menschen in diesem Buch. Die Mädchen und Frauen, von denen Sironic erzählt, stemmen sich gegen die Verluste – manchmal solidarisch, manchmal gegeneinander. Aber sie serviert uns hier keine negative Idylle, sondern zeigt, wie brüchig und kämpferisch jede Form von Überleben ist.
Mir würde es sehr gefallen, wenn dieser mit so viel gefasster, kühler Wut erzählte Roman den Deutschen Buchpreis bekommen würde. (Frank Meyer)
Fiona Sironic: „Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft“
Ecco Verlag, Hamburg, 2025
208 Seiten, 23 Euro
Jehona Kicaj: „ë“
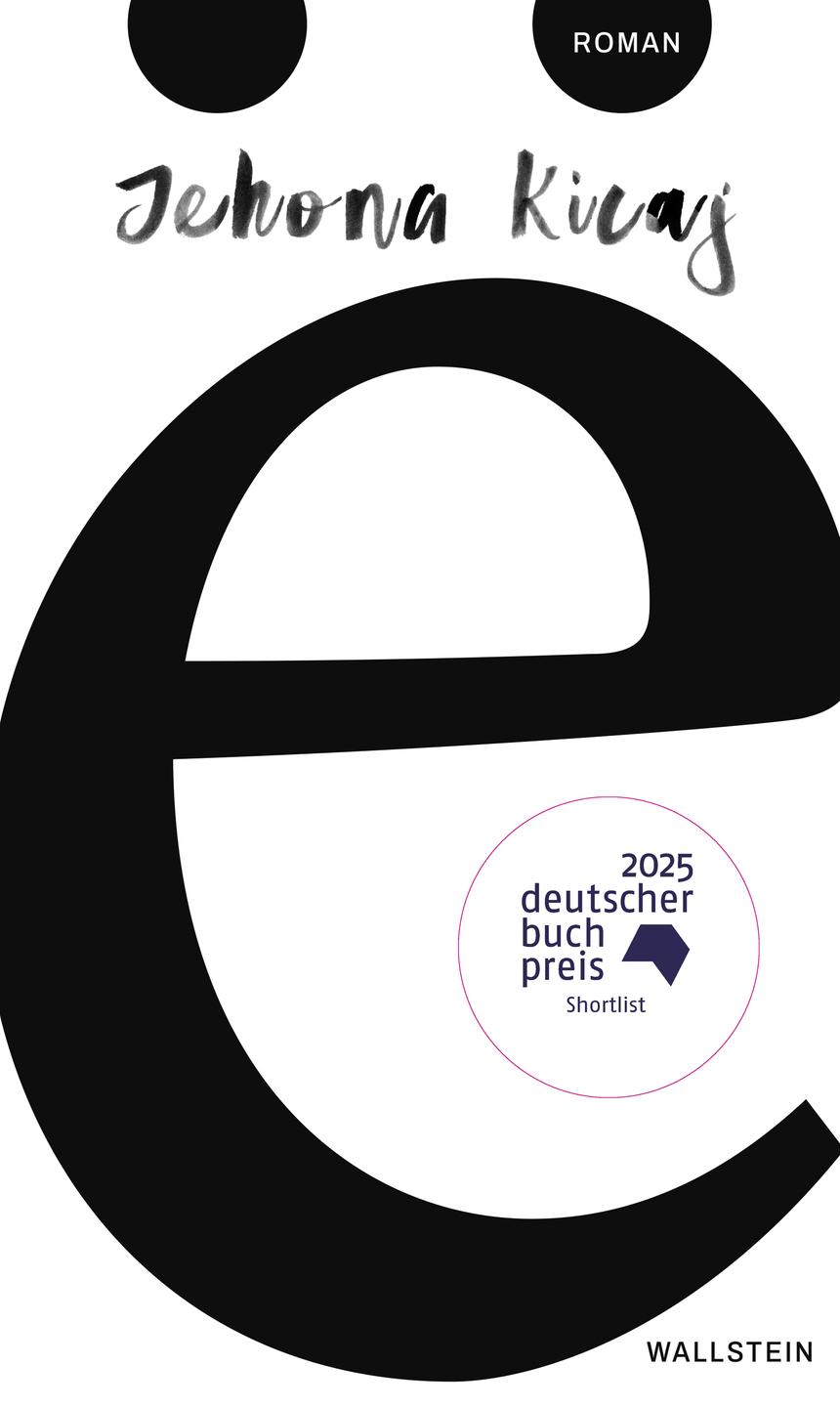
In ihrem Debüt beschreibt Jehona Kicaj das Aufwachsen zwischen Albanien und Deutschland, zwischen zwei Sprachen und Welten.© Wallstein Verlag
Die junge namenlose Studentin in Jehonas Kicajs Debütroman „ë“ hat das schwerwiegende Kieferleiden „Bruxismus“ – beim Knirschen schädigt sie ihren Zahnschmelz so stark, dass sie Gefahr läuft, irgendwann nicht mehr kauen und sprechen zu können, wie ihr Arzt erklärt.
Ihr Schmerz entpuppt sich als das körperliche Symptom einer tiefsitzenden Sprachlosigkeit: Bereits im Kosovo musste sie schweigen, wenn die Eltern mit ihr die serbische Grenze passierten; bloß kein Mucks Albanisch durfte aus dem Mund des Kindes kommen. In Deutschland lernt sie die neue Sprache anhand des Fernsehens.
Ausgehend von dem Mund ihrer Protagonistin geht Jehona Kicaj hinein in die Traumata der kosovarischen Gesellschaft. Auf verschiedenen Erzähl- wie Zeitebenen lässt sie ihre Protagonistin ihre Herkunft zusammensetzen: Der Krieg im Kosovo und ihr Aufwachsen und Leben in Deutschland, das durchzogen ist von der Ignoranz und dem Unwissen vieler Deutscher über ihr Herkunftsland, die Geschichte und den Krieg – kurz: über ihre gespaltene kulturelle Identität.
Ein hochpoetischer wie komplexer Text, in dessen Zentrum die Sprache selbst steht: So bruchstückhaft und brüchig die Knochen sind, die Jehona Kicaj seziert, so mühelos setzt sie diese sprachlich zusammen – die Sätze fließen und greifen in- und übereinander.
Der Roman steht für einen universellen Diskurs um Menschenrechte, Menschheitsverbrechen, Gewalt- wie Kriegserfahrungen und -traumata; und nicht zuletzt für die zersplitterten Identitäten von Menschen, die Unrechtssystemen, ihrer Gewalt und Unterdrückung ausgeliefert sind.
Jehona Kicaj erzählt von all dem ausgehend von einem kleinen Buchstaben einer (historisch) unterdrückten Sprache, und findet eine ganz eigene Sprache der Sichtbarkeit. Ein großes Stück Literatur, das eine vielschichtige Welt öffnet und erfahrbar macht. (Lara Sielmann)
Jehona Kicaj: „ë“
Wallstein Verlag, Göttingen
76 Seiten, 22,00 Euro
Thomas Melle: „Haus zur Sonne“
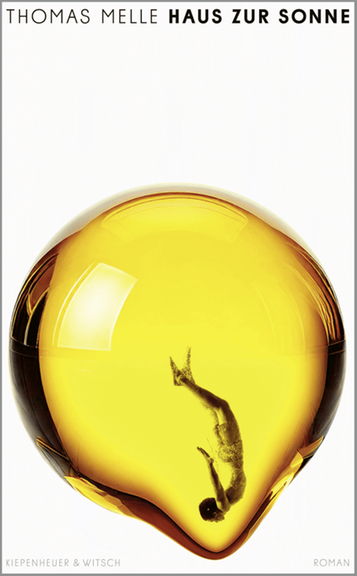
In „Haus zur Sonne“ blickt Thomas Melle in die Abgründe einer psychischen Erkrankung.© Verlag Kiepenheuer & Witsch
Mein Favorit auf den Deutschen Buchpreis ist Thomas Melles „Das Haus zur Sonne“. Dieses Buch ist der absolute Wahnsinn, weil es trotz des sehr hellen Titels mit der Sonne auf sehr finstere Weise die Dunkelheit poetisiert. Melle, der ja den Deutschen Buchpreis schon vor neun Jahren hätte bekommen sollen für sein aufregendes Manie-Stück „Die Welt im Rücken“, der sollte doch jetzt wenigstens für seinen Abschluss mit dem öffentlichkeitswirksamsten Literaturpreis dieses Landes geehrt werden.
Man kann kaum näher am Rand schreiben, also seine dystopische Geschichte über eine Selbstmordklinik, die konfrontiert uns mit einem der größten Rätsel der Philosophie überhaupt, nämlich mit dem Suizid.
Und dieses Buch fragt auch, ob man sich umbringen oder stattdessen vielleicht doch einen anderen Weg finden sollte und diesen anderen Weg findet der hochbegabte Melle. Sein Ausgang gegen die Selbstvernichtung ist das Schreiben, die Literatur.
Mit letzter Kraft stemmt sich dieser Text gegen den Wahnsinn auf eine Weise, die in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur beispiellos ist. Und das Beispiellose sollte ja im besten Falle ausgezeichnet werden als bester Roman des Jahres, also das, was heraussticht. Und Melle sticht heraus, und er sticht mit diesem Buch gleichzeitig auch in unser Herz, und er sticht in die Finsternis.
Und wer sich dieser Finsternis so sehr annähert wie Thomas Melle in das „Haus zur Sonne“, der sollte den Deutschen Buchpreis des Jahres 2025 unbedingt erhalten. (Jan Drees)
Thomas Melle: „Haus zur Sonne“
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2025
320 Seiten, 24 Euro
Dorothee Elmiger: „Die Holländerinnen“
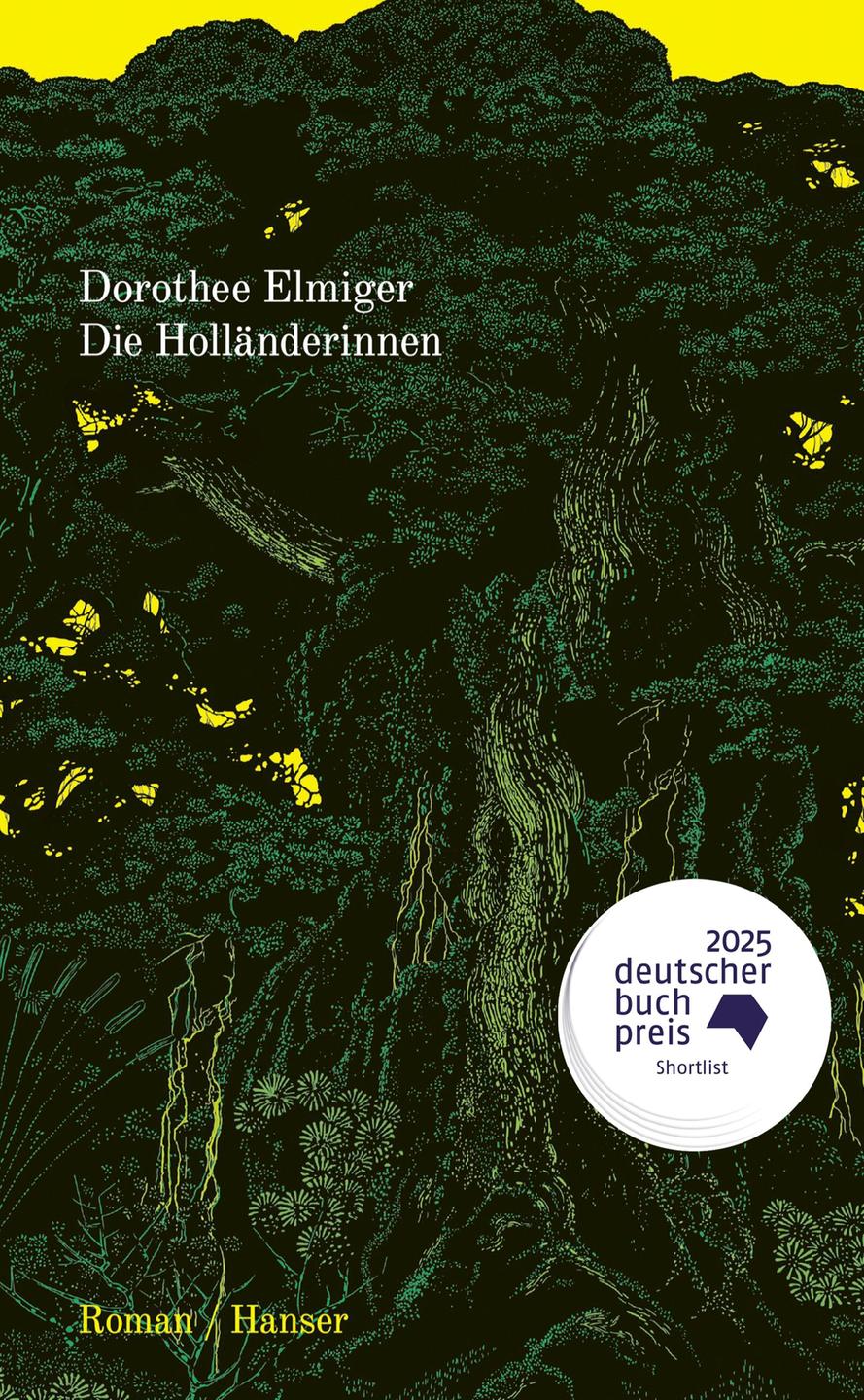
In „Die Holländerinnen“ rekonstruiert Dorothee Elmiger das Verschwinden zweier Frauen im Dschungel von Panama.© Hanser Verlag
Ich mag es beim Lesen ja am liebsten, wenn mich eine Geschichte so richtig reinzieht. Und das passiert oft, wenn es um etwas Abgründiges geht – wie bei einem guten Krimi. Dorothee Elmigers Buch bietet beides auf ganz besondere Weise, denn „Die Holländerinnen“ ist weder ein Krimi, noch lässt sich diese Geschichte so einfach zusammenfassen. Und auch das spricht ja unbedingt für ein Buch: wenn es mehr ist als nur sein Plot. Aber den gibt es natürlich auch.
Es geht um einen ungeklärten Vermisstenfall, um zwei Holländerinnen, die 2014 im Urwald von Panama verschwunden sind – und die trotz einer unglaublich aufwändigen Suchaktion nie wieder aufgetaucht sind. Diesen Fall will ein bekannter Theatermacher in den Tropen rekonstruieren. Er lädt die Erzählerin, eine bekannte Autorin, als Chronistin dazu ein, daran teilzunehmen.
Den Bericht, den sie zwei Jahre später vor einer Gruppe von Studierenden vorträgt, lesen wir: von dieser Reise, die immer tiefer in den Urwald führt, bei der die anderen Teilnehmer immer bizarrere Geschichten erzählen, in der es unzählige Bezüge zu Philosophie und Kulturgeschichte gibt und so ein immer dichteres Gespinst entsteht, fast ein Urwald aus Erzählungen, in den man regelrecht hineingezogen wird.
Und auf einmal ist dieses kurze Buch um. Es hat ja nur 160 Seiten und ich dachte: Man will es gleich noch einmal lesen, weil man eigentlich gar nicht genau verstanden hat, was einen da so fesselt. Und das merke ich auch, wenn ich das Buch jemandem ans Herz legen möchte: Es lässt sich nicht einfach nacherzählen. Man muss es den Leuten einfach in die Hand drücken und sagen: Lies das. Dieses Buch ist wirklich unglaublich. (Andrea Gerk)
Dorothee Elmiger: „Die Holländerinnen“
Hanser Verlag, München, 2025
160 Seiten, 23 Euro
ema