Der Taktstocktyrann
Der Biograph Eberhard Straub erstarrt nicht in Bewunderung. Mit bissiger Angriffslust porträtiert er Wilhelm Furtwängler. Er ist ein fragwürdiger Charakter. Furtwängler, der Machtmensch, der Womenizer, der selbstgerechte Egoist, der Nationalist, der geltungssüchtige Heuchler, der sich selbst überschätzende Komponist. Ja, und natürlich Furtwängler, der grandiose Interpret deutscher Musik, dem das Heldenschwere, Feierliche, Tragische gelingt wie keinem anderen. Nur nicht die leichte Muse.
Als junger Dirigent in der Schweiz hat er sich einmal an der Lustigen Witwe Franz Lehars vergangen.
"Der vergrübelte deutsche Jüngling brachte diese köstliche Nichtigkeit um all ihren Charme, indem er sie wie eine Affäre am Hof der Gibichungen in Wagners Worms behandelte. Lehar tobte über die 'sinfonische Ramasuri' eines gewissen 'Furtwendler'(!), eines Hallodri, der 'meine Witwe so sehr geschändet hat, dass sie bald in der Schweiz keiner mehr anschaut, und dass, wo man dort so gut zahlt.'"
Das Vergnügen des Autors beim Zergliedern doch sehr fadenscheinigen Heldenlebens, lässt nie nach. Selbst als der Taktstocktyrann glaubt, er könne mit dem Teufel persönlich Geschäfte machen und am Ende trotzdem heilig gesprochen werden, spürt Straub die Komik, die in der Tragik von Furtwänglers Größenwahn steckt. Im Stile Richard Wagners spottet er:
"Die Nationalsozialisten waren auch gerne bereit, Wilhelm Furtwängler, dem Walter des Wissens deutscher Weltenwonne, weithin Wirkungsmacht zu gewähren. Solange er nicht vergaß, dass sein 'Führer' wonnig seiner gedachte ..."
Nicht alles ist so gelungen in dieser Biographie.
Schon der Titel verspricht, was Straub nicht halten kann. Die Furtwänglers! Vielleicht weil die Großnichte des Dirigenten, der Fernsehstar Maria Furtwängler, heute der prominenteste Spross der Familie ist, lockt das Buch gleich mit der Geschichte der ganzen Familie. Über Maria ist aber mehr in der bunten Illustrierten ihres Gatten Hubert Burda zu erfahren. Einen bedeutenden Archäologen hat die Familie auch hervorgebracht, den Vater des Dirigenten. Er hätte in einer reinen Wilhelm-Furtwängler-Biographie ohnehin eine wichtige Rolle gespielt. Der Rest der Familie, knapp abgehandelt, wird nicht lebendig. Sie ist dennoch so etwas wie der Generalbass, über dem Straub das Leben des legendären Musikers erklingen lässt.
Es handelt sich also um eine fast reine Wilhelm-Furtwängler-Biographie. Zum falschen Titel verführt hat den Autor gewiss auch der Ehrgeiz, Furtwängler als Prototyp des deutschen Bildungsbürgers zu entschlüsseln. Er versteht die Lebensgeschichte des Künstlers und die seiner Familie als ein Kapitel deutscher Geistesgeschichte.
Dies ist durchaus ein fruchtbarer Ansatz. Denn Furtwänglers Bildungsbürgertum führte geradewegs ins politische Verhängnis. Mit religiöser Inbrunst verherrlichten die Bildungsbürger die Kunst. Als Inbegriff deutscher Kunst wiederum galt ihnen die Musik, in ihren Augen der Musik aller anderen Völker überlegen. Zu diesem sozusagen ästhetischen Nationalismus kam die irrige Ansicht, wer sich von Beethoven überwältigen lasse, könne kein Unhold sein.
Die kritische Auseinandersetzung mit dem Bildungsbürgertum ist ein lohnendes Thema. Straub steuert wichtige Aspekte bei. Noch überzeugender wäre ihm dies gelungen, hätte er nicht selbst bildungsbürgerliche Attitüden angenommen, durchaus nicht in parodistischer Absicht. Kaum eine Seite, auf der er den Leser nicht mit Goethe- oder Schiller-Zitaten belästigt. Auch wenn er sich in altbackener Zivilisationskritik ergeht und den Niedergang des Bildungsbürgers bedauert, unterlaufen ihm so pathetische Passagen, als habe Furtwängler persönlich die Feder geführt.
"In den eiskalten Wassern egoistischer Berechnung wurde alles hinweggespült, was dem Leben Glanz und Schönheit verliehen hatte und vom splendor veritatis, vom Glanz der Wahrheit kündete. ...(Der Markt) ersetzt in völlig verfremdeter Form die Gerechtigkeit vor Gott und seiner Wahrheit."
Zu dick aufgetragen! Zurück zu Furtwängler. Seine tönende Ethik ist keineswegs unpolitisch. Sie ist politisch, weil Furtwängler Ästhetik politisch versteht. So glaubt er, die deutsche Musik sei mehr als alles andere dazu berufen, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen zu stärken. Der Dirigent wird aber auch, wie Straub kühl konstatiert, ein "Opfer seiner Geltungssucht".
"Er wollte nicht nur musizieren, er wollte gestalten, führen, die Krise zwischen Volk und Kunst überwinden. Die Vorstellung von seiner nationalen Unentbehrlichkeit, seine politische Selbstüberschätzung, rückte ihn als Sympathisant des Nationalsozialismus unvermeidlich ins Zwielicht. Alle anderen Mitläufer wollten nur mitlaufen ... allein Furtwängler strebte als Mitläufer danach, im Nationalsozialismus mit Beethoven, Wagner und Brahms die innere Führung zu übernehmen. ... Wilhelm Furtwängler wurde zum Reichsschmuckwart."
Nach dem Krieg versuchte Furtwängler seine Nähe zum Nazi-Regime zu einem selbstlosen Akt der Demut zu verklären. Er habe seine Berliner Philharmoniker nicht im Stich lassen wollen. Für das hoch privilegierte Reiseorchester bestand allerdings niemals auch nur die geringste Gefahr. Furtwängler hat jüdischen Musikern geholfen, das ist wahr, aber ebenso wahr ist, dass er sich mit dem System zu seinem eigenen Nutzen arrangierte und sich in den Vorzimmern Goebbels, Görings und Hitlers tummelte.
Bei Goebbels protestierte er erfolgreich gegen seiner Meinung nach allzu euphorische Kritiken über den jungen Konkurrenten Herbert von Karajan. Die Zeitung wurde gerügt, Karajan nicht mehr engagiert. Hitler persönlich verdoppelte seine Abendgage an der Staatsoper auf für damalige Zeit exorbitante 4000 Reichsmark – zusätzlich zum Jahresgehalt als Operndirektor. Mit einem erheblichen Teil seiner Honorare finanzierte er wechselnde Liebschaften.
Seine von den Naziführern geduldeten Starallüren und Launen will Furtwängler später zu Widerständigkeit erklären. Der Emigrant Thomas Mann aber verspottete ihn wohl zu Recht als "Furchtwängler". Mit Lebenslügen und Selbsttäuschungen stilisierte er sich selbst zum Opfer unglücklicher Umstände.
Nach 1935 befand er sich übrigens überwiegend im Ausland, überall gefeiert, stets Botschafter deutschen Geistes und damit Kulturpropagandist des Reichs. Dieser "fleischgewordene Genius deutscher Musik" machte sich rechtzeitig aus dem Staub; er zog 1944 ins sichere Luzern. Auch daraus machte er nach dem Krieg eine heroische Legende. Er habe vor Himmlers Verfolgung fliehen müssen. Nichts freilich deutet darauf hin, dass er in Berlin in Ungnade gefallen war.
"Er dachte an sich, was ihm überhaupt nicht zu verargen ist. Fragwürdig sind allerdings seine von nun an kräftigen Bemühungen, alles was er tat, in fast metaphysische Zusammenhänge zu rücken und seine Mitarbeit als Widerstand zu deklarieren in Verantwortung für das ewige Deutschland, wie es sich in seiner unsterblichen Musik äußerte."
Groß geworden war Furtwängler in dem Bewusstsein, ein Genie zu sein, allerdings als Komponist. Ein Irrtum. Dirigent wurde er, weil er als Komponist kein Publikum fand. Seine Werke sind heute zu Recht vergessen.
Weltberühmt wurde er nicht allein seiner überragenden Könnerschaft wegen, sondern auch weil er überall präsent war, weil er, modern ausgedrückt, den internationalen Markt bediente und ihn beherrschte. In New York ebenso wie in Berlin und in Wien. Er war in Wien und in Berlin der Chef, was heute undenkbar wäre, und er verstand es, auch Salzburg seinem musikalischen Imperium einzugliedern. Anders formuliert: Furtwängler war einer der großen Profiteure des Anschlusses von Österreich, wofür er Hitler 1938 mit glühenden Worten dankte.
Die Berliner Philharmoniker waren keineswegs Furtwänglers Ein und Alles. Auch mit dieser Legende räumt das Buch auf. Die Wiener Philharmoniker schätzte er noch mehr. Insgesamt leistet Straub weit mehr als nur das Porträt einer so großartigen wie großspurigen, so blendenden wie verblendeten, so impertinent geschäfttüchtigen wie idealistischen Künstlerpersönlichkeit.
Es geht um Glanz und Elend des deutschen Geistes. Dafür ist Furtwängler exemplarisch.
Eberhard Straub: Die Furtwänglers - Geschichte einer deutschen Familie
Siedler Verlag, München 2007
"Der vergrübelte deutsche Jüngling brachte diese köstliche Nichtigkeit um all ihren Charme, indem er sie wie eine Affäre am Hof der Gibichungen in Wagners Worms behandelte. Lehar tobte über die 'sinfonische Ramasuri' eines gewissen 'Furtwendler'(!), eines Hallodri, der 'meine Witwe so sehr geschändet hat, dass sie bald in der Schweiz keiner mehr anschaut, und dass, wo man dort so gut zahlt.'"
Das Vergnügen des Autors beim Zergliedern doch sehr fadenscheinigen Heldenlebens, lässt nie nach. Selbst als der Taktstocktyrann glaubt, er könne mit dem Teufel persönlich Geschäfte machen und am Ende trotzdem heilig gesprochen werden, spürt Straub die Komik, die in der Tragik von Furtwänglers Größenwahn steckt. Im Stile Richard Wagners spottet er:
"Die Nationalsozialisten waren auch gerne bereit, Wilhelm Furtwängler, dem Walter des Wissens deutscher Weltenwonne, weithin Wirkungsmacht zu gewähren. Solange er nicht vergaß, dass sein 'Führer' wonnig seiner gedachte ..."
Nicht alles ist so gelungen in dieser Biographie.
Schon der Titel verspricht, was Straub nicht halten kann. Die Furtwänglers! Vielleicht weil die Großnichte des Dirigenten, der Fernsehstar Maria Furtwängler, heute der prominenteste Spross der Familie ist, lockt das Buch gleich mit der Geschichte der ganzen Familie. Über Maria ist aber mehr in der bunten Illustrierten ihres Gatten Hubert Burda zu erfahren. Einen bedeutenden Archäologen hat die Familie auch hervorgebracht, den Vater des Dirigenten. Er hätte in einer reinen Wilhelm-Furtwängler-Biographie ohnehin eine wichtige Rolle gespielt. Der Rest der Familie, knapp abgehandelt, wird nicht lebendig. Sie ist dennoch so etwas wie der Generalbass, über dem Straub das Leben des legendären Musikers erklingen lässt.
Es handelt sich also um eine fast reine Wilhelm-Furtwängler-Biographie. Zum falschen Titel verführt hat den Autor gewiss auch der Ehrgeiz, Furtwängler als Prototyp des deutschen Bildungsbürgers zu entschlüsseln. Er versteht die Lebensgeschichte des Künstlers und die seiner Familie als ein Kapitel deutscher Geistesgeschichte.
Dies ist durchaus ein fruchtbarer Ansatz. Denn Furtwänglers Bildungsbürgertum führte geradewegs ins politische Verhängnis. Mit religiöser Inbrunst verherrlichten die Bildungsbürger die Kunst. Als Inbegriff deutscher Kunst wiederum galt ihnen die Musik, in ihren Augen der Musik aller anderen Völker überlegen. Zu diesem sozusagen ästhetischen Nationalismus kam die irrige Ansicht, wer sich von Beethoven überwältigen lasse, könne kein Unhold sein.
Die kritische Auseinandersetzung mit dem Bildungsbürgertum ist ein lohnendes Thema. Straub steuert wichtige Aspekte bei. Noch überzeugender wäre ihm dies gelungen, hätte er nicht selbst bildungsbürgerliche Attitüden angenommen, durchaus nicht in parodistischer Absicht. Kaum eine Seite, auf der er den Leser nicht mit Goethe- oder Schiller-Zitaten belästigt. Auch wenn er sich in altbackener Zivilisationskritik ergeht und den Niedergang des Bildungsbürgers bedauert, unterlaufen ihm so pathetische Passagen, als habe Furtwängler persönlich die Feder geführt.
"In den eiskalten Wassern egoistischer Berechnung wurde alles hinweggespült, was dem Leben Glanz und Schönheit verliehen hatte und vom splendor veritatis, vom Glanz der Wahrheit kündete. ...(Der Markt) ersetzt in völlig verfremdeter Form die Gerechtigkeit vor Gott und seiner Wahrheit."
Zu dick aufgetragen! Zurück zu Furtwängler. Seine tönende Ethik ist keineswegs unpolitisch. Sie ist politisch, weil Furtwängler Ästhetik politisch versteht. So glaubt er, die deutsche Musik sei mehr als alles andere dazu berufen, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen zu stärken. Der Dirigent wird aber auch, wie Straub kühl konstatiert, ein "Opfer seiner Geltungssucht".
"Er wollte nicht nur musizieren, er wollte gestalten, führen, die Krise zwischen Volk und Kunst überwinden. Die Vorstellung von seiner nationalen Unentbehrlichkeit, seine politische Selbstüberschätzung, rückte ihn als Sympathisant des Nationalsozialismus unvermeidlich ins Zwielicht. Alle anderen Mitläufer wollten nur mitlaufen ... allein Furtwängler strebte als Mitläufer danach, im Nationalsozialismus mit Beethoven, Wagner und Brahms die innere Führung zu übernehmen. ... Wilhelm Furtwängler wurde zum Reichsschmuckwart."
Nach dem Krieg versuchte Furtwängler seine Nähe zum Nazi-Regime zu einem selbstlosen Akt der Demut zu verklären. Er habe seine Berliner Philharmoniker nicht im Stich lassen wollen. Für das hoch privilegierte Reiseorchester bestand allerdings niemals auch nur die geringste Gefahr. Furtwängler hat jüdischen Musikern geholfen, das ist wahr, aber ebenso wahr ist, dass er sich mit dem System zu seinem eigenen Nutzen arrangierte und sich in den Vorzimmern Goebbels, Görings und Hitlers tummelte.
Bei Goebbels protestierte er erfolgreich gegen seiner Meinung nach allzu euphorische Kritiken über den jungen Konkurrenten Herbert von Karajan. Die Zeitung wurde gerügt, Karajan nicht mehr engagiert. Hitler persönlich verdoppelte seine Abendgage an der Staatsoper auf für damalige Zeit exorbitante 4000 Reichsmark – zusätzlich zum Jahresgehalt als Operndirektor. Mit einem erheblichen Teil seiner Honorare finanzierte er wechselnde Liebschaften.
Seine von den Naziführern geduldeten Starallüren und Launen will Furtwängler später zu Widerständigkeit erklären. Der Emigrant Thomas Mann aber verspottete ihn wohl zu Recht als "Furchtwängler". Mit Lebenslügen und Selbsttäuschungen stilisierte er sich selbst zum Opfer unglücklicher Umstände.
Nach 1935 befand er sich übrigens überwiegend im Ausland, überall gefeiert, stets Botschafter deutschen Geistes und damit Kulturpropagandist des Reichs. Dieser "fleischgewordene Genius deutscher Musik" machte sich rechtzeitig aus dem Staub; er zog 1944 ins sichere Luzern. Auch daraus machte er nach dem Krieg eine heroische Legende. Er habe vor Himmlers Verfolgung fliehen müssen. Nichts freilich deutet darauf hin, dass er in Berlin in Ungnade gefallen war.
"Er dachte an sich, was ihm überhaupt nicht zu verargen ist. Fragwürdig sind allerdings seine von nun an kräftigen Bemühungen, alles was er tat, in fast metaphysische Zusammenhänge zu rücken und seine Mitarbeit als Widerstand zu deklarieren in Verantwortung für das ewige Deutschland, wie es sich in seiner unsterblichen Musik äußerte."
Groß geworden war Furtwängler in dem Bewusstsein, ein Genie zu sein, allerdings als Komponist. Ein Irrtum. Dirigent wurde er, weil er als Komponist kein Publikum fand. Seine Werke sind heute zu Recht vergessen.
Weltberühmt wurde er nicht allein seiner überragenden Könnerschaft wegen, sondern auch weil er überall präsent war, weil er, modern ausgedrückt, den internationalen Markt bediente und ihn beherrschte. In New York ebenso wie in Berlin und in Wien. Er war in Wien und in Berlin der Chef, was heute undenkbar wäre, und er verstand es, auch Salzburg seinem musikalischen Imperium einzugliedern. Anders formuliert: Furtwängler war einer der großen Profiteure des Anschlusses von Österreich, wofür er Hitler 1938 mit glühenden Worten dankte.
Die Berliner Philharmoniker waren keineswegs Furtwänglers Ein und Alles. Auch mit dieser Legende räumt das Buch auf. Die Wiener Philharmoniker schätzte er noch mehr. Insgesamt leistet Straub weit mehr als nur das Porträt einer so großartigen wie großspurigen, so blendenden wie verblendeten, so impertinent geschäfttüchtigen wie idealistischen Künstlerpersönlichkeit.
Es geht um Glanz und Elend des deutschen Geistes. Dafür ist Furtwängler exemplarisch.
Eberhard Straub: Die Furtwänglers - Geschichte einer deutschen Familie
Siedler Verlag, München 2007
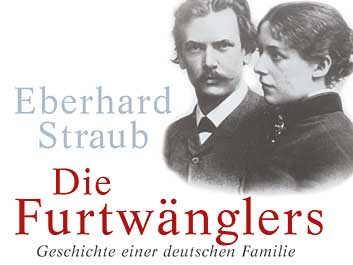
Eberhard Straub: "Die Furtwänglers"© Siedler Verlag