Der sprachgewaltige Einmischer
Günter Grass hat sich nie gescheut, seinen schriftstellerischen Ruhm öffentlich zu nutzen und in aktuellen politischen Debatten Stellung zu beziehen. In den Feuilletons ist er dadurch zu einem unerschöpflichen Quell der Auseinandersetzung geworden, der Hass des konservativen Deutschlands hat ihn über Jahrzehnte verfolgt. Der Journalist und Literaturwissenschaftler Harro Zimmermann zeichnet in seinem Buch "Günter Grass unter den Deutschen" ein schwieriges Verhältnis nach.
Ein Großschriftsteller ist er. Seine Prosawerke erreichen Millionenauflagen und sie werden in nahezu alle Kultursprachen unserer Zeit übersetzt. Längst bevor er im Jahr 1999 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird, zählt sein Werk zu dem, was wir mit dem Begriff Weltliteratur zu belegen pflegen. In den germanistischen Seminaren wird er als Klassiker der Moderne gefeiert. Er schreibt aber nicht nur Gedichte, Theaterstücke und Romane, sondern tritt auch als überaus erfolgreicher Maler, Graphiker und Bildhauer auf. Aber auch dies gilt: Die Geschichte der alten Bundesrepublik hat der Wort-Bild-Künstler Günter Grass mitgeprägt wie kein anderer unter den deutschsprachigen Autoren, die nach 1945 ihre künstlerische Laufbahn begannen.
Die ausländische Kritik feiert ihn spätestens seit dem Sensationserfolg seines 1959 erschienenen ersten Romans "Die Blechtrommel" enthusiastisch. Kaum einen europäischen Literaturpreis gibt es, mit dem er im Laufe seines Lebens nicht geehrt wurde. Der Nobelpreis ist da nur der triumphale Höhepunkt einer beispiellosen internationalen Künstlerkarriere. Auch die deutschen Preisrichter konnten ihn nicht übersehen, verliehen ihm das Beste, was sie zu vergeben haben: den Büchner- und Fontanepreis beispielsweise oder den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Keinen deutschen Gegenwartsschriftsteller, hat der Ruhm so mächtig erreicht wie ihn.
Die deutschen Feuilletons und die konservativen Geister im Lande ficht das seit Jahr und Tag wenig an. Seit der kurzwüchsige Trommler Oscar das Licht der Literaturwelt erblickt hat, rumort es in den Zeitungsspalten oder in den Hinterzimmern der politischen Eliten. Wann immer sein Schöpfer von nun an ein neues Werk vorlegen wird, gerät die Zunft der Kritiker in gewaltige Aufregung. Es hagelt in der Regel aggressive Verrisse, und persönliche Beschimpfungen treten an die Stelle künstlerischer Bewertungen. "Nestbeschmutzer" ist er für die einen, "Pornographie" schreibt er für die anderen. Der selbstsichere und in seinen öffentlichen Auftritten alles andere als schüchterne Autor schenkt seinen Gegnern allerdings ebenfalls nichts.
Warum das alles so gekommen ist, warum Deutschlands berühmtester und erfolgreichster Schriftsteller in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für die Feuilletons zu einem solch unerschöpflichen Quell der Auseinandersetzung geworden ist, warum ihn der Hass des konservativen Deutschland über Jahrzehnte hinweg verfolgt hat, das lässt sich in der bemerkenswerten "Chronik eines Verhältnisses" nachlesen, die der Journalist und Literaturwissenschaftler Harro Zimmermann jetzt vorgelegt hat. "Günter Grass unter den Deutschen" nennt er sein Buch und dieser Titel beschreibt die Lage ziemlich genau. Mit dem keinen öffentlichen Auftritt scheuenden, kein umstrittenes Thema unbesprochen lassenden Günter Grass ist da wohl tatsächlich ein unabhängiger, polemischer und aufgeklärter Geist unter die Deutschen gefahren, der sie – jedenfalls zeigen das ihre Reaktionen auf diesen sprachgewaltigen Einmischer - ganz offensichtlich das Fürchten gelehrt hat. Wobei es nicht die Deutschen in ihrer Gesamtheit sind, die sich da zu permanenten Gesten des Abscheus hinreißen lassen, wie Zimmermann zu recht anmerkt.
"Wenn es zutrifft, dass der Intellektuelle um seiner öffentlichen Wirkung willen so etwas wie eine Aura besitzen muss, dann ist Günter Grass in besonderer Weise damit ausgestattet. Die Beharrlichkeit und die Wirkung seines jahrzehntelangen Dreinredens machen deutlich, dass die Leistungen dieses Dichters und Denkers vom großen Publikum der Deutschen seit je anders und womöglich wohlwollender wahrgenommen werden als von der jeweils stimmführenden Kulturpublizistik."
Nur so ist es ja erklärbar, dass die Bücher von Günter Grass auch bei seinen Landsleuten auf massenhafte Konsumlust stoßen, während einer ihrer Kulturpäpste einen Grass-Roman auf dem Titelbild eines Hamburger Nachrichtenmagazins wütend zerreißt. Grass, auch das macht Zimmermanns Buch deutlich, hat die deutsche Gesellschaft, vor allem ihre politischen Eliten, permanent herausgefordert. Nie hat er sich gescheut, seinen schriftstellerischen Ruhm öffentlich zu nutzen, um auf Fehlentwicklungen – oder was er dafür ansah - in der Bundesrepublik hinzuweisen. In den fünfziger Jahren wehrt er sich gegen die Ausblendung von Auschwitz in der Wahrnehmung des Adenauer-Staates; in den sechziger Jahren kämpft er für einen sozialdemokratischen Machtwechsel; in den siebziger Jahren gilt sein Eintreten der Entspannungs- und Ostpolitik Willy Brandts; in den achtziger Jahren streitet er an der Seite der Friedensbewegung gegen die Raketenrüstung der Supermächte und geißelt die globale Umweltzerstörung; in den neunziger Jahren wird die von ihm kritisch gesehene Wiedervereinigung zu einem seiner zentralen öffentlichen Themen. Vieles mehr empört ihn: Strauß und die christdemokratischen Atombegehrlichkeiten, die Radikalisierung der 68er-Bewegung, das Geschehen im Prager Frühling oder das polnische Kriegsrecht, die Asylpolitik der Bundesregierungen oder der heuchlerische Umgang mit den Stasiakten. Er macht Wahlkampf für die SPD, wird Parteimitglied und gibt das Parteibuch einige Jahre später wütend zurück. Als Berliner Akademiepräsident wirbelt er den Altherrenverein durcheinander, tritt aus, als man sich in Sachen Salman Rushdie – Irans Ayatolla Khomeini hatte den Dichter der "Satanischen Verse" für vogelfrei erklärt - dort allzu bedeckt hält. Zahllose, häufig monatelange Reisen, zahllose Vorträge, zahllose und überaus erfolgreiche Lesungen, zahllose Fernseh- und Radioauftritte. Grass nimmt das demokratische Angebot ernst, mischt sich als Citoyen ein in die öffentlichen Belange. Seine Lehrmeister sind nicht nur die deutschen Aufklärer Kant und Lessing, sondern auch die von ihm überaus geschätzten französischen Zeitgenossen Camus und Sartre. Er ist nicht gefeit vor Irrtümern, aber er nimmt sich das Recht der freien Meinungsäußerung. Was ihm nicht nur die Feuilletons, die dieses Engagement hämisch als Besserwisserei hinstellen, übel nehmen. Zimmermanns Buch bietet eine Fülle entsprechender Zitate aus deutschen Zeitungen und Zeitschriften. Ein Beispiel, die Springers Tageszeitung "Die Welt" entnommen ist, sei angeführt.
"Auf dem Schirm ist eine Talk-Runde mit sich selbst beschäftigt, und das Wort führt, wie könnte es anders sein, Günter Grass. Alles an ihm macht Angst: die wie Schrotladungen hervorgestoßenen Unheilssätze, der drohend gesträubte Schnurrbart, die kompromisslos zornigen Augen über den halben Brillengläsern. Fehlt nur noch der Rohrstock."
Ein rastloses Leben ist es, und es bleibt ein Rätsel, wie in diesem Wirbel das künstlerische Werke systematisch wachsen konnte. In ihm aber werden auf künstlerische, literarische Weise die zahllosen Fragen thematisiert, die den homo politicus Günter Grass in seinen öffentlichen Auftritten nicht ruhen und rasten lassen. Nur einige wenige Beispiele: Die Schrecken der NS-Zeit in seinen Danziger Romanen. Die bundesrepublikanische Gegenwart in "Örtliche betäubt" oder im "Tagebuch einer Schnecke". Das Weltende als Folge der Naturzerstörung in der "Rättin". Die Wiedervereinigung von 1989/90 im Spiegel des letzten deutschen Jahrhunderts in "Ein weites Feld". Das deutsche Flüchtlingsdrama des Winters von 1945 in "Im Krebsgang". Jede Neuerscheinung wird zum Medienereignis, von Verlag und Autor nicht ohne Marketing-Geschick inszeniert und von der Kritik allzu häufig mit ihren hassvollen Gesängen begleitet. Heinrich Böll, der andere große deutsche Nachkriegsautor, ist an den ideologischen Verrissen, die wenig mit seinen Romanen, aber viel mit seinem gesellschaftlichen Engagement zu tun hatten, am Ende zerbrochen. Grass, darauf weist Zimmermann mehrfach hin, weicht nicht zurück.
"In seiner Münchner Dankesrede für den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der schönen Künste im Mai 1994 … sagt Grass…: Die 'Anmaßung' herrsche vor in der Bundesrepublik, das Sekundäre des Kulturbetriebs schiebe sich auftrumpfend vor die Literatur und die Kunst, es feiere sich permanent selbst, obgleich es parasitär vom Primären lebt. Der Schriftsteller sei der Arbeitgeber des Kritikers: ohne ihn gäbe es die Kritik nicht, ohne sein vorliegendes Werk müssten sie sich selbst zerfleischen; arbeitslose Sozialfälle wären sie ohne den Schriftsteller, der sie in Lohne und Brot hält, indem er ihnen wiederholt Gelegenheit bietet, an den Früchten seiner Arbeit zu partizipieren, er nährt sie."
Man ahnt, wie solche Sätze den Nerv der Kritikerkaste treffen.
Zimmermanns "Chronik eines Verhältnisse" lässt den Leser darüber rätseln, wie Grass diesen nun schon fünfzig Jahre währenden öffentlichen Kampf mit der Mehrzahl der Feuilletons und den politischen Gegnern durchhalten konnte. Es ist wohl das Glück des künstlerischen Talents, der ins unbeschreibliche wachsende Ruhm und der durch das Schreiben erworbene Reichtum, der ihn auch materiell unabhängig werden ließ, was ihn so stark macht. Häufig sitzt er zwischen allen Stühlen und Resignation blieb ihm in diesen Jahrzehnten nicht fremd.
Immer ist Günter Grass der skeptische Aufklärer geblieben. Nie hat er den ungeheuerlichen Zivilisationsbruch vergessen können, der sich mit dem Namen Auschwitz verbindet. Viele seiner Leser, die sich am Werk dieses barocken Erzählkünstlers begeisterten, haben gerade dies an ihm respektiert.
"Erschrecktes Innehalten vor der Wirklichkeit, das Arbeitsprinzip des jungen Künstlers Grass war von Anbeginn mehr als ein bloß ästhetisches Bekenntnis. Es trat zugleich als inszenierte Imago, als Selbststilisierung eines Nonkonformisten in Erscheinung, der Kunst und Welt, Artistik und Engagement – nach den Vorbildern Camus und Sartre und belehrt durch die deutsche Unheilsgeschichte - in desillusionierende Spannung zueinander setzen wollte."
Zimmermanns Buch belegt diese Spannung, die das Leben des Künstlers und des Bürgers Grass beherrscht, eindrucksvoll. Unverzichtbar ist es für Grass-Leser und nachdenkliche Grass-Gegner. Zudem gelingt es Zimmermann einen wichtigen Teil der bundesrepublikanischen Kulturgeschichte nachzuzeichnen.
Die ausländische Kritik feiert ihn spätestens seit dem Sensationserfolg seines 1959 erschienenen ersten Romans "Die Blechtrommel" enthusiastisch. Kaum einen europäischen Literaturpreis gibt es, mit dem er im Laufe seines Lebens nicht geehrt wurde. Der Nobelpreis ist da nur der triumphale Höhepunkt einer beispiellosen internationalen Künstlerkarriere. Auch die deutschen Preisrichter konnten ihn nicht übersehen, verliehen ihm das Beste, was sie zu vergeben haben: den Büchner- und Fontanepreis beispielsweise oder den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Keinen deutschen Gegenwartsschriftsteller, hat der Ruhm so mächtig erreicht wie ihn.
Die deutschen Feuilletons und die konservativen Geister im Lande ficht das seit Jahr und Tag wenig an. Seit der kurzwüchsige Trommler Oscar das Licht der Literaturwelt erblickt hat, rumort es in den Zeitungsspalten oder in den Hinterzimmern der politischen Eliten. Wann immer sein Schöpfer von nun an ein neues Werk vorlegen wird, gerät die Zunft der Kritiker in gewaltige Aufregung. Es hagelt in der Regel aggressive Verrisse, und persönliche Beschimpfungen treten an die Stelle künstlerischer Bewertungen. "Nestbeschmutzer" ist er für die einen, "Pornographie" schreibt er für die anderen. Der selbstsichere und in seinen öffentlichen Auftritten alles andere als schüchterne Autor schenkt seinen Gegnern allerdings ebenfalls nichts.
Warum das alles so gekommen ist, warum Deutschlands berühmtester und erfolgreichster Schriftsteller in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für die Feuilletons zu einem solch unerschöpflichen Quell der Auseinandersetzung geworden ist, warum ihn der Hass des konservativen Deutschland über Jahrzehnte hinweg verfolgt hat, das lässt sich in der bemerkenswerten "Chronik eines Verhältnisses" nachlesen, die der Journalist und Literaturwissenschaftler Harro Zimmermann jetzt vorgelegt hat. "Günter Grass unter den Deutschen" nennt er sein Buch und dieser Titel beschreibt die Lage ziemlich genau. Mit dem keinen öffentlichen Auftritt scheuenden, kein umstrittenes Thema unbesprochen lassenden Günter Grass ist da wohl tatsächlich ein unabhängiger, polemischer und aufgeklärter Geist unter die Deutschen gefahren, der sie – jedenfalls zeigen das ihre Reaktionen auf diesen sprachgewaltigen Einmischer - ganz offensichtlich das Fürchten gelehrt hat. Wobei es nicht die Deutschen in ihrer Gesamtheit sind, die sich da zu permanenten Gesten des Abscheus hinreißen lassen, wie Zimmermann zu recht anmerkt.
"Wenn es zutrifft, dass der Intellektuelle um seiner öffentlichen Wirkung willen so etwas wie eine Aura besitzen muss, dann ist Günter Grass in besonderer Weise damit ausgestattet. Die Beharrlichkeit und die Wirkung seines jahrzehntelangen Dreinredens machen deutlich, dass die Leistungen dieses Dichters und Denkers vom großen Publikum der Deutschen seit je anders und womöglich wohlwollender wahrgenommen werden als von der jeweils stimmführenden Kulturpublizistik."
Nur so ist es ja erklärbar, dass die Bücher von Günter Grass auch bei seinen Landsleuten auf massenhafte Konsumlust stoßen, während einer ihrer Kulturpäpste einen Grass-Roman auf dem Titelbild eines Hamburger Nachrichtenmagazins wütend zerreißt. Grass, auch das macht Zimmermanns Buch deutlich, hat die deutsche Gesellschaft, vor allem ihre politischen Eliten, permanent herausgefordert. Nie hat er sich gescheut, seinen schriftstellerischen Ruhm öffentlich zu nutzen, um auf Fehlentwicklungen – oder was er dafür ansah - in der Bundesrepublik hinzuweisen. In den fünfziger Jahren wehrt er sich gegen die Ausblendung von Auschwitz in der Wahrnehmung des Adenauer-Staates; in den sechziger Jahren kämpft er für einen sozialdemokratischen Machtwechsel; in den siebziger Jahren gilt sein Eintreten der Entspannungs- und Ostpolitik Willy Brandts; in den achtziger Jahren streitet er an der Seite der Friedensbewegung gegen die Raketenrüstung der Supermächte und geißelt die globale Umweltzerstörung; in den neunziger Jahren wird die von ihm kritisch gesehene Wiedervereinigung zu einem seiner zentralen öffentlichen Themen. Vieles mehr empört ihn: Strauß und die christdemokratischen Atombegehrlichkeiten, die Radikalisierung der 68er-Bewegung, das Geschehen im Prager Frühling oder das polnische Kriegsrecht, die Asylpolitik der Bundesregierungen oder der heuchlerische Umgang mit den Stasiakten. Er macht Wahlkampf für die SPD, wird Parteimitglied und gibt das Parteibuch einige Jahre später wütend zurück. Als Berliner Akademiepräsident wirbelt er den Altherrenverein durcheinander, tritt aus, als man sich in Sachen Salman Rushdie – Irans Ayatolla Khomeini hatte den Dichter der "Satanischen Verse" für vogelfrei erklärt - dort allzu bedeckt hält. Zahllose, häufig monatelange Reisen, zahllose Vorträge, zahllose und überaus erfolgreiche Lesungen, zahllose Fernseh- und Radioauftritte. Grass nimmt das demokratische Angebot ernst, mischt sich als Citoyen ein in die öffentlichen Belange. Seine Lehrmeister sind nicht nur die deutschen Aufklärer Kant und Lessing, sondern auch die von ihm überaus geschätzten französischen Zeitgenossen Camus und Sartre. Er ist nicht gefeit vor Irrtümern, aber er nimmt sich das Recht der freien Meinungsäußerung. Was ihm nicht nur die Feuilletons, die dieses Engagement hämisch als Besserwisserei hinstellen, übel nehmen. Zimmermanns Buch bietet eine Fülle entsprechender Zitate aus deutschen Zeitungen und Zeitschriften. Ein Beispiel, die Springers Tageszeitung "Die Welt" entnommen ist, sei angeführt.
"Auf dem Schirm ist eine Talk-Runde mit sich selbst beschäftigt, und das Wort führt, wie könnte es anders sein, Günter Grass. Alles an ihm macht Angst: die wie Schrotladungen hervorgestoßenen Unheilssätze, der drohend gesträubte Schnurrbart, die kompromisslos zornigen Augen über den halben Brillengläsern. Fehlt nur noch der Rohrstock."
Ein rastloses Leben ist es, und es bleibt ein Rätsel, wie in diesem Wirbel das künstlerische Werke systematisch wachsen konnte. In ihm aber werden auf künstlerische, literarische Weise die zahllosen Fragen thematisiert, die den homo politicus Günter Grass in seinen öffentlichen Auftritten nicht ruhen und rasten lassen. Nur einige wenige Beispiele: Die Schrecken der NS-Zeit in seinen Danziger Romanen. Die bundesrepublikanische Gegenwart in "Örtliche betäubt" oder im "Tagebuch einer Schnecke". Das Weltende als Folge der Naturzerstörung in der "Rättin". Die Wiedervereinigung von 1989/90 im Spiegel des letzten deutschen Jahrhunderts in "Ein weites Feld". Das deutsche Flüchtlingsdrama des Winters von 1945 in "Im Krebsgang". Jede Neuerscheinung wird zum Medienereignis, von Verlag und Autor nicht ohne Marketing-Geschick inszeniert und von der Kritik allzu häufig mit ihren hassvollen Gesängen begleitet. Heinrich Böll, der andere große deutsche Nachkriegsautor, ist an den ideologischen Verrissen, die wenig mit seinen Romanen, aber viel mit seinem gesellschaftlichen Engagement zu tun hatten, am Ende zerbrochen. Grass, darauf weist Zimmermann mehrfach hin, weicht nicht zurück.
"In seiner Münchner Dankesrede für den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der schönen Künste im Mai 1994 … sagt Grass…: Die 'Anmaßung' herrsche vor in der Bundesrepublik, das Sekundäre des Kulturbetriebs schiebe sich auftrumpfend vor die Literatur und die Kunst, es feiere sich permanent selbst, obgleich es parasitär vom Primären lebt. Der Schriftsteller sei der Arbeitgeber des Kritikers: ohne ihn gäbe es die Kritik nicht, ohne sein vorliegendes Werk müssten sie sich selbst zerfleischen; arbeitslose Sozialfälle wären sie ohne den Schriftsteller, der sie in Lohne und Brot hält, indem er ihnen wiederholt Gelegenheit bietet, an den Früchten seiner Arbeit zu partizipieren, er nährt sie."
Man ahnt, wie solche Sätze den Nerv der Kritikerkaste treffen.
Zimmermanns "Chronik eines Verhältnisse" lässt den Leser darüber rätseln, wie Grass diesen nun schon fünfzig Jahre währenden öffentlichen Kampf mit der Mehrzahl der Feuilletons und den politischen Gegnern durchhalten konnte. Es ist wohl das Glück des künstlerischen Talents, der ins unbeschreibliche wachsende Ruhm und der durch das Schreiben erworbene Reichtum, der ihn auch materiell unabhängig werden ließ, was ihn so stark macht. Häufig sitzt er zwischen allen Stühlen und Resignation blieb ihm in diesen Jahrzehnten nicht fremd.
Immer ist Günter Grass der skeptische Aufklärer geblieben. Nie hat er den ungeheuerlichen Zivilisationsbruch vergessen können, der sich mit dem Namen Auschwitz verbindet. Viele seiner Leser, die sich am Werk dieses barocken Erzählkünstlers begeisterten, haben gerade dies an ihm respektiert.
"Erschrecktes Innehalten vor der Wirklichkeit, das Arbeitsprinzip des jungen Künstlers Grass war von Anbeginn mehr als ein bloß ästhetisches Bekenntnis. Es trat zugleich als inszenierte Imago, als Selbststilisierung eines Nonkonformisten in Erscheinung, der Kunst und Welt, Artistik und Engagement – nach den Vorbildern Camus und Sartre und belehrt durch die deutsche Unheilsgeschichte - in desillusionierende Spannung zueinander setzen wollte."
Zimmermanns Buch belegt diese Spannung, die das Leben des Künstlers und des Bürgers Grass beherrscht, eindrucksvoll. Unverzichtbar ist es für Grass-Leser und nachdenkliche Grass-Gegner. Zudem gelingt es Zimmermann einen wichtigen Teil der bundesrepublikanischen Kulturgeschichte nachzuzeichnen.
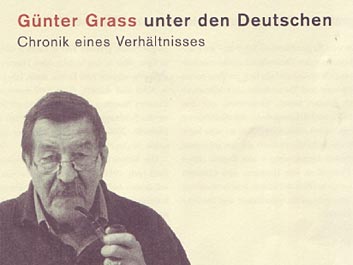
"Günter Grass unter den Deutschen" (Coverausschnitt)© Steidl-Verlag