Der neue Protektionismus
Noch im letzten Jahr herrschte Eiszeit zwischen Deutschland und China, weil die Bundeskanzlerin die Wahrung der Menschenrechte für Tibet verlangt hatte. Ende Januar bot sich dagegen ein ganz anderes Bild: Einträchtig präsentierten sich Angela Merkel und der chinesische Ministerpräsident in Berlin der Öffentlichkeit.
Das Anliegen, das beide zusammenbrachte: Gemeinsam wollen Deutschland und China gegen den aufkommenden weltweiten Protektionismus kämpfen. Schließlich leben beide Länder vom Export und der sei ja bekanntlich Garant für mehr Wohlstand bei allen.
Tatsächlich beschreibt diese Sicht nur die halbe Wahrheit. Bislang sind die internationalen Handelserfolge oft nur unter Missachtung des Gebots von Fairness und gerechter Teilhabe erkauft. So profitiert Deutschland als amtierender Exportweltmeister höchst einseitig von den offenen Handelsgrenzen. Denn wir verkaufen dem Ausland weitaus mehr Produkte, als wir selber bereit sind, dem Ausland abzunehmen.
Hierzulande feiern wir dies als Ausdruck unserer besonderen wirtschaftlichen Stärke. Nüchtern betrachtet sind diese regelmäßigen Überschüsse jedoch ein internationaler Störfaktor. Volkswirtschaftlich gesehen bedeuten sie nämlich nichts anderes als den Export von Arbeitslosigkeit zu unseren Handelspartnern.
"Was können wir dafür, dass wir so stark sind?", werden sich Viele sagen. Aber Deutschland kann seine Hände nicht in Unschuld waschen. Denn unsere Exporterfolge sind auch das Ergebnis eines systematischen Lohndumpings. Die Senkung der Sozialabgaben für Unternehmen und Arbeitnehmer, vor allem die jahrelange Lohnzurückhaltung der Beschäftigten haben uns massive Kostenvorteile gegenüber dem Ausland verschafft. So sind zwischen 2000 und 2007 die deutschen Reallöhne um rund 1,5 Prozent gewachsen, in Frankreich lag dagegen der Anstieg fast 7-mal und in Großbritannien sogar 12-mal höher.
Diese massiven Kostenentlastungen für die deutsche Wirtschaft sind nicht nur für das Ausland ein Problem. Sie haben zugleich unsere Gesellschaft in eine immer größere Schieflage gebracht: Vom Wirtschaftswachstum der letzten Jahre haben die Bezieher von Einkommen aus Gewinn- und Kapitalvermögen weitaus stärker profitiert, als die Arbeitnehmer. Das ist nicht nur eine entscheidende Ursache dafür, dass die Binnenwirtschaft bei uns seit längerem vor sich hin dümpelt. Hinzu kommt das Gefühl von immer mehr Menschen, Verlierer der Globalisierung zu sein.
Das bestätigte letztes Jahr eine Aufsehen erregende Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Sie stellte fest, dass zwischen 2000 und 2006 die Mittelschicht bei uns kräftig geschrumpft ist. Und zwar nicht nur als Folge von Arbeitslosigkeit, sondern ganz besonders als Konsequenz einer Steuerpolitik, die Unternehmen und Vermögende auf Kosten breiter Bevölkerungsgruppen massiv entlastet hat. Das war zwar nicht gerecht, ist aber stets mit dem Verweis auf den globalen Standortwettbewerb als alternativlos dargestellt worden.
Mit dieser Entwicklung steht Deutschland jedoch nicht allein. In allen großen Industriestaaten schwindet die Mittelschicht, weil die Regierungen im Prinzip zu ähnlichen Mitteln wie die Bundesregierung gegriffen haben. Das Platzen der globalen Kredit- und Vermögensblase hat diesen Trend noch beschleunigt. Millionen von Mittelschichtfamilien in den USA, Großbritannien oder Spanien sind jetzt nicht mehr Besitzer von Immobilienvermögen, sondern zahlungsunfähige Schuldner, die aus ihren Häusern vertrieben werden.
Die verarmenden Mittelschichten in den Industriestaaten bedeuten unterm Strich einen gewaltigen Kaufkraftausfall, der die Wirtschaft im In- und Ausland ins Mark trifft. Die Reaktionen der Regierungen in den USA oder Frankreichs sind daher durchaus nachvollziehbar. Sie wollen dafür sorgen, dass die sparsam gewordenen Konsumenten ihr Geld wenigstens für einheimische Produkte ausgeben und damit die inländischen Arbeitsplätze sichern.
Zweifellos ein gewaltiger Rückschlag für den internationalen Handel und die Weltwirtschaft insgesamt. Aber durchaus folgerichtig. Eine Globalisierung, die auf ein Mindestmaß an Fairness in den Nationalstaaten verzichtet, ist nicht nur unmoralisch. Sie ist letztlich auch volkswirtschaftlich zutiefst unvernünftig.
Kostas Petropulos, Publizist, 1960 in Dresden geboren, studierte Deutsch und Geschichte in Tübingen. Seit 1987 als freier Journalist vor allem als Autor von wirtschafts- und familienpolitischen Themen hervorgetreten. 1995 Mitbegründer des Heidelberger Büros für Familienfragen und soziale Sicherheit, das er seit Ende 1996 leitet.
Tatsächlich beschreibt diese Sicht nur die halbe Wahrheit. Bislang sind die internationalen Handelserfolge oft nur unter Missachtung des Gebots von Fairness und gerechter Teilhabe erkauft. So profitiert Deutschland als amtierender Exportweltmeister höchst einseitig von den offenen Handelsgrenzen. Denn wir verkaufen dem Ausland weitaus mehr Produkte, als wir selber bereit sind, dem Ausland abzunehmen.
Hierzulande feiern wir dies als Ausdruck unserer besonderen wirtschaftlichen Stärke. Nüchtern betrachtet sind diese regelmäßigen Überschüsse jedoch ein internationaler Störfaktor. Volkswirtschaftlich gesehen bedeuten sie nämlich nichts anderes als den Export von Arbeitslosigkeit zu unseren Handelspartnern.
"Was können wir dafür, dass wir so stark sind?", werden sich Viele sagen. Aber Deutschland kann seine Hände nicht in Unschuld waschen. Denn unsere Exporterfolge sind auch das Ergebnis eines systematischen Lohndumpings. Die Senkung der Sozialabgaben für Unternehmen und Arbeitnehmer, vor allem die jahrelange Lohnzurückhaltung der Beschäftigten haben uns massive Kostenvorteile gegenüber dem Ausland verschafft. So sind zwischen 2000 und 2007 die deutschen Reallöhne um rund 1,5 Prozent gewachsen, in Frankreich lag dagegen der Anstieg fast 7-mal und in Großbritannien sogar 12-mal höher.
Diese massiven Kostenentlastungen für die deutsche Wirtschaft sind nicht nur für das Ausland ein Problem. Sie haben zugleich unsere Gesellschaft in eine immer größere Schieflage gebracht: Vom Wirtschaftswachstum der letzten Jahre haben die Bezieher von Einkommen aus Gewinn- und Kapitalvermögen weitaus stärker profitiert, als die Arbeitnehmer. Das ist nicht nur eine entscheidende Ursache dafür, dass die Binnenwirtschaft bei uns seit längerem vor sich hin dümpelt. Hinzu kommt das Gefühl von immer mehr Menschen, Verlierer der Globalisierung zu sein.
Das bestätigte letztes Jahr eine Aufsehen erregende Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Sie stellte fest, dass zwischen 2000 und 2006 die Mittelschicht bei uns kräftig geschrumpft ist. Und zwar nicht nur als Folge von Arbeitslosigkeit, sondern ganz besonders als Konsequenz einer Steuerpolitik, die Unternehmen und Vermögende auf Kosten breiter Bevölkerungsgruppen massiv entlastet hat. Das war zwar nicht gerecht, ist aber stets mit dem Verweis auf den globalen Standortwettbewerb als alternativlos dargestellt worden.
Mit dieser Entwicklung steht Deutschland jedoch nicht allein. In allen großen Industriestaaten schwindet die Mittelschicht, weil die Regierungen im Prinzip zu ähnlichen Mitteln wie die Bundesregierung gegriffen haben. Das Platzen der globalen Kredit- und Vermögensblase hat diesen Trend noch beschleunigt. Millionen von Mittelschichtfamilien in den USA, Großbritannien oder Spanien sind jetzt nicht mehr Besitzer von Immobilienvermögen, sondern zahlungsunfähige Schuldner, die aus ihren Häusern vertrieben werden.
Die verarmenden Mittelschichten in den Industriestaaten bedeuten unterm Strich einen gewaltigen Kaufkraftausfall, der die Wirtschaft im In- und Ausland ins Mark trifft. Die Reaktionen der Regierungen in den USA oder Frankreichs sind daher durchaus nachvollziehbar. Sie wollen dafür sorgen, dass die sparsam gewordenen Konsumenten ihr Geld wenigstens für einheimische Produkte ausgeben und damit die inländischen Arbeitsplätze sichern.
Zweifellos ein gewaltiger Rückschlag für den internationalen Handel und die Weltwirtschaft insgesamt. Aber durchaus folgerichtig. Eine Globalisierung, die auf ein Mindestmaß an Fairness in den Nationalstaaten verzichtet, ist nicht nur unmoralisch. Sie ist letztlich auch volkswirtschaftlich zutiefst unvernünftig.
Kostas Petropulos, Publizist, 1960 in Dresden geboren, studierte Deutsch und Geschichte in Tübingen. Seit 1987 als freier Journalist vor allem als Autor von wirtschafts- und familienpolitischen Themen hervorgetreten. 1995 Mitbegründer des Heidelberger Büros für Familienfragen und soziale Sicherheit, das er seit Ende 1996 leitet.
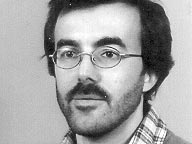
Kostas Petropulos© privat