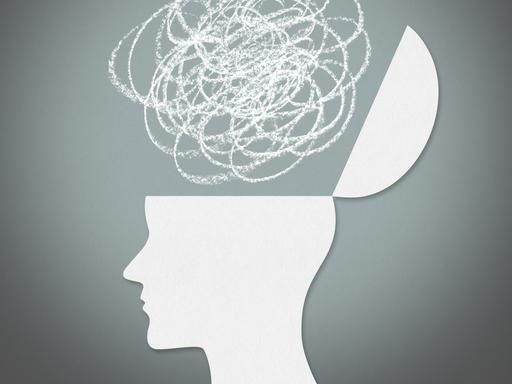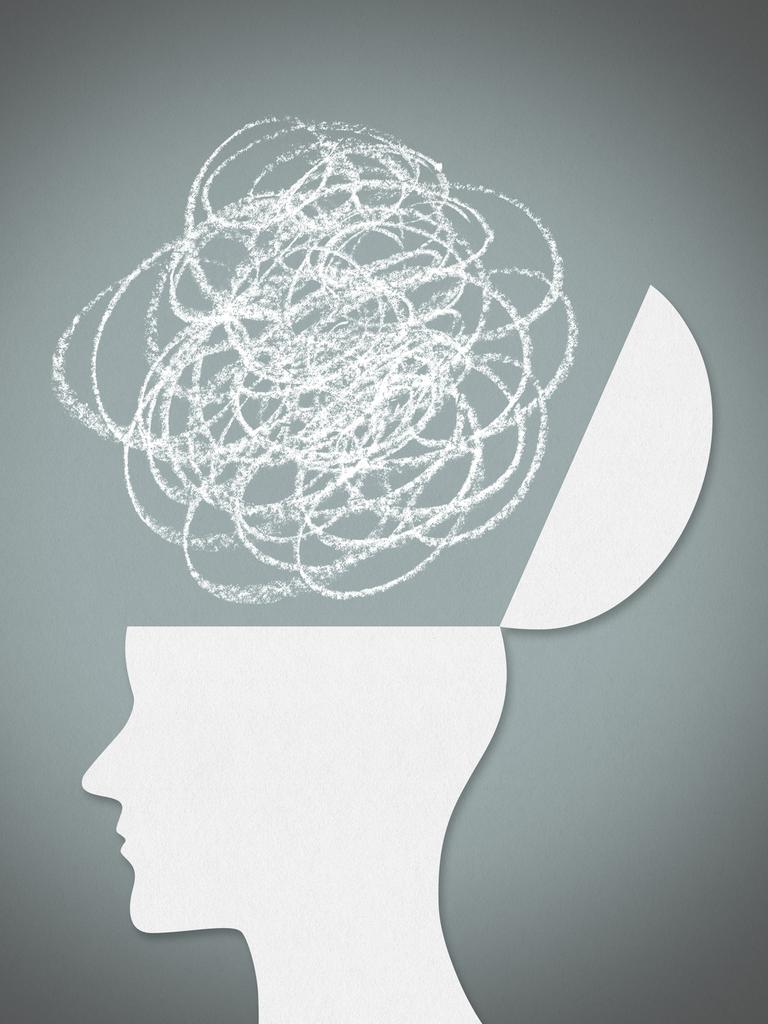Umgang mit Demenz

Nähe, Geduld und die richtigen Worte helfen, Stigmatisierung von Menschen mit Demenz zu überwinden © picture alliance / Westend61 / Daniel Ingold
Halt geben im Vergessen

Fast zwei Millionen Menschen in Deutschland leben mit Demenz. Viele werden stigmatisiert und ausgegrenzt. Wie man respektvoll mit Menschen mit Demenz spricht, sie im Alltag unterstützt – und welche Angebote es für Betroffene gibt. Ein Überblick.
Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland haben Demenz. Doch noch immer sind Scham, Unsicherheit und Vorurteile weit verbreitet. Viele Betroffene berichten von Diskriminierung. Dabei geht es auch anders. Warum Sprache so wichtig ist, wie man im Alltag besser mit Menschen mit Demenz umgeht und welche Angebote Betroffene und Angehörige wirklich unterstützen.
Inhalt
Was ist Demenz und was ist Alzheimer?
Demenz ist keine eigene Krankheit, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene Erkrankungen, die mit typischen Symptomen wie Gedächtnisverlust, Sprach- oder Orientierungsstörungen einhergehen. Von einer Demenz spricht man erst, wenn diese Einschränkungen mindestens sechs Monate andauern und das selbstständige Leben deutlich beeinträchtigen. Da die meisten Demenzformen fortschreitend sind, nehmen die Probleme mit der Zeit zu, alltägliche Aufgaben werden immer schwerer.
Alzheimer ist die häufigste Ursache für Demenz – etwa zwei Drittel aller Fälle in Deutschland gehen darauf zurück. Es handelt sich um eine neurodegenerative Erkrankung, bei der sich krankhafte Eiweißablagerungen im Gehirn bilden, sogenannte Amyloid-Plaques. Zusammen mit weiteren Ablagerungen, den sogenannten Tau-Fibrillen, schädigen sie die Nervenzellen und deren Verbindungen, sodass diese nach und nach absterben.
Alzheimer: Symptome und Ursachen
Charakteristisch für Alzheimer ist, dass neue Informationen nicht mehr gespeichert werden können, während alte Erinnerungen oft lange erhalten bleiben. So kann jemand noch Gedichte aus der Schulzeit aufsagen, aber nicht mehr wissen, was er am Morgen gefrühstückt hat.
Warum manche Menschen an Alzheimer erkranken und andere nicht, ist noch nicht vollständig geklärt. Sicher ist jedoch, dass mehrere Faktoren zusammenwirken. In sehr seltenen Fällen ist Alzheimer erblich bedingt. In den allermeisten Fällen tragen jedoch Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen, Bewegungsmangel oder Übergewicht dazu bei. Auch unbehandelte Depressionen im mittleren Lebensalter können das Risiko für eine spätere Alzheimer-Erkrankung erhöhen.
Warum wird Demenz oft stigmatisiert?
Der World Alzheimer’s Report 2024 zeigt: Weltweit gibt es noch große Wissenslücken und Vorurteile über Demenz. Befragt wurden über 40.000 Menschen aus 166 Ländern.
Viele wissen nicht, dass Demenz kein normaler Teil des Alterns, sondern immer die Folge einer Erkrankung ist. 80 Prozent der Befragten sehen Demenz daher als normalen Teil des Älterwerdens. Selbst unter Ärztinnen, Pflegern und anderen Fachkräften ist das Missverständnis verbreitet: 65 Prozent halten Demenz ebenfalls für eine normale Alterserscheinung.
Die Folge: Demenz wird oft verharmlost und Betroffene erhalten nicht die nötige Unterstützung. 88 Prozent berichten von Diskriminierung, 31 Prozent meiden soziale Situationen aus Angst vor negativen Reaktionen.
„Es gibt immer noch das Gefühl: Man muss es verbergen und geheim halten, ob man selber eine Diagnose hat oder ein Angehöriger. Man spricht nicht gerne drüber, es ist schambehaftet und mit vielen Ängsten besetzt“, sagt Susanna Saxl-Reisen von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
Wie kann Sprache helfen, Vorurteile abzubauen?
Neben der Aufklärung über Demenz spielt auch Sprache eine wichtige Rolle. Begriffe wie „Kranker“ oder „Jemand ohne Verstand/Geist“ verstärken negative Bilder. Auch die Bezeichnung „Dementer" stellt die Krankheit vor die Person und macht den Menschen mit der Krankheit gleich.
In ihrem Sprachleitfaden nennt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft solche Begriffe ausdrücklich als No-Go und empfiehlt stattdessen neutrale Formulierungen wie „Menschen mit Demenz“.
Viel zu selten wird laut Deutscher Alzheimer Gesellschaft betont, welche Fähigkeiten bei Menschen mit Demenz erhalten bleiben, oft über viele Jahre.
Auch Medienberichte tragen zu der Stigmatisierung bei, wenn sie etwa Krankheitsverläufe dramatisieren. Die Berichterstattung rücke oft die negativen Seiten der Demenz in den Vordergrund und blende das Leben jenseits der Erkrankung aus, kritisiert die Journalistin Peggy Elfmann.
Statt Angstbilder zu zeichnen, sollte die Berichterstattung konstruktiv sein - zum Beispiel, indem Kontaktadressen von Hilfsangeboten genannt werden, betont die Journalistin. Gerade zu Beginn seien Betroffene und Angehörige oft überfordert. Reportagen und Dokumentationen seien eine Chance, um Hilfe an die Hand zu geben und Perspektiven aufzuzeigen.
Wie können wir im Alltag besser mit Menschen mit Demenz umgehen?
Der Schlüssel liegt in Geduld, Empathie und klarer Kommunikation. Menschen mit Demenz wollen niemanden provozieren, wenn sie zum Beispiel dieselbe Frage mehrfach stellen, sie haben es schlicht vergessen. Bastian Willenborg, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, rät deshalb: ruhig bleiben und deutlich sprechen.
Menschen mit Demenz brauchen vor allem Sicherheit und Verständnis. Deshalb ist es gut, so lange wie möglich an Gewohntem festzuhalten: feste Essenszeiten, bekannte Abläufe oder vertraute Beschäftigungen geben Orientierung. Auch eine stabile Umgebung hilft, denn große Veränderungen, zum Beispiel in der Wohnung, können sie zusätzlich verunsichern.
Alltagstipps für einen respektvollen Umgang
Ratgeber des Bundesgesundheitsministeriums und der Alzheimer Forschung Initiative geben viele Tipps für den Umgang mit Menschen mit Demenz: Wichtig ist vor allem, Stress und negative Gefühle zu vermeiden, denn Kritik oder Überforderung verstärken die Unsicherheit. Ermutigung und Lob wirken dagegen stärkend. Diskussionen und Streit helfen meist nicht weiter. Besser ist es, abzulenken oder nachzugeben.
Wenn Ängste auftreten, sollte man nach den Ursachen suchen und die Sorgen ernst nehmen. Oft beruhigt ein einfaches Signal wie „Ich bin da und passe auf“ mehr als lange Erklärungen. Auch kleine Gesten und freundliche Worte können Sicherheit geben und den Alltag leichter machen.
Auch Schulungen im Umgang mit Menschen mit Demenz sind wichtig, inzwischen gibt es sie zum Beispiel im Einzelhandel. Auszubildende lernen dort in speziellen Kursen, wie sie Kundinnen und Kunden unterstützen können, wie sie geduldig bleiben, einfache Sprache nutzen und aktiv Hilfe anbieten.
Statt etwa lange den Weg zu einem Produkt zu erklären, ist es oft besser, gemeinsam zu handeln: „Ich schaue mal mit Ihnen zusammen.“ So eine Geste nimmt Stress und bewahrt die Würde der Betroffenen.
Welche Angebote gibt es für Menschen mit Demenz?
Die Unterstützung für Menschen mit Demenz ist vielfältig. In einigen Städten gibt es Demenz-WGs, in denen Betroffene wie in einer Mietergemeinschaft zusammenleben und von einem Pflegedienst betreut werden.
Auch eine Alltagsbegleitung kann den Alltag erleichtern: Sie hilft bei Erledigungen, begleitet Gespräche oder gestaltet gemeinsame Aktivitäten und entlastet gleichzeitig die Angehörigen. In vielen Fällen übernimmt hier die Pflegekasse die Kosten, wenn ein Pflegegrad vorliegt.
Für Menschen mit Demenz unter 65 Jahren, die oft noch mitten im Berufs- oder Familienleben stehen, gibt es spezielle Projekte wie den „Ankerpunkt Junge Demenz“ in Hamburg. Solche Angebote bieten zum Beispiel Freizeitaktivitäten, Beratung und Selbsthilfegruppen, die auf die besonderen Herausforderungen in diesem Lebensabschnitt eingehen.
Gedächtnisambulanzen unterstützen bei einer frühen Diagnose, führen Tests durch, helfen bei der Unterscheidung der Demenzformen und beraten über Therapiemöglichkeiten.
Tagespflegeeinrichtungen bieten strukturierte Betreuung über mehrere Stunden am Tag, oft mit Fahrdienst und gemeinsamen Aktivitäten. Das gibt den Betroffenen Sicherheit und fördert soziale Kontakte.
Nicht zuletzt sollten auch Angehörige auf sich selbst achten, sagt der Psychiater Willenborg. Regelmäßige Pausen, Bewegung an der frischen Luft und der Austausch in Selbsthilfegruppen würden helfen, Überlastung zu vermeiden.
Wichtige Anlaufstellen und regionale Hilfen gibt es auf der Website der Deutschen Alzheimer Gesellschaft sowie beim Alzheimer-Telefon (030 259 37 95 14).
ema