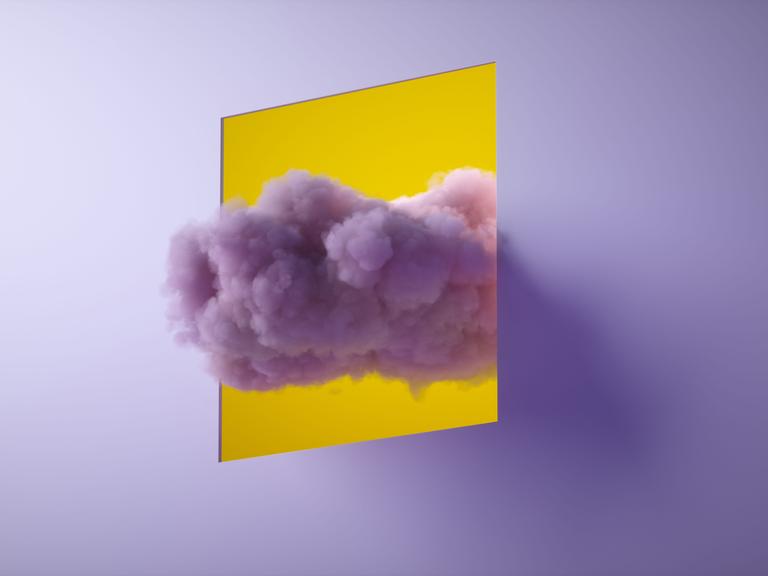Kommentar

Kleiner Lohn bei großen Tech-Konzernen: In Ländern wie Kenia, Indien und Venezuela sitzen Tausende Klickarbeiter vor ihren Bildschirmen, um Daten zu labeln. © IMAGO / Zoonar II / IMAGO / Zoonar.com / Yuri Arcurs peopleimages.com
Gerechtigkeit für die Klickarbeiter!

Weniger als zwei Euro die Stunde bekommen indische oder kenianische Klickarbeiter, die für große Tech-Konzerne schuften. Adrian Lobe findet das ungerecht und fordert eine Ausweitung des Lieferkettengesetzes auf die Datenindustrie und ihre Beschäftigten.
Wer viel im Internet surft, wird vermutlich schon mal über eines dieser Bilderrätsel gestolpert sein: Auf einem Foto, das in quadratische Kacheln unterteilt ist, muss der Nutzer diejenigen auswählen, auf denen eine Ampel oder Kreuzung zu erkennen ist. Mit diesen sogenannten Captchas soll bewiesen werden, dass man ein Mensch und kein Roboter ist, der das Netz mit Suchanfragen flutet. Eine nervige Fleißarbeit. Doch es gibt Menschen, die damit ihr Geld verdienen müssen.
In Ländern wie Kenia, Indien und Venezuela sitzen Tausende Klickarbeiter vor ihren Bildschirmen, um im Auftrag großer Tech-Konzerne Daten zu labeln. Für ein paar Dollar am Tag klicken sie sich in mühevoller und monotoner Kleinstarbeit durch Bilder oder Videoaufnahmen, um darin beispielsweise Bäume und Fußgänger zu kennzeichnen.
Ein Computer kann ein Stoppschild von einem Vorfahrtschild nicht unterscheiden. Er muss das aber lernen, wenn Roboterautos unfallfrei durch den Verkehr fahren sollen. Im Gegensatz zu einem Kleinkind, dem ein paar Beispiele reichen, braucht eine künstliche Intelligenz viel mehr Anschauungsmaterial, um eine Ampel oder Kreuzung zu erkennen: Tausende Fotos, auf denen draufsteht, was zu sehen ist. Die Beschriftung von Daten erfolgt nach wie vor manuell. Der Mensch ist noch immer die billigere Sortiermaschine.
Mit jeder Menge Müll konfrontiert
Die Datenschürfer im globalen Süden schauen aber nicht nur in der Kameraperspektive zu, wie wohlhabende Menschen im globalen Norden mit ihrem schicken Tesla durch die Gegend fahren, sondern werden auch mit jeder Menge Müll konfrontiert: Gewaltdarstellungen, Hassnachrichten, Hetze. Diese toxischen Inhalte müssen aktiv entfernt werden, damit sie das Datenfutter nicht vergiften und an der Benutzeroberfläche von Text- und Bildgeneratoren aufpoppen.
Diese „digitale Drecksarbeit“ ist verstörend und traumatisierend: In Kenia, wo der ChatGPT-Entwickler Open AI für einen Stundenlohn von zwei US-Dollar Daten labeln lässt, haben kürzlich Content-Moderatoren eine Petition unterzeichnet, um diese ausbeuterischen Arbeitsbedingungen anzuprangern. Allein, ihr Klagen wird weitgehend überhört.
Es ist schon seltsam: Da gilt in Deutschland seit diesem Jahr ein strenges Lieferkettengesetz, das Unternehmen dazu verpflichtet, die Wertschöpfungsketten ihrer Produkte detailliert nachzuverfolgen. Das EU-Parlament hat im Juni eine Richtlinie erlassen, deren Regelungsgehalt sogar darüber hinaus geht. Stammt das Garn eines Pullovers aus Kinderarbeit? Wurden für den Wohnzimmertisch Regenwälder abgeholzt? Woher kommt der Kautschuk für die Autoreifen?
Hauptsache, die Maschine funktioniert!
Doch unter welchen Bedingungen Daten aufbereitet werden, die den Fahrcomputer oder virtuellen Assistenten antreiben, ist den meisten Leuten wie auch dem Gesetzgeber offenbar gleichgültig. Hauptsache, die Maschine funktioniert! Dabei weiß jeder: Daten sind genauso Rohstoffe wie Kupfer oder Kautschuk.
Tech-Konzerne entwickeln daraus millionenschwere KI-Systeme. Nur weil man etwas nicht anfassen kann, folgt daraus nicht, dass es auch sauber ist. Umwelt- und Menschenrechtsstandards gelten auch für Tech-Konzerne – sie können sich dem Recht nicht entziehen, indem sie die Drecksarbeit an Subfirmen in Entwicklungsländern auslagern.
Will man keine Doppelstandards schaffen, braucht es auch für Datenpakete einen Herkunftsnachweis. Das Lieferkettengesetz muss daher auch auf die Datenindustrie und ihre Zulieferer ausgeweitet werden. Das heißt: faire Löhne, Gesundheitsschutz und keine Ausbeutung. Die Maschinenflüsterer leisten wichtige Arbeit. Sie sorgen dafür, dass Sprachmodelle nicht halluzinieren und Roboterfahrzeuge in der Spur bleiben. Das sollte auch entsprechend honoriert werden.