Das Schreckgespenst der SPD
Oskar Lafontaine hält der SPD den Spiegel der eigenen Zerrissenheit vor. Das macht die Parteiführung mittlerweile nervös. Denn seit dem Wahlerfolg der Linken in Bremen ist klar, dass mit dem unliebsamen früheren Vorsitzenden mehr denn je zu rechnen ist.
Im Mai 2005 hat Oskar Lafontaine sein Mitgliedsbuch an die SPD zurückgegeben - doch getrennt hat er sich von der Partei bis heute nicht. Sie ist nach wie vor das Gestirn, auf das sein politisches Mühen ausgerichtet ist. Wegen ihr plagt er sich seitdem mit engstirnigen Trotzkisten und altbackenen Realsozialisten herum. Sie hat er im Blick, wenn er über die Zukunft der Linken räsoniert. Erst kürzlich hat er mit einem Rückblick in die Geschichte einen Einblick in seine Visionen gegeben. Er nannte es einen Fehler, dass sich die SPD 1990 nicht mit der Nach-Wende-SED vereinigt habe. Diesen Fehler gilt es nun zu bereinigen.
Die SPD des Oskar Lafontaine ist die der späten neunziger Jahre, die SPD vor dem Schröderschen Sündenfall, vor der neoliberalen Verirrung, die sich "Neue Mitte" nannte. Diese SPD wieder auf den rechten, auf seinen Kurs zu führen, ist sein Anliegen.
Oskar Lafontaine wäre nichts ohne die SPD - er wäre ein saarländischer Politrentner, eingeschlossen in seinem theoretischen Fertighaus. Die SPD hat ihn nach seinem Absturz wieder zu dem gemacht, was er jetzt ist. Sie war der unüberhörbare Resonanzboden seiner Auftritte und Analysen. Wo er die Schrecken der Globalisierung an die Wand malte, litt sie unter einer Heuschreckenplage. Wo er den Neoliberalismus am Werke sah, ging sie zu Schröder auf Distanz. Er steht für raumgreifende Konzepte, sie für reformerisches Kleinklein. Er hat eine Weltformel für Gerechtigkeit, wo sie nur noch fordern und fördern kann.
Kurz er hat all das, wonach sich die Linke in der SPD sehnt. Eine Sehnsucht, welche die Rechte nicht mehr erfüllen kann. Weil er der Partei ihre permanente Zerrissenheit vorführt, wurde Oskar Lafontaine zum Schreckgespenst der SPD. Seit dem Wahlerfolg in Bremen ist dieses Gespenst der Führung erkennbar in die Glieder gefahren. Sie ist nun vor die Frage gestellt, ob sie es besser durch Ausgrenzen bannen oder durch Einbinden zähmen soll.
Die Perspektive eines rot-rot-grünen Regierungsbündnisses hat für die SPD-Linke einen dreifachen Charme. Zum einen tröstet die umfragegesättigte These von der strukturellen Mehrheit der Linken über die grassierende Schwäche der SPD hinweg. Zum anderen wandelt sie die Spannung zwischen den strategischen Polen, Regieren und Opponieren in positive Energie. Und zum Dritten kann sie sich auf Willy Brandts Wort von der "Mehrheit links von der Union" berufen. Damit hatte dieser 1982 die SPD auf Rot-Grün hin orientiert, und warum sollte, was damals klappte, sich nicht 2009 wiederholen lassen. Das würde zudem den Graben zur Union wieder vertiefen. Angesichts des desolaten Zustandes der Großen Koalition hat zumindest dieser Aspekt einen Reiz, der alle in der SPD eint. Warum sollte sie dem nicht erliegen?
Das erste Argument dagegen heißt wiederum Oskar Lafontaine. Er hatte bereits 1990 als Spitzenkandidat der SPD und dann noch einmal in den wenigen Monaten als Bundesfinanzminister eindrucksvoll belegt, wie grandios eine linke Politik seiner Bauart schon im Ansatz scheitern kann.
Dass der Linken in der SPD diese Lehre nicht reicht, hängt mit einer Kinderkrankheit der Partei zusammen, von der sie sich bis heute nicht erholt hat. Sie hatte stets ein Faible für Ideale und ein Misstrauen gegen alles Reale, vor allem Realpolitik.
Deshalb gilt ihr noch heute die Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914 als der erste Sündenfall der Partei, obgleich sie sich damit den Zutritt zum Staatsapparat erschloss. Rosa Luxemburg wird als große Ahnherrin geehrt, obgleich sie ohne strategische Option die erste Spaltung der Partei provozierte. Diese Ambivalenz, die das Machbare nie als Erfolg und das Erfolgreiche nie als machbar erscheinen lässt, prägt die SPD bis zum heutigen Tag. Dabei ist das Geheimnis sozialdemokratischen Erfolges nicht die Prinzipienfestigkeit, sondern die Anpassungsfähigkeit an vorgegebene Ordnungen.
Die SPD konnte die Integration der Arbeiterschaft nur vorantreiben, indem sie die Verhältnisse stabil hielt. Erst der Staat, dann die Partei, hat Gerhard Schröder das einmal genannt.
Demgegenüber kehrte die Linke die Ideale gegen die Ordnung und meinte sich die Politik und darüber die Ökonomie Untertan machen zu können. Eine solche Omnipotenz lässt sich in der Opposition wohlfeil behaupten. Als Regierungsgeschäft scheitert sie, wie im Fall Lafontaine oder macht einer kleinlauten Anpassung Platz, wie man sie bei den rot-roten Landesregierungen beobachten kann.
Die SPD hatte ihre Hochphase nicht von ungefähr, als sie von einem Politiker geführt wurde, der auf Grund der eigenen Vita gegen den linken Idealismus hinreichend gefeit war. Ihr bestes Programm war das Godesberger, ein reines Anpassungsprogramm, das auf die Mitte der Gesellschaft zielte. Statt schuldbewusst auf Lafontaine zu starren, sollte die SPD sich selbstbewusst auf Herbert Wehner besinnen.
Dieter Rulff, Journalist, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die "Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte". Ab 1. Januar 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
Die SPD des Oskar Lafontaine ist die der späten neunziger Jahre, die SPD vor dem Schröderschen Sündenfall, vor der neoliberalen Verirrung, die sich "Neue Mitte" nannte. Diese SPD wieder auf den rechten, auf seinen Kurs zu führen, ist sein Anliegen.
Oskar Lafontaine wäre nichts ohne die SPD - er wäre ein saarländischer Politrentner, eingeschlossen in seinem theoretischen Fertighaus. Die SPD hat ihn nach seinem Absturz wieder zu dem gemacht, was er jetzt ist. Sie war der unüberhörbare Resonanzboden seiner Auftritte und Analysen. Wo er die Schrecken der Globalisierung an die Wand malte, litt sie unter einer Heuschreckenplage. Wo er den Neoliberalismus am Werke sah, ging sie zu Schröder auf Distanz. Er steht für raumgreifende Konzepte, sie für reformerisches Kleinklein. Er hat eine Weltformel für Gerechtigkeit, wo sie nur noch fordern und fördern kann.
Kurz er hat all das, wonach sich die Linke in der SPD sehnt. Eine Sehnsucht, welche die Rechte nicht mehr erfüllen kann. Weil er der Partei ihre permanente Zerrissenheit vorführt, wurde Oskar Lafontaine zum Schreckgespenst der SPD. Seit dem Wahlerfolg in Bremen ist dieses Gespenst der Führung erkennbar in die Glieder gefahren. Sie ist nun vor die Frage gestellt, ob sie es besser durch Ausgrenzen bannen oder durch Einbinden zähmen soll.
Die Perspektive eines rot-rot-grünen Regierungsbündnisses hat für die SPD-Linke einen dreifachen Charme. Zum einen tröstet die umfragegesättigte These von der strukturellen Mehrheit der Linken über die grassierende Schwäche der SPD hinweg. Zum anderen wandelt sie die Spannung zwischen den strategischen Polen, Regieren und Opponieren in positive Energie. Und zum Dritten kann sie sich auf Willy Brandts Wort von der "Mehrheit links von der Union" berufen. Damit hatte dieser 1982 die SPD auf Rot-Grün hin orientiert, und warum sollte, was damals klappte, sich nicht 2009 wiederholen lassen. Das würde zudem den Graben zur Union wieder vertiefen. Angesichts des desolaten Zustandes der Großen Koalition hat zumindest dieser Aspekt einen Reiz, der alle in der SPD eint. Warum sollte sie dem nicht erliegen?
Das erste Argument dagegen heißt wiederum Oskar Lafontaine. Er hatte bereits 1990 als Spitzenkandidat der SPD und dann noch einmal in den wenigen Monaten als Bundesfinanzminister eindrucksvoll belegt, wie grandios eine linke Politik seiner Bauart schon im Ansatz scheitern kann.
Dass der Linken in der SPD diese Lehre nicht reicht, hängt mit einer Kinderkrankheit der Partei zusammen, von der sie sich bis heute nicht erholt hat. Sie hatte stets ein Faible für Ideale und ein Misstrauen gegen alles Reale, vor allem Realpolitik.
Deshalb gilt ihr noch heute die Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914 als der erste Sündenfall der Partei, obgleich sie sich damit den Zutritt zum Staatsapparat erschloss. Rosa Luxemburg wird als große Ahnherrin geehrt, obgleich sie ohne strategische Option die erste Spaltung der Partei provozierte. Diese Ambivalenz, die das Machbare nie als Erfolg und das Erfolgreiche nie als machbar erscheinen lässt, prägt die SPD bis zum heutigen Tag. Dabei ist das Geheimnis sozialdemokratischen Erfolges nicht die Prinzipienfestigkeit, sondern die Anpassungsfähigkeit an vorgegebene Ordnungen.
Die SPD konnte die Integration der Arbeiterschaft nur vorantreiben, indem sie die Verhältnisse stabil hielt. Erst der Staat, dann die Partei, hat Gerhard Schröder das einmal genannt.
Demgegenüber kehrte die Linke die Ideale gegen die Ordnung und meinte sich die Politik und darüber die Ökonomie Untertan machen zu können. Eine solche Omnipotenz lässt sich in der Opposition wohlfeil behaupten. Als Regierungsgeschäft scheitert sie, wie im Fall Lafontaine oder macht einer kleinlauten Anpassung Platz, wie man sie bei den rot-roten Landesregierungen beobachten kann.
Die SPD hatte ihre Hochphase nicht von ungefähr, als sie von einem Politiker geführt wurde, der auf Grund der eigenen Vita gegen den linken Idealismus hinreichend gefeit war. Ihr bestes Programm war das Godesberger, ein reines Anpassungsprogramm, das auf die Mitte der Gesellschaft zielte. Statt schuldbewusst auf Lafontaine zu starren, sollte die SPD sich selbstbewusst auf Herbert Wehner besinnen.
Dieter Rulff, Journalist, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die "Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte". Ab 1. Januar 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
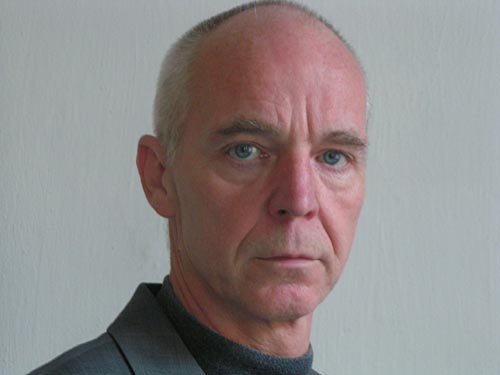
Dieter Rulff© privat