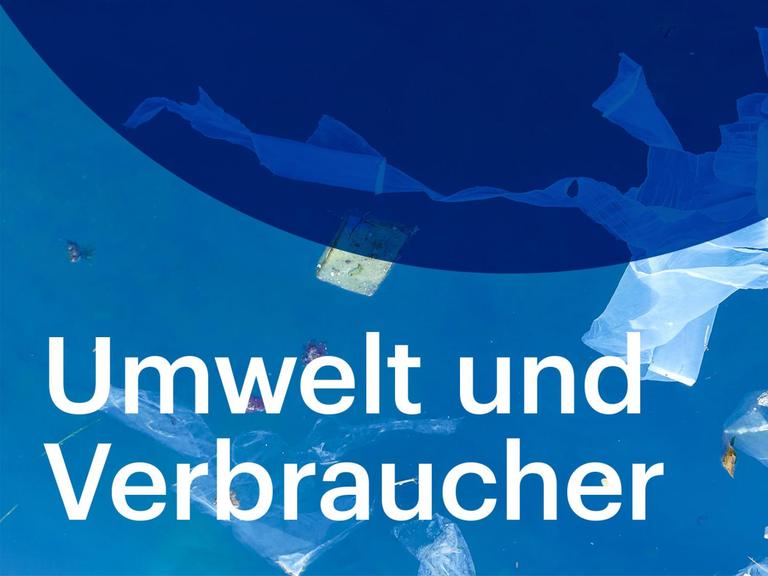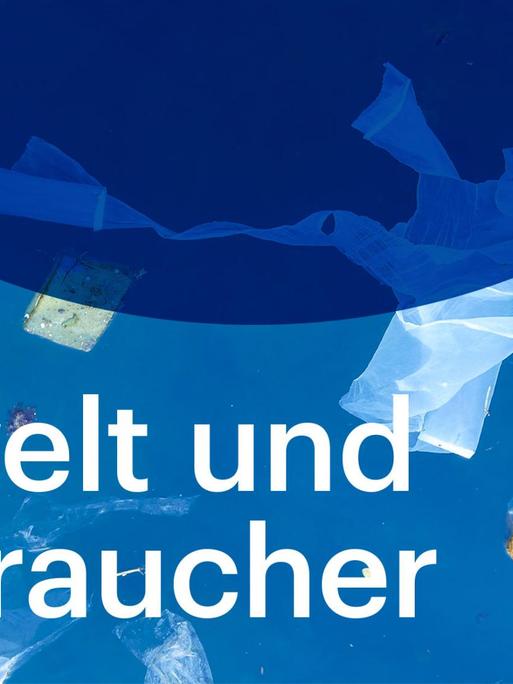Dämpfer für die Technik-Enthusiasten
Apps helfen nicht bei den Herausforderungen unserer Zeit, lautete die These eines Redners. Bei Digital-Life-Design (DLD) in München waren in diesem Jahr überraschend kritische und politische Töne zu vernehmen. Alljährlich trifft sich auf Einladung des Burda-Verlags die Internetwelt in München.
Politisches auf der DLD? Das ist ungewöhnlich für diese Veranstaltung. Diesmal aber ging kein Weg daran vorbei. Zu einschneidend ist der Skandal um die NSA-Überwachung für die Geschäftsmodelle des Silicon Valley. Mehr Verschlüsselung, besserer Datenschutz und das Recht, seine Daten zurückzuerhalten – das waren die Vorschläge, mit denen man sich gegen Ausspähung wehren will. Mehr politischen Druck von unten forderte dagegen Jeff Jarvis, Journalistikdozent an der New York University:
"Die Regierung muss auf Transparenz ausgerichtet sein und nur Geheimnisse haben dürfen, wenn es absolut nötig ist. Im Moment passiert genau das Gegenteil: Sie setzt auf Geheimniskrämerei und ist nur dann transparent, wenn sie von außen gezwungen wird – sei es durch Journalisten oder durch Whistleblower. Das müssen wir ändern. Und das ist gar nicht so schwer. Die Reaktion der Regierung auf Snowden war, sich noch mehr zu verschließen und noch geheimniskrämerischer zu werden. Doch am Ende wird sie merken, dass es wirklich schwer ist, ein Geheimnis zu bewahren."
Mehr politisches Denken forderte auch der Internetkritiker Ewgeni Morozow, dessen Auftritt in München für eine Mischung aus Aufregung und betretenem Schweigen sorgte. Dass ein Redner derart radikal die versammelten Technik-Enthusiasten an die Kandare nehmen darf, war ein weiterer ungewöhnlicher Programmpunkt in diesem Jahr. Morozow erneuerte seine Kritik an der Einstellung, Herausforderungen unserer Zeit mit Hilfe von Apps angehen zu wollen. Damit würden gesellschaftliche Probleme nicht gelöst, sondern nur privatisiert:
"Es geht darum, einen anderen Ansatz zu formulieren, der andere Werte und Ziele einschließt als nur das Vorhaben, so effektiv wie möglich Informationen zu verarbeiten. Wir müssen erkennen, dass Entscheidungen, die wir als rein technologisch betrachten, das nicht sind. Dahinter stehen aber auch politische und ökonomische Statements. Jeder, der eine App bauen will, um die Welt zu retten, sollte erkennen, dass die gute Intention allein nicht reicht. Wir haben viele Menschen mit guten Ideen gesehen, die jede Menge Schaden verursacht haben, weil sie sehr naiv auf das Leben geschaut haben."
Das Wachstumsdenken hinterfragen
Morozow schlug vor, Alternativen zu entwickeln zum Wachstumsdenken in der Informationstechnologie. Zum Beispiel sich zu reduzieren, so wie man auch begonnen habe, kleinere Autos zu fahren. Er entwarf ein Szenario für den Fall, dass Unternehmen weiter so ungebremst Daten sammeln, wie bisher:
"Ich denke, in zehn Jahren werden Google und Facebook auch als Banken oder Versicherungsunternehmen tätig sein. Einfach, weil sie die besten Daten haben. Sie können viel genauer als die Banken einschätzen, ob jemand in der Lage ist, seine Kredite zurückzuzahlen. Oder wie groß die Gefahr ist, dass jemand in einen Unfall verwickelt wird. Mit ihren Daten aus selbst fahrenden Autos, von Thermostaten, Rauchmeldern, Smart Glasses, E-Mails oder von Smartphones ist Google in einer viel besseren Position als jeder andere, eine Bank oder Versicherung zu werden – gigantischer, als es die Welt jemals gesehen hat."
Solche Szenarien müsse man im Auge haben, meint Morozow, der sich sicher ist, dass der Trend, persönliche Daten zu sammeln als Gegenleistung für "kostenlose" Angebote, auch in den nächsten Jahren anhalten wird.
Wie schwer dem offenbar zu widerstehen ist, zeigt das Beispiel des einstigen Politaktivisten Eli Pariser, der sich mit seiner Kritik an der "Filter Bubble" einen Namen gemacht und noch vor Jahren davor gewarnt hatte, das Internet könne die Menschen verdummen. Auf der DLD präsentierte er ein eigenes Startup, die Plattform "Upworthy", mit der er Nachrichten aggregiert, die er für besonders wertvoll hält. Die Kritik, dass er damit auch eine Filterbubble schaffe, wollte er nur ungern akzeptieren.
Eli Pariser: "Meine größte Sorge im Zusammenhang mit der Filter Bubble war, dass wenn ein Algorithmus wie der von Facebook darüber entscheidet, welchen Inhalt man im Netz zu sehen bekommt, die wichtigen Themen untergehen könnten. Wir haben ein riesiges Angebot an Informationen, die wie Junkfood sind, nicht sehr hochwertig, nicht richtig satt machend, aber schnell konsumierbar. Alle wichtigen Inhalte, die früher auf Seite eins einer Publikation standen, konkurrieren heute mit den vielen News, die zum Beispiel über Facebook kommen. Und aus dieser Kritik der Filter Bubble heraus entstand die Frage: Können wir etwas tun, um diesen wichtigen Inhalten zur Geltung zu verhelfen auf eine Weise, die in den sozialen Medien funktioniert."
"Upworthy" ist Teil eines Trends, der die deutschen Medien in diesem Jahr stark beschäftigen dürfte und für den auch Plattformen wie "Buzzfeed" oder "upcoming.de" stehen. Hier werden klassische journalistische Informationen und die wichtigsten News aus den sozialen Netzwerken – Bilder, Videos und Texte – aggregiert und für den User aufbereitet. Das Geschäft boomt. Aus Sicht von Jochen Wegner, Chefredakteur von zeitonline, muss dies aber keine Bedrohung für den klassischen Journalismus sein:
"Die Frage ist nur jedes Mal: Als Google kam, haben alle gesagt, ja wie reagieren wir jetzt als Journalisten darauf, müssen wir jetzt für Google Headlines schreiben? Jetzt haben wir den Trend, Facebook funktioniert extrem. Hunderte von Websites ziehen an den großen klassischen Websites vorbei. Man muss sich mal überlegen, 'Upworthy' hat 87 Millionen Unique user, die 'New York Times' 30 Millionen. Natürlich fragt sich jeder, machen wir hier etwas grundlegend falsch? Man darf einfach nicht allzu nervös werden, weil man sonst das, warum Journalisten Journalismus machen, zerstört."
Dass dieser auch im Internet eine Zukunft hat, ist sich Wegner sicher. Auch wenn darüber auf der DLD vor allem Skepsis geherrscht hat.