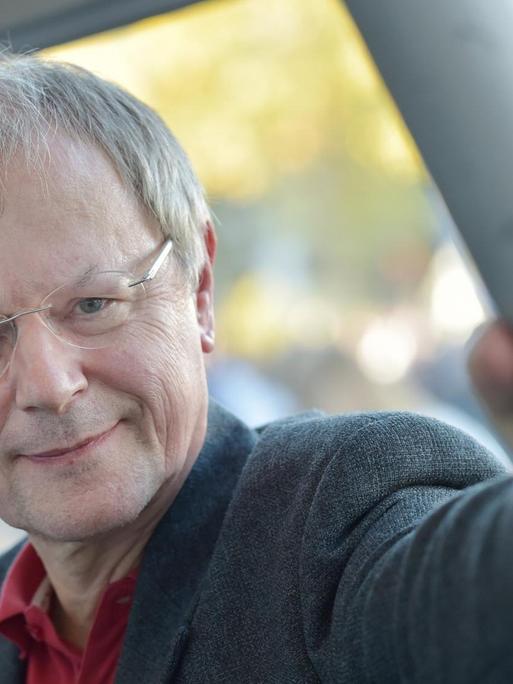Catherine Newmark ist promovierte Philosophin und arbeitet als Kulturjournalistin, unter anderem als Redakteurin und Moderatorin der Philosophiesendung "Sein und Streit" im Deutschlandfunk Kultur und beim Philosophie Magazin. Zuletzt erschien von ihr der Essay "Warum auf Autoritäten hören?" (Dudenverlag 2020).
Im Namen einer bürgerlichen Normalität vergessen wir die Armen
04:36 Minuten

Corona macht die Reichen reicher und die Armen ärmer, berichtete diese Woche die Hilfsorganisation Oxfam. Inwiefern das auch mit unserer Vorstellung von Normalität zu tun hat, kommentiert unsere Redakteurin Catherine Newmark.
Nach nichts sehnen wir uns derzeit mehr als nach Normalität: Mal wieder Freunde einladen, Bekannte auf ein Bier treffen, Fremde im Supermarkt ohne Maske anlächeln. Spontan ins Kino gehen oder ins Schwimmbad. Lauter kleine Freuden, die uns derzeit verwehrt sind und die den meisten wohl mehr fehlen als die große Freiheit des Abenteuerurlaubs.
Hoffen auf ein Ende des Ausnahmezustands
Ja, die Rückkehr zum Vertrauten, Normalen – angesichts des weltweiten Ausnahmezustands erscheint sie vielen gerade wie das höchste aller Gefühle.
Vielsagend in dieser Hinsicht das hörbare kollektive Aufatmen weltweit seit der Amtsübernahme von Joe Biden als US-Präsident. Jetzt herrscht im Weißen Haus wieder ein ziviler Tonfall, Wut und Furcht sind nicht mehr die maßgeblichen Emotionen. Und auf die drängendsten Probleme der Zeit – die Klimakrise, die Pandemie – werden wieder wissenschaftsorientierte Antworten gesucht. Alles wenig mehr als eine Rückkehr zur Normalität – die aber mit fast euphorischer Erleichterung aufgenommen wurde.
Maßnahmen für die Mittelschicht
Die Orientierung an der Normalität birgt allerdings Fallstricke, und die sind, wie so vieles, gerade in der Pandemie besonders deutlich geworden: Der unterschwellig leitende Gedanke bei fast allen Maßnahmen gilt der durchschnittlichen Mittelschicht. Alle bisherigen Lockdown-Bemühungen lassen sich mit dem britischen Journalisten JJ Charlesworth giftig beschreiben als "Leute aus der Mittelklasse, die sich verstecken, während ihnen Menschen aus der Arbeiterklasse Sachen bringen".
Auch wenn es um staatliche Hilfen geht, wird immer zuerst und zumeist gedacht an "die Wirtschaft", den ganzen bürgerlichen Bereich der Betriebe, Arbeitgeber, der Selbständigen – und erst sehr viel später an den Niedriglohnsektor oder gar an die ganz Armen oder Arbeitslosen. Sie sind zwar Teil der Realität und damit der Normalität, aber eben nicht in dem Sinn, dass ihre Lebenswirklichkeit von der Gesellschaft oder Politik als leitend oder maßgeblich aufgefasst wird.

Armut in einem reichen Land ist nicht "normal", sagt Catherine Newmark.© Johanna Ruebel
Die Idee der Normalität ist wie auch diejenige der Norm, von der sie sich ableitet, seit jeher von einer ganz grundlegenden Zweideutigkeit geprägt: Einerseits ist der Normalfall schlicht der durchschnittliche Fall, das, was wir am meisten gewohnt sind. Andererseits soll er auch der wünschenswerte Fall sein.
Ist normaler auch besser?
Mit anderen Worten: Wir wollen das Normale, weil das Normale das Gute und Richtige ist – zumindest ist diese Verbindung gedanklich in dem Begriff schon angelegt. Und mit Bezug auf Schwimmbäder oder US-Präsidenten stimmt es ja auch: Es ist normaler und besser, wenn sie offen sind – oder ganze Sätze in verbindlichem Tonfall aussprechen können.
Die innere Verbindung des Durchschnittlichen oder Gewohnten mit dem Wünschenswerten ist aber auch problematisch. Nicht zuletzt, weil sie die Ränder nicht gut in den Blick bekommt, ja möglicherweise diese Ränder erst hervorbringt – um sich dann vehement von ihnen abzugrenzen.
Die Armen haben keine Lobby
Diejenigen, die in unserem Wirtschaftssystem unten und gesellschaftlich am Rand stehen, haben nicht nur viel seltener eine Stimme von Gewicht oder gar eine Lobby, sie werden auch oft ganz dezidiert moralisch aus der Vorstellung des Normalen herausdefiniert.
Es ist kein Wunder, dass eine Krise, die alle trifft, die Armen besonders hart trifft. Es ist aber leider auch kein Wunder, dass die Gegenmaßnahmen, die gesellschaftliche Sorge, ihnen viel zu lange viel zu wenig gegolten hat.
Das muss sich ändern. Denn normal ist es nicht, wenn in einem reichen Land wie Deutschland Kinder vom Hunger bedroht sind, sobald das warme Schulmittagessen ausfällt.