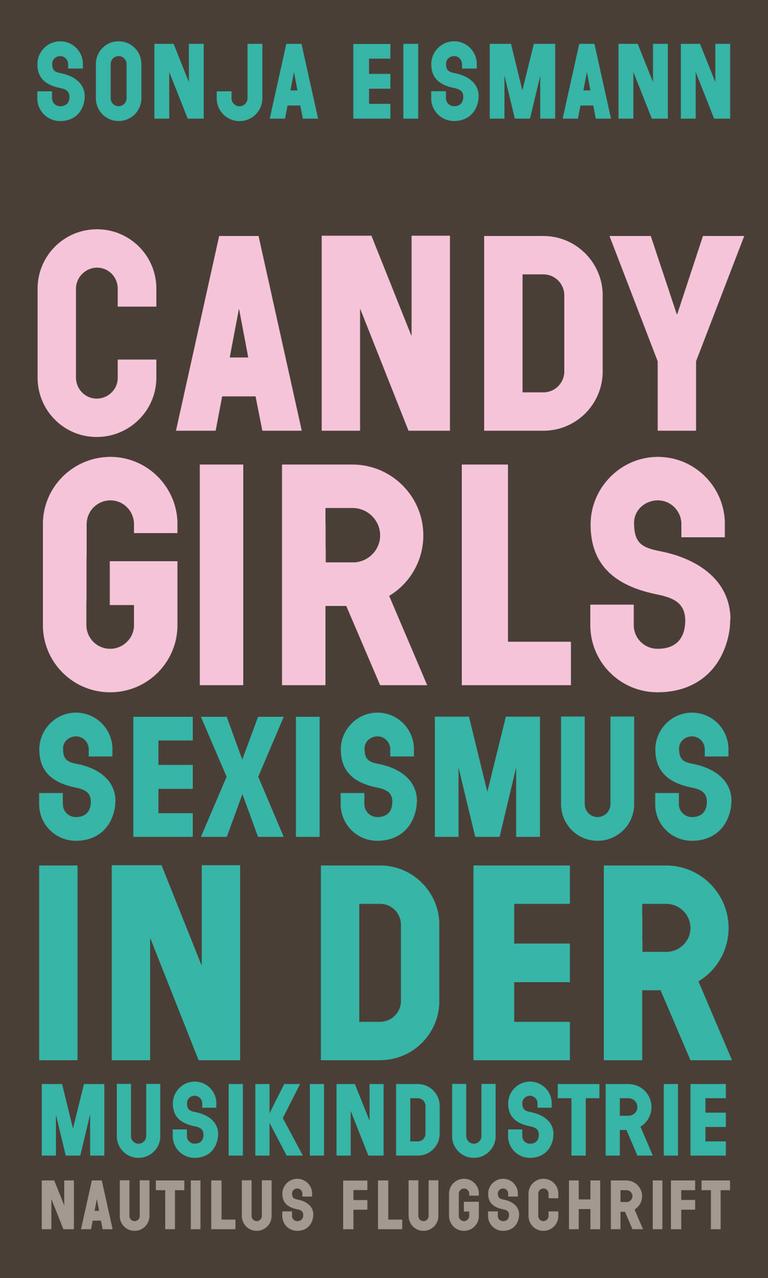"Die gesamte Musikindustrie basiert fast ausnahmslos darauf, dass jugendliche, normschöne Frauenkörper als quasi unendliche Ressource zur Verfügung stehen, an denen sich der öffentliche männliche Blick (den im Übrigen nicht nur Männer, sondern alle kulturell erlernt haben) labt. Das ist, so traurig und banal es klingt, die Grundvoraussetzung von Pop: Frauen(körper), zwangsläufig jugendlich und sexy aussehend, sind das Rohmaterial, aus dem alles entsteht."
Mitte der 1960er-Jahre wurde die damals 18-jährige France Gall mit dem Lied „Les Sucettes“ bekannt, übersetzt: "Die Lollies". Geschrieben hat dieses Lied Serge Gainsbourg, ein Text voller Doppeldeutigkeiten. Im Video sieht man France Gall lasziv an einem Lolli lutschen, daneben tanzen Menschen in Säcken, die aussehen wie sich im Takt wiegende Penisse. Später sagte France Gall, dass sie gar nicht gewusst hatte, wovon sie da eigentlich singt.
Der zugängliche Frauenkörper als Ressource von Pop
Das ist nur eines von vielen Beispielen, die die Musikjournalistin Sonja Eismann in ihrem Buch „Candy Girls“ anführt, ausgelöst durch die Anklagen gegen Rammstein und P. Diddy. Allein über die Glorifizierung von Femiziden im Pop hätte sie ein ganzes Buch schreiben können, sagt sie im Deutschlandfunk. Aber das sei ihr dann doch zu hart gewesen.
"Ich habe mich dann auf verschiedenste Aspekte konzentriert und eben festgestellt, dass Popmusik nicht nur in ihren Machtstrukturen ganz stark männlich geprägt ist, sondern dass der junge weibliche, zugängliche Frauenkörper, der ist sozusagen einerseits die Ressource von Pop, darum geht es ganz viel. Das sind auch die Bilder, die wir sehen, toll aussehende junge Frauen, wie eben Sabrina Carpenter oder auch Billie Eilish. Und andererseits werden aber genau diese jungen Mädchen, die sich für Pop begeistern, zu Konzerten gehen, die Platten kaufen, die werden als das absolut lächerliche, dumme, unwissende Geschlecht dargestellt, über das man sich im Pop lustig macht. Und das ist so tief in uns verankert, dass wir das gar nicht mehr hinterfragen."
Sonia Eismann
Taylor Swift, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Chapell Roan, Lady Gaga, Ava Max, Miley Cyrus, Billie Eilish: Voll weiblich die aktuelle Musikszene, lauter selbstbewusste, erfolgreiche Frauen, könnte man meinen. Wenn man sich dann aber mal die Charts anschaut, wird schnell ein anderes Bild deutlich. Frauen, beziehungsweise nicht männlich gelesene Künstler*innen, werden in der Popmusik diskriminiert, unterdrückt, benutzt und sexualisiert.
Spiegel einer noch immer sexistischen Gesellschaft
Das belegt Sonja Eismann in ihrem Buch „Candy Girls“ mit erschreckend vielen Beispielen aus der Popmusik des letzten und des aktuellen Jahrhunderts und mit wissenschaftlich belegten Zahlen und Studien.
Dabei beginnt das Problem schon im Teenageralter, schreibt sie. Jungs würden so gut wie nie Musik von Frauen hören, weil es als uncool gilt, und wer zum Beispiel Taylor Swift hört, sei ein Mädchen. Wobei die Bezeichnung „Mädchen“ in dem Fall natürlich als Schimpfwort benutzt wird.
"Pop kann ganz vieles sein, aber es ist vor allem auch ein Spiegel unserer Gesellschaft und dann aber eben auch noch mal so eine Art Brennglas. Also es wird gespiegelt, wie sexistisch die Gesellschaft eigentlich immer noch ist, wie tief drin diese ganzen Stereotypen noch in uns sitzen. (...) Und erst wenn man darüber nachdenkt und das noch mal in seine Einzelteile zerlegt, dann fällt einem eigentlich auf, was uns da ständig, wenn wir mitträllern, mitgegeben wird an Bildern.
Frauen, die sich anmaßen, sich öffentlich sicht- und hörbar zu machen, zumal in einem Feld wie der Musik, in dem trotz hoher weiblicher Präsenz die Expertise immer noch auf der männlichen Seite verortet wird, werden nicht nur erbarmungslos be-, sondern oft auch gleich verurteilt. Die Expertise ist immer auf der männlichen Seite, sei es beim Publikum oder den Kreativen."
Sonia Eismann
All das, was Sonja Eismann in ihrem Buch schreibt, sind keine Geheimnisse, eigentlich ist alles seit Jahren bekannt. Das jetzt aber auf 180 Seiten zusammengetragen zu sehen, schockiert, zu sehen, wie sehr die Popkultur infiziert ist.
Repräsentation von Frauen steht noch ganz am Anfang
Natürlich gibt es auch positive Beispiele, die Eismann in ihrem Buch festhält: Festivals, die bewusst auf eine ausgeglichene Künstler*innen-Quote bei Festivals achten, nonbinäre Personen, die in der Popmusik immer sichtbarer werden und Frauen, die ganz natürlich über die Wechseljahre singen.
In puncto Repräsentation sei schon Einiges erreicht, sagt Sonja Eismann, zeigt aber auch, dass wir noch ganz am Anfang stehen. Ihr Buch „Candy Girls“ ist wichtig, damit sich das ändert.