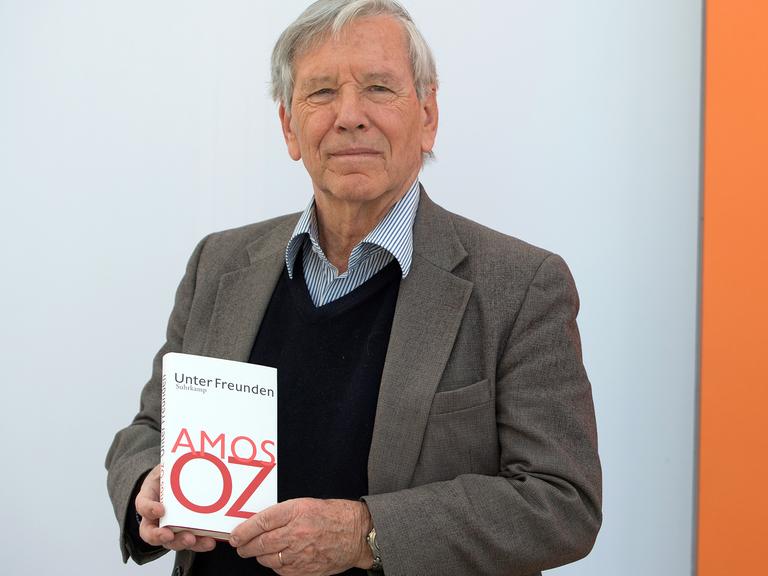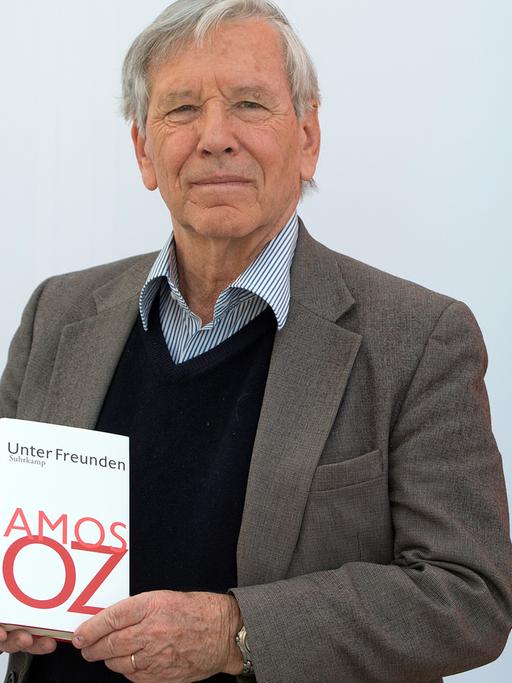Schrottkunst aus dem Kibbuz

In israelischen Kibbuzim trifft man gelegentlich auf sogenannte "junkyards". Auf diesen Schrottplätzen entstehen aus Alltagsgegenständen neue Lebenswelten. Die Ausstellung "The Rough Law of Gardens" in Bochum setzt sich damit auseinander.
Kinder schleppen alte Kunststoffkanister und Holzbretter durch die Gegend, greifen ausrangierte DVD-Player aus verbogenen Stahlregalen oder rollen rostige Metallfässer über den Sandboden. Man fühlt sich zunächst an Szenen aus der Dritten Welt erinnert. Doch sie stammen aus den Kindergärten israelischer Kibbuzim. Dort trifft man gelegentlich auf sogenannte "junkyards", also Schrottplätze. Bewusst eingerichtet, dienen sie als kreative Spielwiese. Die Kinder arrangieren die aussortierten Alltagsgegenstände zu neuen Lebenswelten: Kletterlandschaften, Kochplätze oder Tische zum Zeichnen. Der deutsche Künstler Olaf Holzapfel hat den "junkyards" der Kibbuzim einen 20-minütigen Film gewidmet. Im Bochumer Kunstmuseum ist er in einem eigens errichteten Kinosaal zu sehen.
"Die Leute, die die Kibbuzim gegründet haben, kamen ja aus verschiedenen Teilen Europas, aus Russland, aus der Ukraine, aus Deutschland, teilweise auch aus dem Irak. Und in diesen Kibbuzim haben die Leute sehr konkret verschiedene Weltanschauungen miteinander verhandelt oder mussten neue Entwürfe machen und mussten neue Architekturen entwickeln. In einer sehr reduzierten Form findet man das in diesen Kindergärten auch wieder."
Vier Jahre lang hat Olaf Holzapfel die "junkyards" in drei israelischen Kibbuzim begleitet. Als Maler und Bildhauer interessierte ihn vor allem, wie die Kinder mit den ausgedienten Materialien umgehen und damit den Raum gestalten. Dementsprechend ist Holzapfels Film nicht dokumentarisch angelegt, sondern eher künstlerisch-experimentell: Er zeigt bewegte Sequenzen, in denen die Kinder ihr Spiel auf dem Schrottplatz organisieren. Man sieht aber auch collagierte Detailaufnahmen der neu errichteten Müll-Architekturen: Stoffdächer, Holzpyramiden oder Autoreifen, in denen Plüschtiere aufbewahrt werden.
"Das ganze Kibbuz-Konzept ist absolut Avantgarde"
Im Hintergrund hört man hebräische Kommentare der deutsch-jüdischen Pädagogin Malka Haas. 1920 in Berlin geboren, wanderte sie 1935 nach Israel aus, wo sie zusammen mit deutschen Freunden den Kibbuz Sde-Eliyahu gründete. Dort entwickelte sie auch das Modell des "junkyards". Eine damals neuartige Erziehungsmethode für Kinder.
Galia Bar Or: "Warum es wichtig war, den junkyard zu entwickeln, liegt einerseits darin begründet, dass er es ermöglicht, die Persönlichkeit eines jeden Kindes zu fördern und in einer innovativen Weise mit Problemen der Realität zurechtzukommen. Das Andere ist die Zusammenarbeit. Denn die Kinder bauen oft ziemlich komplizierte und schwere Dinge. Und um sie zu erreichen, ist eine Zusammenarbeit unerlässlich."
Holzapfels Film übersetzt alle eingestreuten hebräischen Kommentare von Malka Haas erst im Abspann. Als Block in Englisch:
"We choose local materials, with which the children express and project their toughts and feelings. So, the junkyard reflects the life we live. This is why I insist that the kindergarten is defined in accordance with the place the children live in."
Hier bleibt Holzapfels Film inkonsequent: Er will nicht dokumentarisch sein, ist es aber doch. Davon abgesehen ist dem Künstler insgesamt aber eine stille, poetische Bilderreise in die Welt der Schrott-Spielplätze geglückt. Holzapfel sieht im israelischen "junkyard" eine Metapher für den Kibbuz als idealer Lebensform überhaupt:
Holzapfel: "Das ganze Kibbuz-Konzept ist absolut Avantgarde, immer noch. Ich meine, die haben bis heute so was wie bedingungsloses Grundeinkommen, also so was, wo wir diskutieren hier, ob das überhaupt möglich ist, das existiert dort schon seit 50 Jahren, nämlich eine Grundabsicherung und eine Gleichbehandlung von verschiedenen Berufen. Die Direktorin des Museums kriegt genauso viel Geld wie der, der in der Landwirtschaft arbeitet. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass man sich mit den Grundbedürfnissen beschäftigt, was die Menschen brauchen und diesen Stress rausnehmen, der teilweise auch aus den Hierarchien entsteht, die künstlich geschaffen werden durch Besitz."
Der israelische Künstler Nahum Tevet hingegen verbindet mit den "junkyards" der Kibbuzim keine sozialromantischen Gesellschaftsutopien. Er ist sich sicher:
"Ich kann nur eines sagen: Meine Kunst hat nichts mit Malka Haas zu tun."
Die Einflüsse der Bauhaus-Architektur
Das ist merkwürdig. Denn die Bochumer Ausstellung suggeriert, dass gerade Holzapfels Film über die "junkyards" das "verbindende Element" zu Tevets Werken sei. Und in Tevets 7x21 Meter großen Installation "Several things" scheint sich das Chaos des Schrott-Spielplatzes auch widerzuspiegeln: Ein Labyrinth aus bunt bemalten quadratischen und rechteckigen Kästen, Zylindern, Platten, Rahmen und Stäben – mal isoliert in den Raum gestellt, mal zu Ensembles arrangiert. Doch der Wirrwarr aus Möbelstücken folgt strengen geometrischen Prinzipien. Die Kästen sind sauber übereinandergestapelt oder stehen im rechten Winkel zueinander. Dadurch wirkt die Installation reduziert und ruhig – und erinnert an ein begehbares Architekturmodell der russischen Konstruktivisten oder der Bauhaus-Vertreter. Und tatsächlich ist Tevet in einem marxistischen Kibbuz aufgewachsen, der auch seine Arbeit beeinflusst hat:
Nahum Tevet: "Es hat damit zu tun, dass ich an einem Ort aufgewachsen bin, der vom Bauhaus beeinflusst worden ist. Einige wenn nicht viele Architekten kümmerten sich um die Gestaltung, um Klassenzimmer oder Häuser im Kibbuz. Besonders in diesem linken Kibbuz fanden sich Menschen, die Deutschland verlassen haben, nachdem sie an der Bauhaus-Schule waren. Somit lebte ich nicht nur in einer modernistischen Utopie, was den sozialen Umgang miteinander betraf, sondern auch hinsichtlich der Architektur."
Und auch das flexible Denken und das kreative Lösen von Problemen hat Tevet im Kibbuz gelernt:
Nahum Tevet: "Ich benutze keine ready-mades, also keine existierenden Sachen, wie im Junkyard, sondern baue künstliche ready-mades. So kreiere ich Produktlinien aus Stühlen, Bänken oder Tischen. Sie alle haben Formen, etwa die von Büchern. Aber sie sind alle ohne festen Plan gebaut und bemalt."
Die Spannung der Bochumer Ausstellung "The Rough Law of Gardens" liegt darin, dass sie eine deutsch-israelische Perspektive auf die Welt der Kibbuzim entwirft. Da ist Olaf Holzapfel, der als Deutscher ein uns völlig fremdes pädagogisches Konzept künstlerisch erkundet. Und da ist Nahum Tevet, der in einem Kibbuz aufgewachsen ist und die dort gemachten Erfahrungen künstlerisch weiterträgt. Auch ein Besucher, der selbst in einem Kibbuz groß geworden ist, fühlt sich von der Ausstellung inspiriert:
"Die Idee von Olaf Holzapfel finde ich sehr interessant und brillant. Nahum Tevet verkörpert das in einer ähnlichen Art, das künstlerische Schaffen wie ein Kind zu gestalten. Nicht aus dem Kopf, sondern aus der künstlerischen Empfindung zu arbeiten."
The Rough Law of Gardens. Olaf Holzapfel/NahumTevet. Noch bis zum 25. Oktober 2015 im Kunstmuseum Bochum