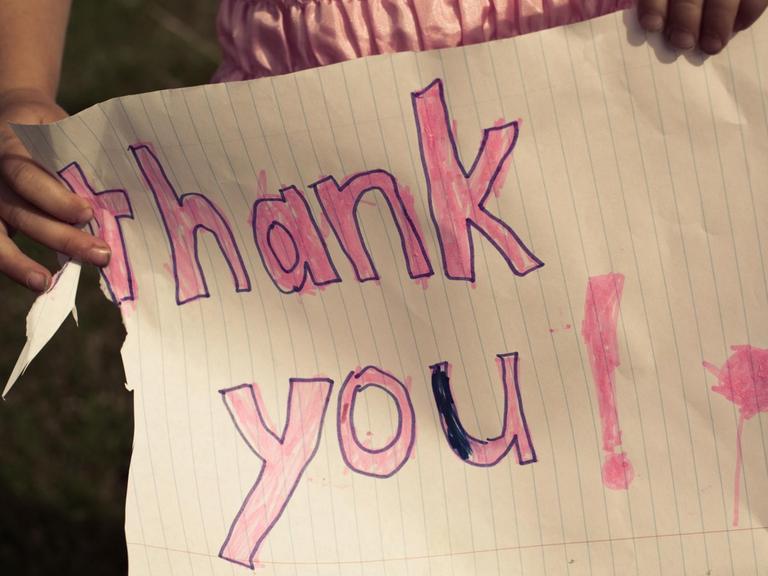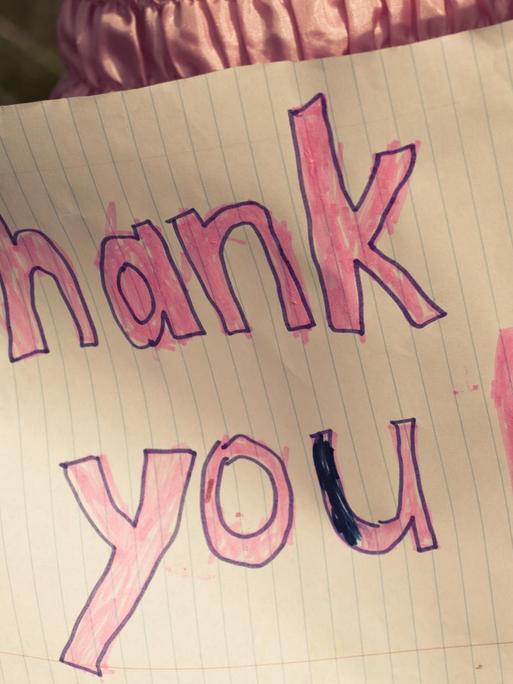Die neue Dankesgeschwätzigkeit
04:15 Minuten

Gegen Danksagungen an sich ist nichts einzuwenden. In der Literatur jedoch, findet die "Welt", haben sie sich verselbständigt, zu devoter Prosa. Seitenweise werde da ausgebreitet, was dem Autor nach Verlassen der Kita half, das Werk zu vollenden.
Falls Sie diese Sendung in Stereo hören, sagen Sie es bloß nicht dem französischen Musikproduzenten, Komponisten, Klangteppichweber und Synthesizer-Star Jean-Michel Jarre. Denn der regt sich über Stereo richtig auf: "Soll ich Ihnen erklären, was für ein unfassbarer Betrug das Stereo-System ist?" Das sagt er dem Interviewer der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG.
Doch Stereo ist nur eine Nebensache in dem langen Gespräch, dessen Anlass in einer noch nicht eröffneten Fotoausstellung über den brasilianischen Regenwald besteht, zu der Jarre etwas komponiert hat, obwohl er noch nie im Regenwald war. Aber Fellini soll ja auch gesagt haben: "In meinen Werken geht es um meine Vorstellung von der Welt, nicht um die Dinge selbst."
Da die typische Jarre-Musik immer etwas psychedelisch wirkt, liegt die Frage nach seinem Drogenkonsum nahe, aber da erfährt man aus dem Gespräch Erstaunliches: "In meiner Teenagerzeit habe ich einmal mit einem sehr guten Freund eine Party besucht. Dort haben wir ohne unser Wissen eine große Dosis LSD abbekommen. Mein Freund ist auf dem Trip hängengeblieben, und er kam nie zurück. Das hat ein Trauma bei mir ausgelöst."
Ein Urheberrecht für die Ewigkeit
Inzwischen ist der einstige Lover von Charlotte Rampling und Isabelle Adjani 72 und beschäftigt sich mit der Dimension der Ewigkeit – in einer ganz bestimmten Hinsicht, nämlich beim Urheberrecht. Jarre träumt von einem ewigen Copyright, das auch nach dem Tod der Halter nie erlischt: "Stellen Sie sich vor, die Tantiemenpflicht für ältere Werke würde nicht verschwinden, sondern das Geld würde stattdessen in einen nationalen Kulturfonds fließen. Der würde genutzt, um junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern."
Ein Traum für alle Kulturbürokraten, Fondsverwalter, Gremienmitglieder und Kuratoriumsvorsitzende. Sie können Jarre schon mal ihren Dank abstatten. Was uns gleich zu weiteren Formen von Danksagungen führt, und zwar literarischen. Rainer Moritz nimmt sich in der WELT diese nicht nur florierende, sondern wachsende und wuchernde Textgattung vor, gespickt mit Beispielen.
Devote Dankesprosa
Gegen Danksagungen an sich ist ja nichts einzuwenden, aber das Danken, findet Moritz, hat "sich mittlerweile verselbständigt und unangenehm ausgeweitet, ist zu einem Stück devoter Prosa geworden, das einem die Freude am zuvor Gelesenen vergällen kann. Auf drei, vier Seiten oft wird da ausgebreitet, wer und was dem Autor nach Verlassen der Kita half, das vorliegende Werk zu vollenden."
Diese Dankesgeschwätzigkeit kommt nach Auffassung des Autors aus der angloamerikanischen Ecke, wo es schon fast zum guten Ton gehört, Dutzende von Menschen zu benennen, die dem Autor oder der Autorin irgendwie geholfen haben, etwa der "brillanten Lektorin" oder den "Park Rangers im Joshua Tree National Park" oder zur Abwechslung auch mal den schriftstellerischen Treibstoffen Bourbon oder Wodka.
Kollegenschelte für Haiti-Bild
Auf Haiti wäre vielleicht noch der Rum zu nennen, aber das ist nicht das Thema, das der halbe Haitianer Hans Christoph Buch in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG behandelt. Er nimmt Bezug auf einen Artikel in der vorletzten ZEIT, dessen Autorin er "Chuzpe, Faktenleugnung oder Realitätsverkennung" vorwirft.
In der ZEIT hatte nämlich sinngemäß gestanden, dass das Leben in Haiti eigentlich prima sei und nur von auswärtigen Besuchern schlecht geschrieben werde. Immerhin gebe es einen normalen Alltag mit lachenden Kindern in Schuluniformen. Dagegen hält Buch fest, "dass die Schüler riskieren, gekidnappt und ermordet zu werden, wenn ihre Eltern, meist alleinerziehende Mütter, das geforderte Lösegeld nicht aufbringen."
Buch verweist auf die korrupte Regierung, darauf, dass ein Großteil der Waffen- und Drogenschmuggler aus der Polizei stammt, und erwähnt, dass der Präsident der benachbarten Dominikanischen Republik quer durch die Insel eine Mauer bauen lassen will, um sein Land vor den Haitianern zu schützen.
"Unter diesen Umständen vom 'vermeintlichen Elend' zu sprechen, an dem der 'westliche Blick' schuld sein soll, zeugt von ideologischer Verblendung oder, schlimmer noch, von umgekehrtem Rassismus, der böse weiße Männer für alle Übel der Welt verantwortlich macht", schreibt der FAZ-Autor an die Adresse seiner ZEIT-Kollegin.