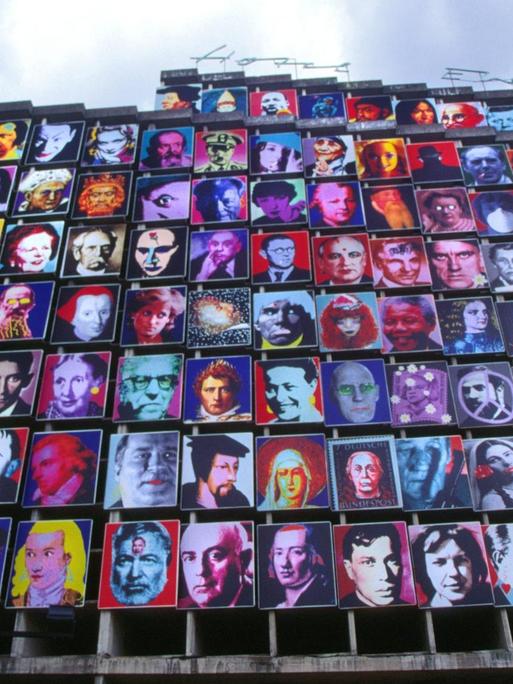Das polemische Gewicht der Wörter
04:17 Minuten

"Sprache macht den Menschen aus", schreibt Ulla Hahn in der "FAZ". Da Vereinfachung und Überspitzung zu verletzender Polemik führen könnten, solle jeder Worte öfter auf die berühmte Goldwaage legen, mahnt die Dichterin.
Hören Sie Radio? Dumme Frage. Aber es gibt gute Nachrichten für Sie: "Stimmen hören fördert Ihre Gesundheit." Davon ist zumindest Sandra Kegel in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG überzeugt. Ihr Anlass: Hundert Jahre Hörspiel – und die coronabedingte Renaissance dieses Mediums, das Sandra Kegel so skizziert: "Hörspiel ist, wenn Kunst auf Technik trifft, Experiment auf Unterhaltung." Außerdem meint sie: "Im Hörspiel spiegelt sich eine Kulturgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts."
Das war es dann aber auch schon mit den guten Feuilleton-Nachrichten. Als "Urkatastrophe" eben jenes 20. Jahrhunderts bezeichnen Historiker gern den Ersten Weltkrieg. Es gibt schon verschiedene Kandidaten für die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts – 9/11 etwa oder der Irak-Krieg. In der WELT meint Kai Burkhardt: Es waren die Jugoslawienkriege. Auch er hat einen kalendarischen Anlass: "Am 30. Juni 1995 schickt Deutschland Soldaten auf den Balkan."
Die Jugoslawienkriege als "Urkatastrophe"
Burkhardt argumentiert medien- und kommunikationshistorisch. Die Jugoslawienkriege waren demnach "die letzte Identitätskrise Europas vor dem Eintritt ins Social-Media-Zeitalter. Sie haben das Entstehen neuer kultureller Gegensätze beschleunigt und die Bindungskraft politischer Parteien so weit abgeschwächt, dass ungebundene und politisch nicht mehr repräsentierte Milieus entstanden sind, deren einziger gemeinsamer Nenner bis heute ist, dass sie kontinuierlich mobilisiert werden wollen."
Die Entstehung dieser Milieus, meint Burkhardt, "schreiben wir heute fälschlicherweise in großen Teilen der Geschwindigkeit des Internets und besonders sozialen Medien zu. Doch in Wirklichkeit war die geistige Entwicklung abgeschlossen, bevor Social Media überhaupt erfunden war, und das hat", meint er, "viel, wenn nicht sehr viel mit den Jugoslawienkriegen der 1990er-Jahre zu tun."
Burkhardts zentrales Argument lautet: "Mindestens drei große geistige Strömungen des beginnenden Jahrtausends sind direkt oder indirekt durch den Bürgerkrieg auf dem Balkan beeinflusst: ein vulgärer Nationalismus, die Aufwertung der Privatsphäre zum politischen Raum für politisch nicht repräsentierte Gruppen und schließlich ein politischer Irrationalismus, dessen offensichtlichster Vertreter Donald Trump ist."
Nur Bildung verhindert Radikalisierung
Und sein Fazit: "Die Jugoslawienkriege haben die westlichen Länder neu strukturiert." Dabei sind "Gruppen und Meinungen ins Licht (ge)kommen, über die diejenigen, die progressive Veränderungen anstreben, vermutlich lieber den Mantel des Schweigens gebreitet hätten. Es ist die Gefolgschaft der Populisten, und die einzige Möglichkeit, ihre Radikalisierung zu verhindern, sind Bildung, Aufklärung und nochmals Bildung."
Und das hat viel mit Sprache zu tun – besonders mit Blick auf populistische Positionen. "Sprache macht den Menschen aus", schreibt die Dichterin Ulla Hahn in der FAZ. Sie leitet daraus aus aktuellem Anlass – Stichwort: die taz, der Müll und die Polizei – "eine ganz besondere Verantwortung für jeden Demokraten" ab.
Vom "Volksempfänger" zu Twitter
Gerade in der Vereinfachung und Überspitzung liege "eine gefährliche Verlockung zu täuschender und verletzender Polemik. Das Wort auf die Goldwaage legen", mahnt die Poetin im Feuilleton, "das gilt nicht nur für Poeten."
Sie verweist auch auf die Sprachgewalt – im Wortsinn – durch die Nazis im Allgemeinen und Goebbels im Besondern, der, so Ulla Hahn, "Radio und 'Volksempfänger' zu missbrauchen wusste wie heutzutage gewisse populistische Politiker Twitter."
Womit wir plötzlich bei der gefährlichen, bedrohlichen Seite des Radios wären, der immerhin, wie schon erwähnt, das gute alte, nämlich 100 Jahre alte Hörspiel gegenübersteht. Noch einmal Sandra Kegel:
Hörspiel ist wie Film im Kopf
"Die menschliche Stimme ist nichts als ein Hauch, ein Luftstrom nur und doch so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. Die großen Sprechkünstler haben ihren Stimmapparat entsprechend trainiert, um aus dem unerschöpflichen Reservoir an Lauten die perfekte Illusion entstehen zu lassen. Ihr ureigenes Terrain ist das Hörspiel, und ihre Kunstfertigkeit liegt darin, über ihre Stimmen im Zusammenspiel mit Technik den Film im Kopf zum Laufen zu bringen. In Zeiten von Corona wird diese mediale Besonderheit gar zur künstlerischen Überlebensstrategie. Denn von allen Künsten ist das Hörspiel das einzige, das durch das Virus keiner Rezeptionsbeschränkung unterliegt."
Und denken Sie dran – wenn's nicht grade der "Volksempfänger" ist, sondern Ihr gutes altes Radio, kann immer wieder mal gelten: "Stimmen hören fördert Ihre Gesundheit."