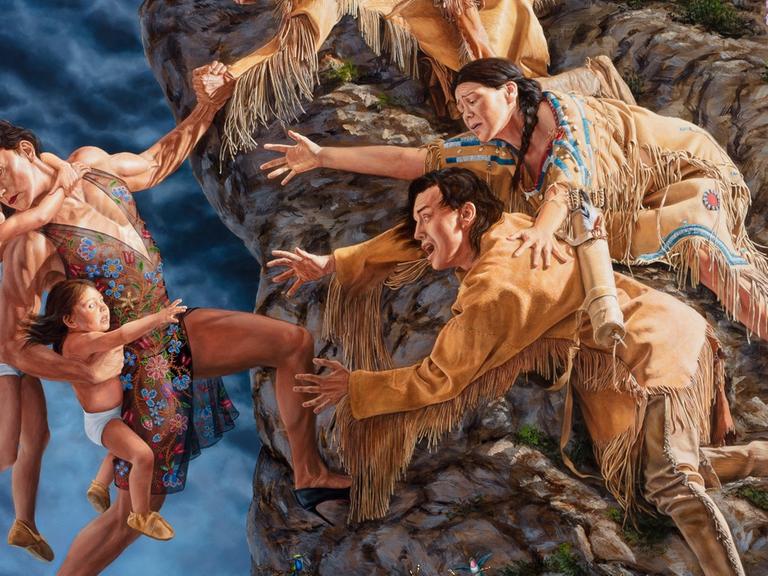Der fast vergessene Terrorakt
05:53 Minuten

Vor 50 Jahren wurde in München ein Brandanschlag auf ein Wohnheim der Israelitischen Kultusgemeinde verübt. Sieben Holocaust-Überlebende starben. Bis heute ist der Fall ungeklärt. Der Opfer wird nun auf ungewöhnliche Art und Weise gedacht.
Es ist ein schnöder, blauer Bau-Container, ein bisschen plump steht er vor dem Gründerzeittheater am eleganten Münchner Gärtnerplatz – behängt mit großformatigen Schwarz-weiß-Fotografien vom Tatort Reichenbachstraße 27.

Bisher gibt es in München keinen Gedenkort für den bis heute ungeklärten Brandanschlag auf die Bewohner des jüdischen Wohnheims.© Daniel Schvarcz
"Wir hatten als Material die Fotos von der Branddirektion sowohl von der Nacht, von dem, was die Passanten in der Reichenbachstraße gesehen haben – das haben wir außen auf den Container groß draufgemacht. Und wir hatten die Fotos, die so etwas wie Tatortfotos sind, von diesen verbrannten Zimmern, wo man im Prinzip sieht, da waren gerade eben noch Menschen beim Essen", erklärt Alfred Küng.
Küng ist Ausstellungsmacher. Zusammen mit seiner Kollegin Katharina Kuhlmann hat er den Gedenkcontainer gestaltet. Durch eine Schaufensterscheibe kann man an der einen Seite in das Innere des Containers sehen – die Fotos aus den Wohnungen der Toten – einen Tag nach dem Anschlag.
"Was ich so unglaublich an diesen Bildern finde, ist, dass man zum einen natürlich die Spuren von diesem Brand sieht, aber zum anderen immer noch Dinge, die gerade noch dieses Leben waren, also der Kleiderschrank, in dem noch die Klamotten hängen, oder der Kerzenleuchter, oder ein Teller voller Löschwasser, wo die Leute so rausgerissen sind. Sie waren gerade noch da und man sieht noch ganz viele Spuren. Aber dieser Brandhorror ist ganz extrem spürbar", beschreibt Katharina Kuhlmann.
Holocaust-Überlebende ohne Polizeischutz
Es war ein Brandanschlag, der sieben Menschen das Leben kostete. Holocaust-Überlebenden, die in diesem Wohnheim ihrer jüdischen Gemeinde eine Bleibe gefunden hatten. Im Hinterhof befand sich die damalige Münchner Synagoge. Ein Terrorakt, dessen Konsequenzen bis heute in ganz Deutschland zu sehen sind. Bernhard Purin ist Historiker und Leiter des Jüdischen Museums München:
"Es war wirklich die Zäsur. Das, was wir heute kennen bei jüdischen Einrichtungen, dass Polizeiautos davorstehen, dass es erhöhte Sicherheitszustände, Kameras und vieles mehr gibt, das gab es vor dem 13. Februar 1970 nicht. Da war ein jüdisches Gemeindezentrum genauso betretbar wie ein evangelisches oder katholisches Gemeindezentrum. Und ab dem 13. Februar hat sich das völlig gewandelt. Das war wirklich die große Zäsur, dass auch Juden in Deutschland wahrgenommen haben: 'Wir können nur unter Polizeischutz leben.'"
Und dennoch erinnert sich hier in München kaum jemand an den Anschlag, was nun die Initiative "Schulterschluss" mit ihrem Gedenkcontainer ändern will. Doch wie kommt diese Erinnerungslücke?
Bernhard Purin glaubt: "Es passt nicht zum Image von München, der heiteren Stadt, die sich auch immer so präsentiert – mit Oktoberfest und Sonne und ähnlichen Dingen. Drum will man sich dem nicht wirklich stellen. Und dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass es in Teilen der Gesellschaft zum einen einen latenten Antisemitismus gibt …"
… der zum anderen auch in den linken Münchner Studenten-Kommunen zu einer starken Solidarität mit palästinensischen Terroristen und zu Hass gegen Israel führte. Doch den Täter oder die Täterin, die im Treppenhaus Benzin vergossen und den Fahrstuhl blockiert hatte, fand die Polizei nie. Schon im April 1970 stellte sie ihre Ermittlungen ein.
Beweisstücke und Kondolenzbücher verschwunden
Für den Münchner TV-Kabarettisten Christian Springer, Gesicht der Fernsehsendung "Schlachthof", ein unhaltbarer Zustand. Zumal wichtige Asservaten inzwischen aus der Asservatenkammer der Polizei verschwunden sind. Springer hatte die Idee mit dem Container, weil er nicht nur eine Wiederaufnahme der Ermittlungen fordert, sondern gewissermaßen auch eine Wiederaufnahme des Gedenkens, das es ganz am Anfang sehr wohl in München gegeben habe.
"Die Stadt München war komplett im Aufruhr. Das Kondolenzbuch, das in der Reichenbachstraße 27 auslag – wenn Sie die Bilder davon sehen – wie viele Leute dafür angestanden sind, bis hinter zur Fraunhoferstraße, sechsreihig – das ist unglaublich. Auch übrigens: Es verschwindet nicht nur was aus der Asservatenkammer. Ich wollte die Kondolenzbücher sehr gerne ausstellen. Die sind nicht mehr zu finden, nicht im Stadtarchiv, nicht in der Israelitischen Kultusgemeinde. Dinge, die vor 50 Jahren passiert sind, da verschwinden einfach im Lauf der Zeit Dinge", sagt Springer.
Zum 50. Jahrestag steht nun erst einmal der Container ein paar Häuser weiter auf dem Gärtnerplatz – und stört die Sichtachse im Szeneviertel. "Als wir aufgebaut haben, kam schon einer vorbei und hat gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass wir jetzt den Gärtnerplatz so verschandeln. Das war wirklich unglaublich", sagt Katharina Kuhlmann. "Und schon beim Aufbau hatte ich das Gefühl, es geht keiner dran vorbei", meint Alfred Küng.
Und tatsächlich. Ständig bleiben Leute an diesem Vormittag stehen und lesen den kurzen Text: "Ich war mir bewusst, dass da das jüdische Gemeindehaus ist und ich fand das auch ganz furchtbar schrecklich damals", erinnert sich eine Frau, und ein Mann sagt: "Ich wusste nichts davon und ich wohne seit zehn Jahren in diesem Viertel. Ich bin selbst Ausländer, aber ich lebe auch da."
In einigen Jahren will die jüdische Gemeinde gemeinsam mit der Stadt München das einstige Gemeindezentrum renoviert haben – und einen festen Gedenkort einrichten.