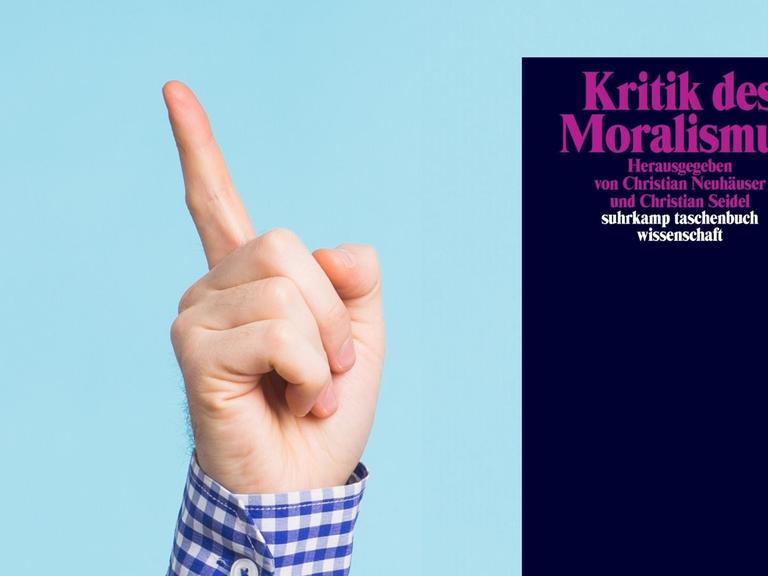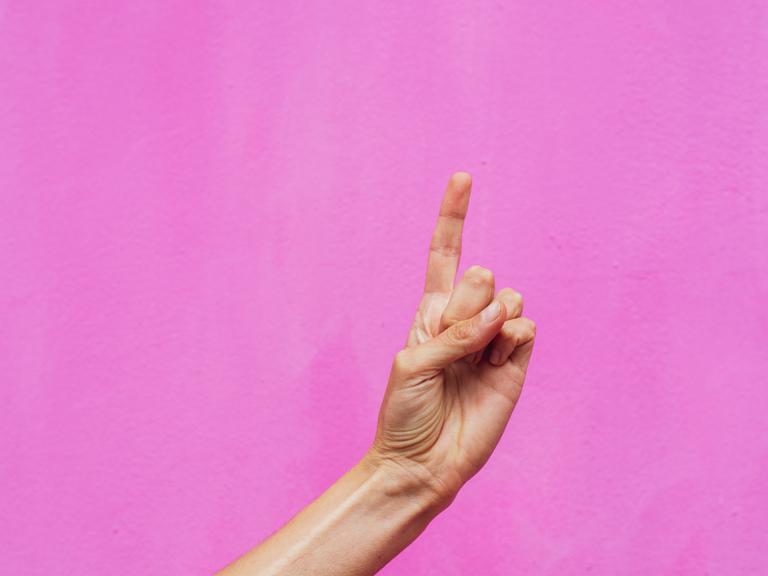„Eigentlich hätte die frisch gegründete Initiative ‚Bunte Perlen Waldheim‘ ihre Demonstration nur anmelden müssen, um die Rechtsextremen zum Ausweichen zu zwingen. Aber die Stadt war damit nicht einverstanden. Man bat die Initiative, einen anderen Ort zu wählen. Es könnte schließlich sein, dass auch die Rechten eine Demo anmelden wollen. Es hörte sich so an, als hätten die in Waldheim Vorrang.“
Anne Rabe: "Das M-Wort"
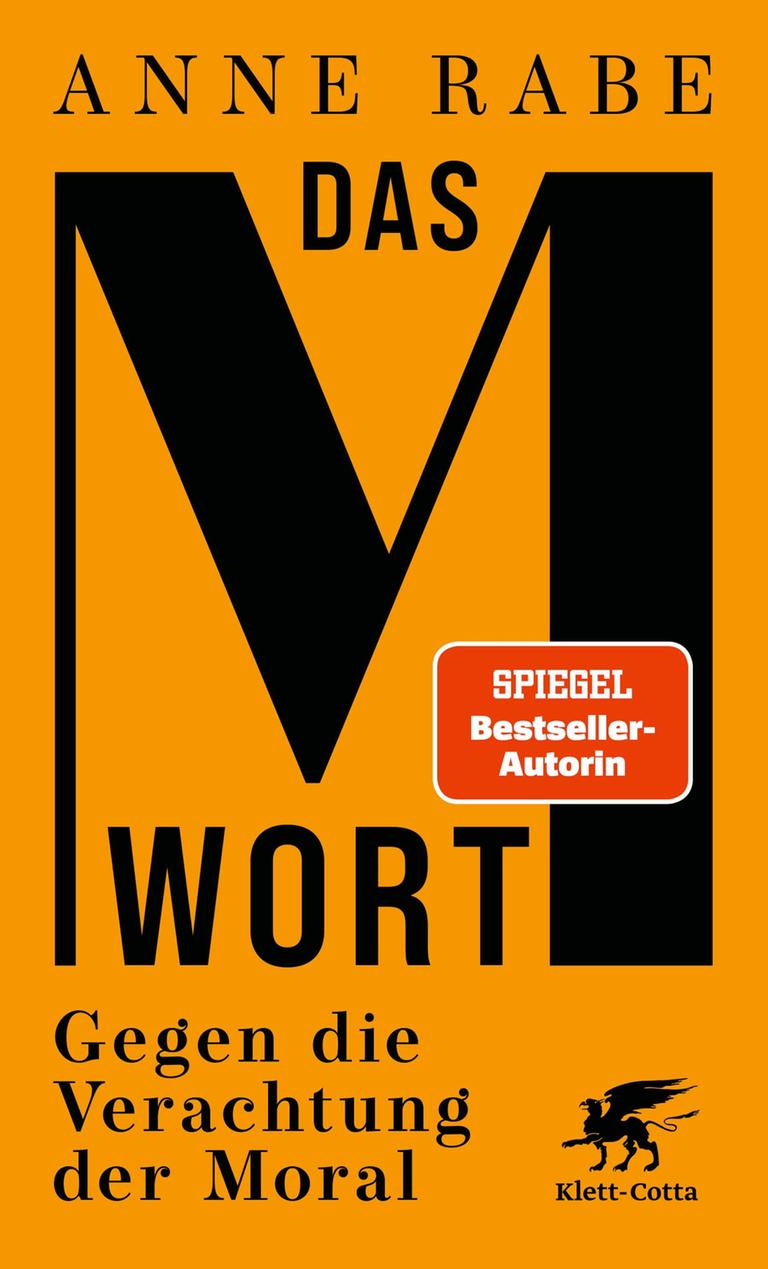
© Klett-Cotta
Eine Verteidigung der Moral
06:56 Minuten
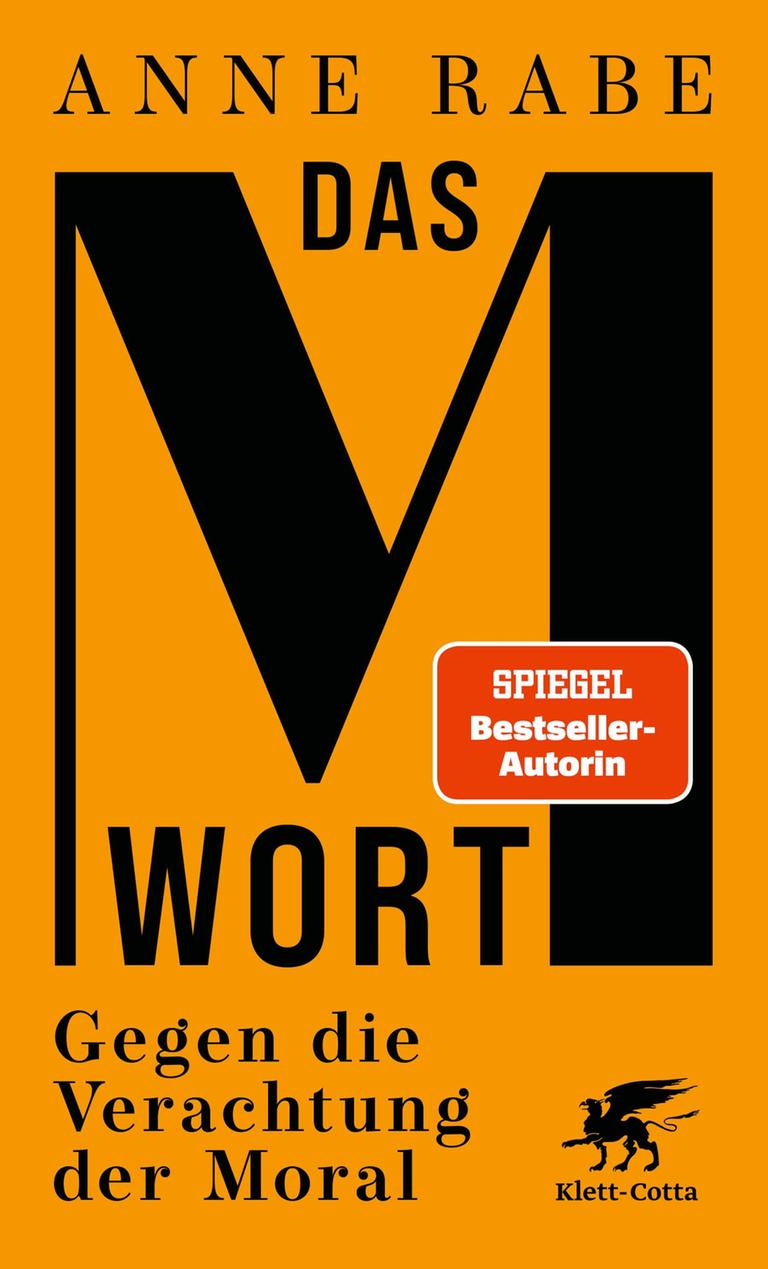
Anne Rabe
Das M-Wort. Gegen die Verachtung der MoralKlett-Cotta, Stuttgart 2025224 Seiten
20,00 Euro
Angesichts der Erfolge rechter Parteien sollten wir uns auf etwas besinnen, was zuletzt oft als verpönt galt – die Moral: Das fordert die Schriftstellerin Anne Rabe in ihrem Essay "Das M-Wort". Sie schreibt mit scharfem Blick und spitzer Zunge.
Zu Hochzeiten der Pandemie fanden vielerorts in Deutschland die sogenannten „Montagsspaziergänge“ statt – „Spaziergänge“, weil Demonstrationen zeitweise verboten waren. Ursprünglich richteten sich diese De-Facto-Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen, schnell bekamen sie aber eine rechte Schlagseite.
In vielen ostdeutschen Städten seien diese Demos nach dem Ende der Pandemie vor allem von Rechtsextremen fortgeführt worden, berichtet die Schriftstellerin Anne Rabe – so auch im sächsischen Waldheim. Diese Demonstrationen seien dort lange Zeit unangemeldet gewesen, dennoch hätten sie ungehindert stattfinden können. Anfang 2024 fanden sich laut Rabe dann einige Waldheimerinnen zusammen, um dem, Zitat, „braunen Treiben“ etwas entgegenzusetzen:
Abdriften nach rechts
In ihrem Essay wirft Anne Rabe ein unvorteilhaftes Schlaglicht auf unsere Gesellschaft, die systemisch und sukzessive nach rechts abzudriften scheint – und in der das moralisch Richtige und Gebotene, so Rabes These, immer weniger zähle. Die Moral ist zwar laut der Autorin immer wieder Gegenstand des gesellschaftspolitischen Diskurses – allerdings nunmehr in Form eines Totschlagarguments gegen progressive Kräfte, die sich ständig gegen den Vorwurf der, Zitat, „Moralkeule“ wehren müssten.
Dies sei eine gezielte und systematische Ermüdungsstrategie konservativer und rechtsextremer Akteurinnen und Akteure, ein Muster, das uns in politischen Diskussionen begegne, „in denen progressive Ideen nicht selten als linke Spinnereien, Gutmenschentum und weltfremder Moralismus abgetan werden, der wahlweise die Natur des Menschen oder aber auch die sogenannten realen Verhältnisse als quasi physikalische Größen im naiven Glauben an eine bessere Welt außer Acht lasse.“
Die Autorin legt den Fokus ihrer Beobachtungen auf Ostdeutschland. Deutlich wird allerdings auch, dass der Verlust moralischer Wertmaßstäbe, die sie in ihrem Essay beklagt, ein gesamtdeutsches Problem ist – und zwar eines, das im Schulterschluss zwischen rechtsgerichteten Akteurinnen und Akteuren und etablierten Parteien wie der CDU, aber auch Teilen der SPD, deren Mitglied Rabe ist, entstanden sei.
Wenn die Zivilgesellschaft zum Schweigen gebracht wird
Zwar gebe es immer noch Lichtblicke, schreibt die Autorin, wie die engagierten Waldheimerinnen, die die Rechtsextremen vor Ort dazu gezwungen hätten, ihre Demonstrationen schließlich doch anzumelden. Aber: Die Zivilgesellschaft wird laut Rabe immer stärker zum Schweigen gebracht. So würde die AfD beispielsweise die prekäre Finanzlage vieler Kommunen ausnutzen, um gemeinsam mit anderen politischen Akteurinnen und Akteuren Gelder für derartige Initiativen streichen zu lassen – und nicht nur das:
„Die Zusammenarbeit zwischen demokratischen Parteien und Rechtsextremen auf kommunaler Ebene ist eben keine Banalität, nichts, was man einfach so hinnehmen dürfte. Das Beispiel, das von den Schulterzuckern gern fantasiert wird, ist ein Kindergartenbau oder die Genehmigung eines Zebrastreifens. Um diese Beschlüsse geht es seltsamerweise bei den Kooperationen jedoch nie, sondern um das Hissen deutscher Flaggen vor Schulgebäuden, das Verbot der Regenbogenflagge und gendergerechter Sprache oder eben die Finanzierung der Zivilgesellschaft.“
Neben den finanziellen Mitteln werde also auch die symbolische Unterstützung zunehmend entzogen. Laut der Autorin ist dabei besonders perfide, dass eben jene Zivilgesellschaft gleichzeitig von der Politik, Zitat, „herbeizitiert“ werde, um sich dem Rechtsextremismus entgegenzustellen:
„Dann wird sie moralisch in die Pflicht genommen: Tut etwas, liebe Bürger, schaut nicht einfach zu. Nie wieder ist jetzt! Das ist eine Aufgabe für jeden einzelnen von uns.“
Luftige Moral-Definition
Mit scharfem Blick und spitzer Zunge schreibt Anne Rabe über den Moralverlust im politischen Raum. In ihrem Essay mit dem unglücklich gewählten Titel „Das M-Wort“ geht es ihr nicht darum, sich theoretisch mit dem Phänomen der Moral auseinanderzusetzen – was moralisch ist, das wird im Buch recht luftig mit einem vermeintlichen, Zitat, „Grundkonsens der demokratischen Welt“ erklärt, also der universellen Menschenwürde und der, Zitat, „schlichten Annahme, dass mein Gegenüber der gleiche Mensch ist wie ich“.
Dabei wird klar: Für die Autorin ist vor allem eine linke Haltung und Politik moralisch geboten. Die verschiedenen Detailaufnahmen im Buch, die davon zeugen, wie rechte Parolen und Vorstöße im Kleinen und Großen salonfähig werden, stützen ihre Argumentation und beunruhigen gleichermaßen.
Ein Essay, der wenig Hoffnung verbreitet
Dagegen fällt das Kapitel über den Pelicot-Prozess in Frankreich mitsamt Rabes Pauschalurteil über das, Zitat, „Problem der Männlichkeit“ aus dem Rahmen. Auch wenn die Autorin darin zu Recht unter anderem vor antifeministischer Diffamierung warnt, überzeugen die provokant formulierten Thesen in der gegebenen Kürze nicht – zum Beispiel diejenige, wonach wir uns als Gesellschaft davor scheuten, unsere, Zitat, „Prägungen eben nicht nur als weibliche Opfer, sondern auch als männliche Täter“ anzuerkennen.
Trotz dieses deutlich ausbaufähigen Kapitels überzeugt der Essay, der zwar wenig Hoffnung verbreitet, seine Leserinnen und Leser aber nachdrücklich in die Pflicht nimmt, sich für den Fortbestand progressiver Werte einzusetzen.