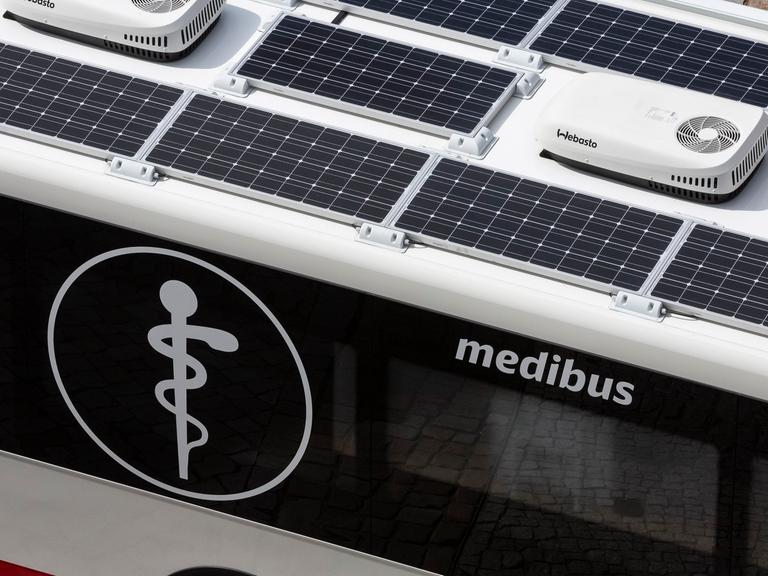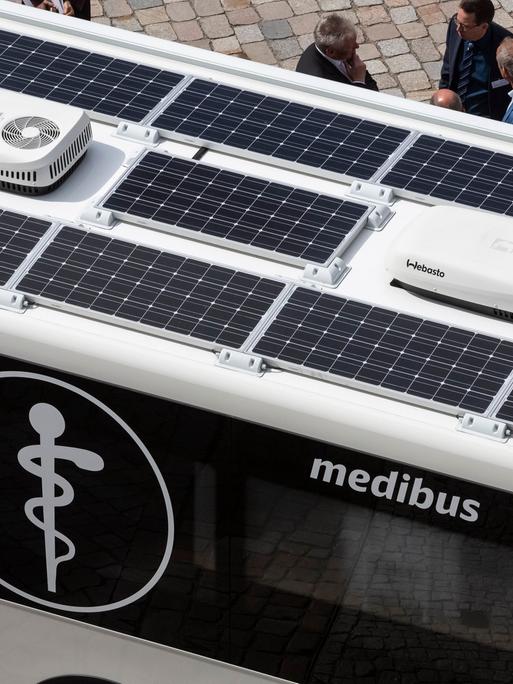Öffentliches Grün, eine verlassene Bank, ein Wohngebiet am Rand einer mittelgroßen Stadt irgendwo in Deutschland. Der Mann, den ich hier treffe: Mitte 40, helle Haare, helle Augen, Dreitagebart – und gut 25 Jahre Erfahrung im Rettungswesen. Erst Sanitäter, seit zwölf Jahren Notarzt. Benedikt Müller möchte er genannt werden in diesem Radiobeitrag, weil er offen reden will über die Missstände im ambulanten Gesundheitswesen – ohne seine ärztliche Schweigepflicht zu verletzen. Und auch weil ...
„... es egal ist, wer hier sitzt und wer hier mit Ihnen das Interview führt – sondern dass es ein allgemeines Problem ist.“
Die Versorgung für Menschen nämlich, die zuhause oder im Pflegeheim krank werden – sie wird unzuverlässig. Weil Hausärzte zunehmend schwer zu erreichen sind – und Hausbesuche seltener stattfinden als früher.
Dann wissen sich die Patienten oft gar nicht anders zu helfen als den Notruf zu wählen, indem sie 112 anrufen. Und dann werden wir oft alarmiert, um als Lückenfüller herzuhalten. Das heißt, ich springe für den Hausarzt vielleicht ein, der ‘ne volle Praxis hat, und muss vielleicht ein Stück weit deren Aufgaben übernehmen.
Benedikt Müller
Solche Berichte hört die bundesweite Notärzte-Vereinigung BAND nach eigenen Angaben mittlerweile regelmäßig – aus vielen Ecken Deutschlands. Und dieses Lücken-Stopfen-Müssen kann fatale Folgen haben. Aber dazu nachher.
Benedikt Müller macht den Hausärzten ausdrücklich keinen Vorwurf, dass er für sie einspringen muss. Sondern der Gesundheitspolitik der vergangenen 20 Jahre – und ihren Sparmaßnahmen.
„Da ist sehr, sehr viel Kommerz, Wirtschaft im Vordergrund gestanden – und nicht so sehr die Gesundheit der Patienten.“
Altenheime sind besonders betroffen
Grundsätzlich könnten die Versorgungsengpässe jeden treffen. Besonders oft spürbar würden sie aber in den Heimen – wie vor Kurzem bei einem alten Mann.
„Die Altenpflegerin hatte den Patienten morgens geweckt und dabei den Blutdruck gemessen, und der war deutlich höher als normal. Daraufhin hat sie ihm Tabletten gegeben, die standardmäßig in diesem Pflegeheim für die Patienten vorgerichtet werden. Und hat dann auch versucht, das zu kontrollieren und einzuschätzen, ob darunter eine Besserung eintritt oder nicht – und das war nicht der Fall.“
Was aber tun, wenn ein alter Mensch trotz Tabletten dauerhaft einen Blutdruck von 170, 180 hat? Damit sei die Pflegerin schlicht überfordert gewesen, sagt Müller. Kein Wunder: Als Auszubildende im zweiten Lehrjahr und – Stichwort Personalnot – die ganze Schicht über ohne eine einzige examinierte Pflegefachkraft als Ansprechpartnerin. So was dürfe in keinem Heim passieren.
Wir sind natürlich im Rahmen jetzt der Pandemie und allem, was da dranhängt, in allen Bereichen sehr nah an der Kante sozusagen, was die Kräfte anbetrifft – aber das muss eine Einrichtung leisten: Dass zumindest jemand da ist, der die Auszubildenden da auch – und wenn es nur seelisch und moralisch ist – unterstützt. Das hat mich sehr betroffen gemacht.
Benedikt Müller
Noch lange nach ihrem Dienstschluss habe die junge Pflegerin verzweifelt ärztlichen Rat gesucht: Wie sie dem alten Mann helfen solle? Aber: kein Durchkommen – weder beim Hausarzt noch beim hausärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116117. Die Pflegerin habe ihm später auf der Anrufliste ihres Telefons gezeigt, ...
„ … dass sie insgesamt acht Mal beim Hausarzt angerufen hat und in der Summe 45 Minuten versucht hatte, die 116117 anzurufen. Das heißt also, ein wesentlicher Zeitraum ihres Vormittags – den sie ja nicht nur diesem Patienten zu widmen hat – der ging für diese administrativen Sachen drauf.“
Letzter Ausweg 112
In ihrer Not wählte die Pflegerin irgendwann die 112. Von dort seien Sanitäter ins Heim gekommen, erzählt Benedikt Müller, hätten aber nichts gegen den hohen Blutdruck tun können. Also ein letzter Anrufversuch beim Hausarzt – über eine extra für solche Zwecke hinterlegte Spezial-Handynummer.
„Dann ging die Ehefrau dran. Und die Ehefrau sagte: Ja, mein Mann ist in der Praxis. Aber er ist seit vielen Tagen allein in der Praxis, weil seine medizinischen Fachangestellten zum Teil selber krank sind, oder die Kinder sind krank. Das heißt, er arbeitet seit einigen Tagen alleine, und er ist gar nicht mehr in der Lage, überhaupt das Telefon abzunehmen. Somit hat er auch das Smartphone zu Hause liegen lassen, weil er wusste, dass er dafür keine Zeit hat.“
Beim Deutschen Hausärzteverband heißt es dazu: Dass Hausärzte – wegen Krankheit beziehungsweise sehr hoher Arbeitsbelastung – zeitweise eingeschränkt erreichbar seien, könne vorkommen. Vor allem dort, wo besonders viele Patienten auf wenige Ärzte träfen. Also in strukturschwachen Regionen und auf dem Land.
„Ja, und dann alarmierte mich der Rettungswagen und sagte: Ich muss jetzt kommen und eine Entscheidung treffen.“
Der Notarzt ist kein Ersatz für den Hausarzt
Entscheiden darf in einer solchen Situation nämlich nur ein Arzt. Letztlich habe er dem alten Mann schlicht eine Extra-Dosis Blutdrucksenker verabreicht, sagt Müller. Grundsätzlich helfe er ja jedem Patienten gerne. Aber – und damit sind wir bei den vielleicht fatalen Folgen: Eigentlich sei er in erster Linie doch zuständig für Schwerstverletzte und Schwerstkranke.
Und wenn ich dann bei Patienten bin, die keine lebensbedrohlichen Verletzungen haben, die normalerweise über den Hausarzt behandelt würden, dann bin ich dort erst mal gebunden. Weil ich möchte ja auch jedem gerecht werden. Aber ich bin dann vielleicht nicht für Patienten da, die mich dringend benötigen, weil sie eben ‘ne schwere Erkrankung haben oder weil sie gerade einen Unfall hatten. Und dann komme ich gegebenenfalls nicht – oder zu spät.
Benedikt Müller
Sprich: Benedikt Müller, der Mann mit den 25 Jahren Erfahrung im Rettungsdienst, schließt irgendwo in Deutschland zwar die Versorgungslücke bei den Hausärzten – reißt damit aber eine neue ins Netz der Notärzte. Und bei einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall oder einem Autounfall bedeutet das schlimmstenfalls eben auch: Wenn kein anderer Notarzt schnell genug für Benedikt Müller einspringen kann, stirbt an den Lücken im System am Ende ein Mensch.
Patienten in der Warteschleife
„Willkommen bei der Patientenservice-Hotline 116117…“
Zwei von drei Anrufen in Baden-Württemberg kommen durch – beim anderen Drittel aber nimmt nie jemand ab. Und die Warteschleife zu Stoßzeiten am Wochenende: 23 Minuten. Da gebe es nichts zu beschönigen, sagt Johannes Fechner, Vize-Chef der dortigen Kassenärztlichen Vereinigung, kurz KV:
„Da müssen wir besser werden.“
Die KV muss laut Gesetz den Bereitschaftsdienst der Hausärzte außerhalb der Praxisöffnungszeiten sicherstellen – und auch die Hotline. Fechners Problem: Ihm fehlt das Personal für die zwei Callcenter in Bruchsal und in Mannheim. In anderen Bundesländern ist das ähnlich.
Bis vor rund zwei Jahren hatte die KV Baden-Württemberg die landesweit 35 integrierten Leitstellen damit beauftragt, die 116117-Anrufe anzunehmen. Sprich: jene Stellen, die Feuerwehr, Rettungswägen und Notärzte rausschicken, alarmierten bei Bedarf auch den Bereitschaftshausarzt. Enger können sich die beiden Systeme 116117 und 112 nicht abstimmen.
Warum die KV diese teils jahrzehntelange Zusammenarbeit gekündigt hat und jetzt auf Callcenter setzt? Fechner sagt:
„Diese Ersteinschätzung, diese Abfrage, das wollten wir in KV-Hand halten.“
Betroffene landen im Callcenter
Statt sie den Integrierten Leitstellen zu überlassen. Die Ersteinschätzung, von der Fechner spricht, ist seit zwei Jahren gesetzlich vorgeschrieben. Sie ist quasi die systematische Sortierung der Anrufer zur passenden Versorgungsebene: Was braucht dieser Mensch wirklich? Hausarzt am Montag? Notfallpraxis am Wochenende? Hausbesuch durch den hausärztlichen Bereitschaftsdienst? Oder sofort Notarzt und Krankenhaus?
Eine Patientensteuerung, um vor allem die Kliniken vor Überlastung zu schützen. Bei der Entscheidung „Wohin mit dem Anrufer?“ hilft den Callcenter-Mitarbeitern – übrigens bundesweit – die wissenschaftlich validierte Spezialsoftware „SmED“. Die „strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland“. Und auch daran entbrennt Kritik.
„Dahinter steckt ein Stück die Konfliktfrage überhaupt: Ist ein standardisierter Fragebogen in der Lage, diese Situation richtig einzuschätzen?“, sagt Peter Moritz.
Er macht seit 30 Jahren Hausarzt-Bereitschaftsdienste, kennt die Zeiten vor SmED also gut – und sagt: Kranke, hilfesuchende Menschen in ein algorithmengesteuertes Abfrageschema zu zwängen – da werde man ihnen nicht gerecht:
„Ich habe wiederholt ältere Leute gehabt. Der eine stand den Tränen nah – mit dem Kommentar: Oh, Sie kommen wirklich? Für ihn war die Situation emotional so belastend. Erst mal ewig in der Warteschleife – und dann auf eine sachlich-theoretische Art und Weise abgefragt zu werden. Das widerspricht jeder Grundregel, die einem Mediziner zu einem Anamnesegespräch beigebracht wird. So führt man kein Anamnesegespräch!“
Die ärztliche Versorgung ist gefährdet
Dazu komme ein unnötiger Zeitverzug durch die Callcenter, kritisiert Monika Knab, seit 40 Jahren Bereitschaftshausärztin. Die Leitstelle früher habe immer binnen Minuten angerufen, wenn ein Patient ihre Hilfe brauchte – das Callcenter manchmal erst nach einer dreiviertel Stunde. Und: Sie werde heute seltener überhaupt noch zu Hausbesuchen angefordert. Das gefährde die ärztliche Versorgung insbesondere älterer Menschen.
„Früher, wenn ich Nachtdienst hatte, da war ich die halbe Nacht unterwegs“, so Knab. „Da hatte ich fünf bis maximal zehn Einsätze. Jetzt habe ich einen, zwei. Die Leute rufen nicht mehr an. Die trauen sich nicht mehr, weil sie wissen, sie erreichen niemand.“
Die Einsatzzahlen sinken nicht zufällig – im Gegenteil:
„Das ist sogar beabsichtigt, die Zahl der Hausbesuche zu reduzieren“, sagt Johannes Fechner von der Kassenärztlichen Vereinigung. Denn:
Letztlich sind wir als KV zu Wirtschaftlichkeit gezwungen – das steht sogar im SGB V drin – und sollen nur das machen, was vernünftig ist. Hausbesuche dürfen nur gemacht werden, wenn sie medizinisch erforderlich sind.“
Und das sei in Zeiten vor der SmED-Software eben nicht immer der Fall gewesen.
Kritik: Callcenter veranlassen zu viele Fehleinsätze
Und dann ist da noch die Kritik aus den 35 Integrierten Leitstellen selbst: Die 116117 reiche der 112 zu viele Anrufer als angebliche Notfälle weiter. Erich Hebner, Leitstellenchef in Emmendingen, sagt:
„Klassischer Fall: Rettungswagen fährt vor Ort, stellt fest, es liegt kein Notfall vor – und gibt das wieder telefonisch – mit Verbinden über die Leitstelle – an die 116117 zurück. Damit dort ein Bereitschaftsarzt vor Ort kommt.“
Etwa 1000 bis 1200 Einsätze pro Jahr stellten sich nachträglich als unnötig heraus, so Hebner – rund die Hälfte aller Fälle, die er aus den Callcentern bekomme. Johannes Fechner von der KV verteidigt seine Mitarbeiter: Fehleinsätze seien ein Zeichen, dass seriös disponiert werde – und durchaus üblich.
Früher, im gemeinsamen Büro, sagt Leitstellenchef Hebner noch, hätten sich 116117-Mitarbeiter und 112-Disponenten in Zweifelsfällen schnell abgestimmt und treffsicherer entschieden: Wer braucht Rettungswagen und Notarzt wirklich?
„Was dazu geführt hat, dass die Ressource Rettungsdienst geschont wurde – um für echte Notfälle da zu sein.“
Bei aller Kritik – zur Wahrheit gehört auch: Mancherorts in Deutschland funktioniert das Miteinander von 116117 und 112 noch weniger als in Baden-Württemberg. Da werden keine Einsatzdaten oder Anrufer untereinander weitergegeben – sondern da sagen Mitarbeiter der 116117: Lieber Anrufer, Sie sind ein Notfall. Bitte rufen Sie selbst die 112 an.
Und Monika Knab und Peter Moritz, die beiden Bereitschaftsärzte in Südbaden? Die lassen instabilen Patienten bei Hausbesuchen inzwischen ihre Handynummern da. Damit die Menschen sie anrufen können, falls sie hausärztliche Hilfe brauchen – und bei der 116117 keine bekommen.
Das Bundesgesundheitsministerium plant übrigens Vorgaben, damit sich die 116117-Callcenter und die 112-Leitstellen überall in Deutschland künftig besser vernetzen. Wann sie kommen, ist aber offen. Und: Niedersachsens rot-grüne Landesregierung spricht sich im Koalitionsvertrag langfristig für gemeinsame Notfall-Leitstellen aus – also für ein System ähnlich dem, das in Baden-Württemberg erst abgeschafft wurde.