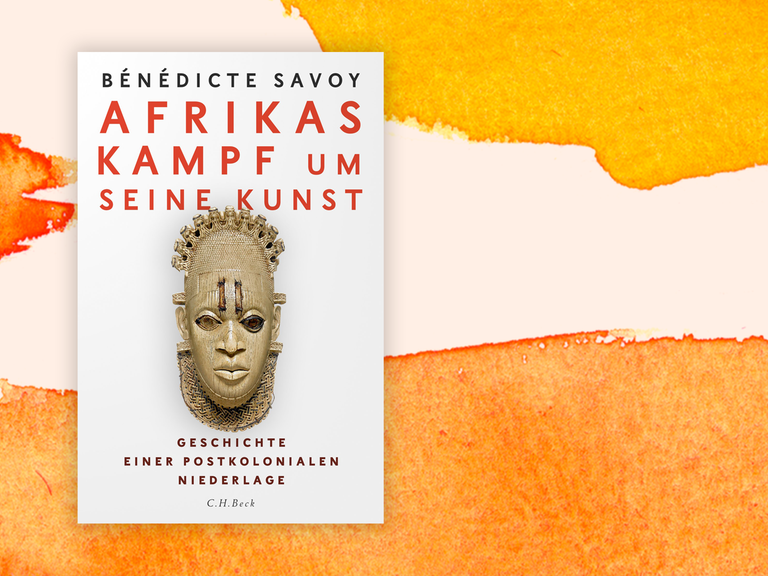Europa anders sehen
07:54 Minuten

Den Mehrheitsgesellschaften zeigen, dass schwarze Menschen Teil der europäischen Geschichte sind: An dieses Ziel knüpft der Begriff des Afropäischen an. Geprägt wurde er durch Musikalben von Bands wie Zap Mama. Aber wer oder was ist afropäisch?
Afropäisch – das klingt zunächst auch ein bisschen nach einer etwas absurden Geografie. Afrika in Europa oder Afrika und Europa als ein Kontinent? Nein, meint Jeannette Oholi, die als Literaturwissenschaftlerin an der Uni Gießen zum Begriff des Afropäischen in der zeitgenössischen Literatur forscht.

Auf der Suche nach dem "Wir"© Deutschlandradio
"Ich würde das eher weniger auf geografische Grenzen festlegen, sondern eher als so eine Art Denkfigur nutzen, um zu überlegen, wie Erfahrungen aus verschiedenen Räumen, wenn man denn so denken möchte, zusammenkommen und was daraus Neues entstehen kann. Also auch den afrikanischen Kontinent mehr mitzudenken und den Einfluss auf Europa."
Ein Stück Selbstermächtigung
Es geht auch um die positive Sichtbarmachung schwarzer Realitäten in Europa, ergänzt Raphaëlle Efoui-Delplanque. Die Literaturwissenschaftlerin forscht an der Freien Universität Berlin derzeit zum Gemeinschaftsbegriff in Texten der afrikanischen Diaspora.
"Sozusagen weißen Mehrheitsgesellschaften zu zeigen, dass schwarze Menschen eben Teil der europäischen Geschichte sind. Und zwar zum einen der europäischen Globalgeschichte, aber auch der kontinentalen europäischen Geschichte. Gleichzeitig geht es auch um Selbstermächtigung. Ich glaube, dass der Begriff des Afropäischen auch dazu dient zu sagen: Es gibt uns."
Afrikanischer Gesang, europäische Melodien
Geprägt wurde der Begriff des Afropäischen zuerst im popkulturellen Umfeld: Anfang der 1990er-Jahre erschien das erste Album der Gruppe Zap Mama. Herausgebracht wurde es auf dem Label von David Byrne, dem Sänger der Band Talking Heads. Es war die erste einer Reihe von Veröffentlichungen unter dem Titel "Adventures in Afropea" – also "Abenteuer in Afropea". Damit hatte Byrnes Label "einen Kontinent mit fiktiven Konturen erstmal geschaffen, dieses Konstrukt oder diese ästhetische Vorstellung der Afropea", so Jeannette Oholi.
Ein Konstrukt, das nicht im luftleeren Raum entsteht: Die Gründerin von Zap Mama beispielsweise, Marie Daulne, wuchs in Belgien auf. Ihre Familie floh in den 1960er-Jahren aus der Demokratischen Republik Kongo – da war die heutige Sängerin erst wenige Wochen alt.
In der Musik ihrer Gruppe vermischen sich afrikanische Gesangstechniken mit europäischen Melodien und Songstrukturen aus Pop und Hip-Hop – zu hören etwa im Song "Brrrlak!" von ihrem Debutalbum.
Afropäisch, das meint also nicht afrikanisch und europäisch nebeneinander, sondern gleichzeitig – ob in Musik, Kulinarik oder Literatur. Diese Synthese biete auch eine Möglichkeit, über nationale und soziale Grenzen hinweg nach etwas Verbindendem zu suchen, sagt Raphaëlle Efoui-Delplanque.
"Das ist ja auch das sehr Interessante daran, dass es einen Begriff schafft, der einerseits eben neue Solidarität und Verbindungsmöglichkeiten ermöglicht, andererseits aber ein Wort bietet für etwas, das schon Realität ist. Ich glaube, es ist wichtig, das auch so zu verstehen. Und ich glaube, dass das der Ansatz dieses Begriffes ist: Dieses Gelebte also – statt zum Beispiel des Akademischen oder so –diesen Denkansatz bietet für die Diversität von schwarzen Erfahrungen in Europa, nicht nur in der Bevölkerung, sondern in einer Person eigentlich."
Wer ist afropäisch?
Diese Diversität meint auch unterschiedliche soziale Hintergründe und Klassenzugehörigkeiten. Denn was sollte eine junge schwarze aus einer reichen schwedischen Familie gemeinsam haben mit einem älteren Imbissbetreiber in Amsterdam oder einem Geflüchteten in Calais? Welches kulturelle Erbe teilen sich Menschen mit kongolesischer Familiengeschichte in Belgien mit der sudanesischen Community in Berlin?
Wer also ist eigentlich afropäisch? Für Raphaëlle Efoui-Delplanque ist das "eine Frage, die es auch generell bei dem Begriff der afrikanischen Diaspora gegeben hat: Aber wer gehört denn eigentlich dazu? Für mich ist das ein sehr wichtiger Punkt. Sind Afropeans eigentlich diese glamourösen second, third und viel mehr Generations, die einen gewissen Status in den Künsten und der Popkultur erreicht haben? Oder sind es auch MigrantInnen, die neulich nach Europa gekommen sind? Und wie kann dieser Begriff auch diese unterschiedlichen Erfahrungen verbinden?"
Denn wenn etwa Johny Pitts oder Léonora Miano in ihren Büchern über das Afropäische nachdenken, suchen sie eben nicht nach einer scheinbaren Homogenität schwarzer Erfahrungen in Europa, betont Jeannette Oholi.
"Diese Frage nach Eindeutigkeit, nach Kategorisierungen, Stereotypisierungen, und so weiter werden eben durch diesen Begriff aufgebrochen und hinterfragt und ein Stück weit unterwandert."
Rassismus etwa trifft einen armen schwarzen Mann mit einem fremd klingenden Namen auf eine andere Art als eine schwarze Frau aus der Mittelschicht mit einem einheimisch klingenden Namen. Ihre Hautfarbe und die historisch gewachsenen Abwertungen derselben aber können beide nicht ablegen.
Verständigung und Verständnis ermöglichen
Insofern hat der Nicht-Ort der Afropea für Jeannette Oholi auch eine zeitliche Dimension der Gleichzeitigkeit. Afropäisch ist für sie "ein Begriff, der eben auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit einbezieht. Weil natürlich, wenn Erfahrungen in Bezug auf Rassismus verhandelt werden, hat das natürlich eine Vergangenheit – und da wird natürlich auch auf die Kolonialgeschichte referiert. Auch wenn wir über Migration sprechen, ist das ja auch eng mit Europa immer schon verknüpft gewesen. Und wenn ich zum Beispiel an die Zukunft denke, denke ich auch daran, wie ein Europa der Zukunft entworfen wird durch den Begriff. Ein sehr viel pluraleres, vielfältiges Europa, das jetzt auch schon existiert. Aber die Anerkennung dieser Existenz und der vielfältigen schwarzen Erfahrungen in Europa, die fehlt eben noch."
Die Diskussion über den Begriff des Afropäischen ist derzeit im Prozess. Er ist nicht der einzige, über den sich schwarze Europäerinnen und Europäer verständigen, und will es auch nicht sein: Ergänzt werden Diskussionen zum Beispiel der angelsächsischen Black European Studies oder auch darüber, was es heißt, Afrodeutsch zu sein.
Es geht auch darum, Brücken zu bauen, Verständigung und Verständnis zu ermöglichen. Aber Raphaëlle Efoui-Delplanque betont auch: Weiße Unwissenheit oder Stereotype über das schwarze Europa sind nicht allein ihr Problem.
"Was dieser Begriff gerade macht, ist unglaublich dynamisch, und das kann nicht dadurch eingeschränkt werden, dass man sich leider als schwarze Person in Europa Gedanken drüber machen muss, dass man häufig die einzige Person ist, die zum Beispiel die Erfahrung einer schwarzen Person in Deutschland hat – und deshalb dafür stehen muss, was alle anderen schwarzen Menschen in Deutschland erfahren. Das darf nicht das Problem der AfropäerInnen sein."