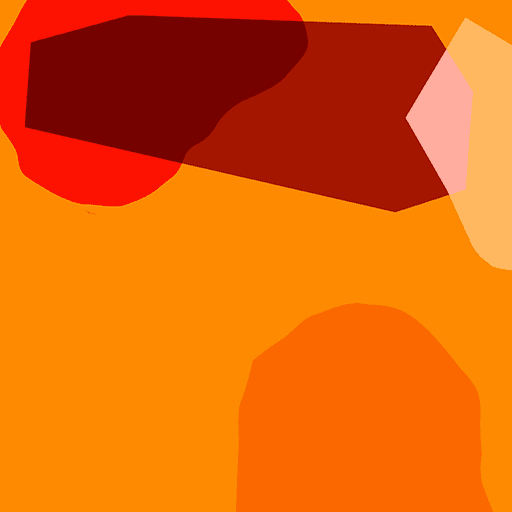Abschied vom Drama
"Heimkehr nach E-Dur" – so hatten wir die erste jener drei letzten Klaviersonaten Beethovens wegen ihrer kantablen Entspanntheit überschrieben. Mit "Gesängen der Versöhnung" war der Ton meditativer Gefasstheit der mittleren, der As-Dur-Sonate op. 110 umschrieben worden. Bei der dritten, der c-Moll-Sonata op. 111, ist nun von Abschied die Rede – und dies nicht nur, weil der berühmte Arietta-Satz von diesem musikalischen Topos bestimmt ist.
Geht es dabei um einen Abschied von der Sonate als Gattung, die bei Beethoven die Dimension eines musikalischen Dramas erreicht hatte?
Viele Kommentatoren vertreten diese Ansicht, die untermauert zu sein scheint durch das Faktum, dass Beethoven mit op. 111 tatsächlich seine letzte Klaviersonaten geschaffen hat. Und dennoch sind Relativierungen angebracht, wie der Schriftsteller Friedrich Dieckmann in der Sendung zu bedenken gibt: "Der Widerkehr des Dramas (erster Satz "Maestoso – Allegro can brio ed appassionato") ist ein neuer Gesang der Versöhnung gefolgt (zweiter Satz: "Arietta:
Adagio molto semplice e cantabile"). Es ist das Abschiednehmen Beethovens von einer musikalischen Form, an der er, am Tisch komponierend oder am Flügel improvisierend, von jeher die persönlichste seiner Ausdrucksformen gefunden hatte. Dass nach diesem zweiten kein dritter Satz folgen konnte, wie ein törichter Verleger glaubte, lag auf der Hand und ebenso, dass der Komponist danach keine Sonate mehr schreiben würde, obschon man dasselbe schon bei op. 110 hätte mutmaßen können.
Aber war die Sonate als Kunstform damit ans Ende gelangt, ging es mit ihr nicht mehr weiter? Schubert hat sich nicht abschrecken lassen, seine sechs großen Sonaten, darunter eine in c-Moll, sind alle nach der Veröffentlichung von op. 111 entstanden; dass ihm das gelang,
ist ein Wunder wie diese drei opera selbst. "Per aspera ad astra", durch Dunkelheiten zu den Sternen oder verkürzt: "Durch Nacht zum Licht" – diesen Vers des Seneca hat man oft genug und manchmal wie ein Klischee auf Beethovens Musik bezogen. Es ist, als hätte der Komponist ihn mit dieser seiner letzten Sonate buchstäblich wahr machen wollen."
Viele Kommentatoren vertreten diese Ansicht, die untermauert zu sein scheint durch das Faktum, dass Beethoven mit op. 111 tatsächlich seine letzte Klaviersonaten geschaffen hat. Und dennoch sind Relativierungen angebracht, wie der Schriftsteller Friedrich Dieckmann in der Sendung zu bedenken gibt: "Der Widerkehr des Dramas (erster Satz "Maestoso – Allegro can brio ed appassionato") ist ein neuer Gesang der Versöhnung gefolgt (zweiter Satz: "Arietta:
Adagio molto semplice e cantabile"). Es ist das Abschiednehmen Beethovens von einer musikalischen Form, an der er, am Tisch komponierend oder am Flügel improvisierend, von jeher die persönlichste seiner Ausdrucksformen gefunden hatte. Dass nach diesem zweiten kein dritter Satz folgen konnte, wie ein törichter Verleger glaubte, lag auf der Hand und ebenso, dass der Komponist danach keine Sonate mehr schreiben würde, obschon man dasselbe schon bei op. 110 hätte mutmaßen können.
Aber war die Sonate als Kunstform damit ans Ende gelangt, ging es mit ihr nicht mehr weiter? Schubert hat sich nicht abschrecken lassen, seine sechs großen Sonaten, darunter eine in c-Moll, sind alle nach der Veröffentlichung von op. 111 entstanden; dass ihm das gelang,
ist ein Wunder wie diese drei opera selbst. "Per aspera ad astra", durch Dunkelheiten zu den Sternen oder verkürzt: "Durch Nacht zum Licht" – diesen Vers des Seneca hat man oft genug und manchmal wie ein Klischee auf Beethovens Musik bezogen. Es ist, als hätte der Komponist ihn mit dieser seiner letzten Sonate buchstäblich wahr machen wollen."