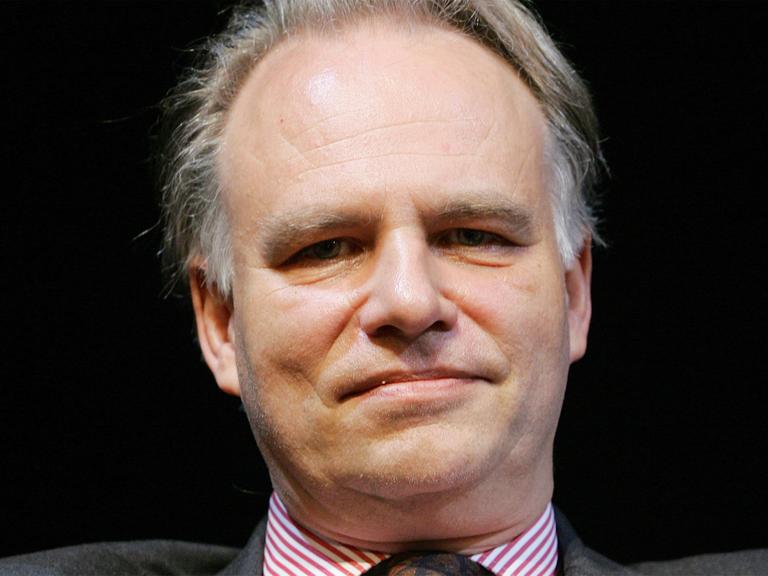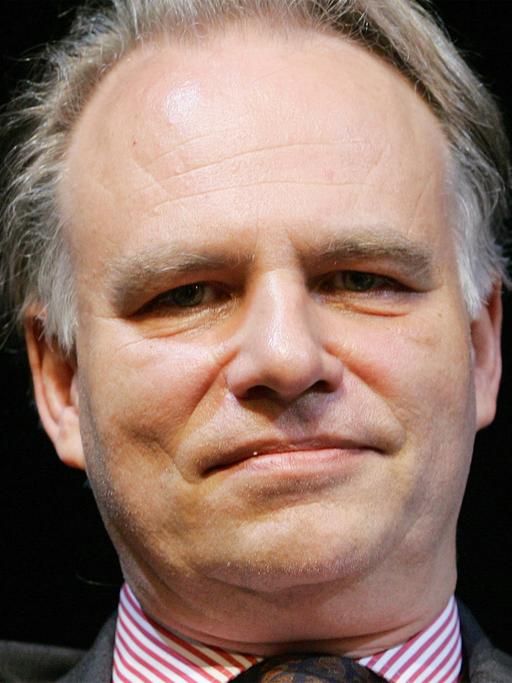Zur Funktion des Genres "Feuilleton-Debatte"

Keine Debatte kommt ohne grelle Rhetorik aus. Wissenschaftliche Nüchternheit ist kaum unterhaltsam - erreicht also nicht die Massen. Die Feuilleton-Debatte ist eine Schleuse zwischen Gelehrtenstuben und Öffentlichkeit geworden, meint unser Autor Arno Orzessek.
Wer das Genre "Feuilleton-Debatte" loben will, darf von den Zumutungen nicht schweigen. Denn ganz ohne Animositäten, circensische Momente und grelle Rhetorik kam noch keine Debatte aus.
Andererseits verbürgen die Nebengeräusche den Unterhaltungs-Wert und steigern so die Reichweite. Zu Aufsätzen, die vom großen Publikum gern beim Frühstück konsumiert werden, passt eine gewisse Erregung ja allemal besser als wissenschaftliche Nüchternheit.
Beispielhaft der aggressive Zwist um die Gentechnologie zwischen Jürgen Habermas und Peter Sloterdijk Ende der 90er-Jahre, auch bekannt als "Hysterikerstreit". Es schien, als ginge es in erster Linie um die intellektuelle Platzhirsch-Position in diesem Lande.
Popstar der Holocaust-Forschung und der Tom-Hanks-Faktor
Doch die Kontrahenten und ihre Entouragen tauschten auch seriöse Argumente, und das machte die elementare gesellschaftliche Bedeutung des damals jungen Labor-Phänomens Human-Gentechnologie weithin sichtbar. Wer wollte, lernte mittels des Feuilletons, klug über die genetische Selbstgestaltung des Menschen zu sprechen und die eigene Haltung zu prüfen.
Spätestens im Nachhinein erkennt man seismographische Qualitäten, wie sie auch dem wirkungsmächtigen Historikerstreit 1986/87 und der Goldhagen-Debatte zehn Jahre später eigen waren - trotz oder gerade wegen mancher boulevardesken Züge.
Rasch galt der telegene Goldhagen als "erster Popstar der Holocaust-Forschung", um den Sozialwissenschaftler Alfred Schobert zu zitieren. Vom "Tom-Hanks-Faktor" sprach Josef Joffe, damals Leiter des Ressorts Außenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Goldhagen selbst klagte, ihm werde vorgeworfen, "dass ich symphatisch bin".
"Volksgemeinschaft der Gekränkten"
In der Sache zog sich Goldhagen viele überhebliche, auch gehässige Anwürfe zu. Es hieß, er ignoriere ganze Bibliotheken von Fachliteratur und seine These vom "eliminatorischen Antisemitismus" der Deutschen kehre den beklagten Rassismus der willigen Vollstrecker bloß um.
Andere - zumeist linke - Publizisten behaupteten alsbald, die bitteren Reaktionen auf Goldhagens Buch seien ein Abwehr-Reflex und würden das Fortleben apologetischer Tendenzen entlarven. Der Historiker Kurt Pätzold spottete über "die Volksgemeinschaft der Gekränkten und Beleidigten".
Wie fast immer sorgten diejenigen für Niveau, die sich nicht aufs krawallige 'Pro oder Contra' einließen, sondern Goldhagens Methoden und Argumente sezierten - etwa Hans-Ulrich Wehler. Der Bielefelder Historiker, mittlerweile verstorben, drängte aus guten Gründen darauf, das Buch zu lesen - und kritisierte es aus genauso guten Gründen scharf.
Der Status quo der Schuldfrage
So erschlossen sich den Feuilleton-Lesern fachliche Differenzierungen. Umgekehrt untersuchten Wissenschaftler die Debatte als wichtiges Symptom deutschen Geschichtsbewusstseins.
Kurz: Die Feuilleton-Debatte, die auf viele Zeitschriften und Magazine ausgriff, wurde zur Schleuse zwischen Gelehrtenstuben und Öffentlichkeit - eine wertvolle Funktion...
Die 2014 auch beim Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum Tragen kam. Vor dem Hintergrund der dicken, gewiss nur von Wenigen komplett gelesenen Werke etwa von Christopher Clark, Herfried Münkler und Jörn Leonhard verdeutlichte die Feuilleton-Debatte nicht zuletzt den Status quo in der Schuldfrage, die lange Zeit zu Ungunsten Deutschlands geklärt zu sein schien.
Solche Feuilleton-Debatten bilden nicht weniger ab als die geistige Gegenwart.