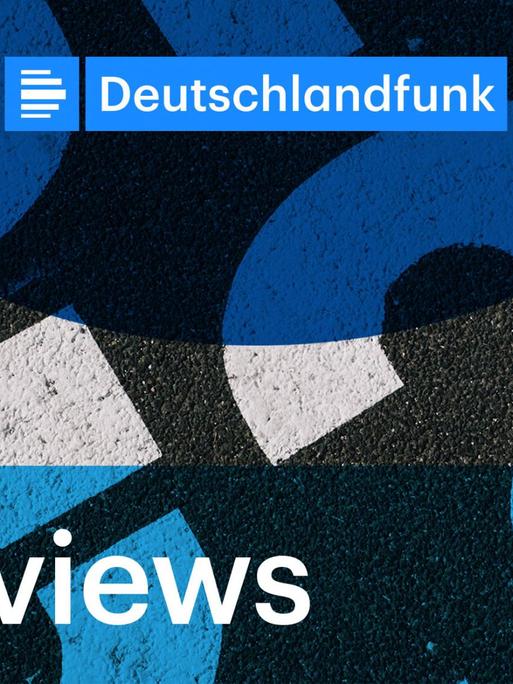60 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention
Für die größte Reform der Menschenrechtskonvention hält der Völkerrechtler Christian Tomuschat 1998 die Einführung der Individualbeschwerde. Mit einem Festakt wird in Straßburg das 60-jährige Jubiläum begangen.
Britta Bürger: Auf der Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention sind Menschenrechte einklagbar geworden, das Recht auf freie Meinungsäußerung ebenso wie das Recht auf Versammlungsfreiheit. Zugleich verbietet die Konvention Menschenrechtsverletzungen wie Folter, Sklaverei oder Zwangsarbeit. Heute wird in Straßburg die Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention vor 60 Jahren mit einem großen Festakt gefeiert, und wir wollen uns die Stärken, möglicherweise auch die Schwächen dieses Katalogs von Menschenrechten und Grundfreiheiten genauer ansehen, im Gespräch mit dem Völker- und Europarechtler Christian Tomuschat. Schönen guten Morgen, Herr Tomuschat!
Christian Tomuschat: Guten Morgen!
Bürger: Ein Katalog einklagbarer Menschenrechte, das war wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Meilenstein. Wurde damals um die Ausarbeitung der Europäischen Menschenrechtskonvention eigentlich hart gerungen, oder ist dieses Instrument vergleichsweise leicht entstanden, weil der Schrecken des Holocausts den Menschen noch im Nacken saß?
Tomuschat: Die Konvention ist relativ leicht entstanden. Sie beruht im Übrigen auch auf Vorarbeiten im Rahmen der Vereinten Nationen, dort hat man auf der Grundlage der UNO-Charta schon früh damit begonnen, einen Menschenrechtskatalog aufzustellen. Und diese Vorarbeiten hat man dann im Rahmen des Europarates auch herangezogen, und man hatte sich in den Vereinten Nationen schon im Wesentlichen auf eine Liste von Menschenrechten geeinigt. Insofern war die Arbeit im Europarat gar nicht mehr so schwer.
Bürger: Was waren 1950 die wichtigsten zu schützenden Menschenrechte?
Tomuschat: Ja, Sie haben es schon gesagt: Man stand ja unter dem Eindruck dessen, was in den Jahren von 1933 bis 1945 sich ereignet hatte an Mord, Zerstörung, Völkermord, der Krieg, die Verneinung der grundlegenden Freiheiten, es gab keine Pressefreiheit natürlich, alles dieses war ein grauenhafter Rückblick. Und das hat man zum Anlass genommen, um nun wirklich den Rechtsstaat zu konsolidieren. Es ging in erster Linie um rechtsstaatliche Errungenschaften und politische Freiheiten, die wollte man in diesem neuen Instrument wirksam verankern.
Bürger: Die Konvention ist im Laufe der Jahrzehnte ja durch viele Zusatzprotokolle erweitert worden. Was waren aus Ihrer Sicht wichtige, notwendige Ergänzungen?
Tomuschat: Ja, das Recht auf Eigentum war zum Beispiel nicht im ursprünglichen Text enthalten. Man konnte sich bei den Beratungen zunächst nicht darauf einigen, zumal in Frankreich und in Großbritannien große Verstaatlichungsaktionen stattgefunden hatten. Es ging dann aber relativ schnell, und das ist heute ein fester Bestandteil des gesamten Vertragsgebäudes. Ich glaube, die größte und entscheidende Reform war diejenige, die die Individualbeschwerde als einen bindenden Bestandteil des Vertragswerkes eingeführt hat. Das geschah im Jahre 1998, bis dahin war die Individualbeschwerde nicht zwingend vorgeschrieben, sondern man konnte sich der Konvention unterwerfen, konnte aber sagen: Ich will den Sanktionsmechanismus der Straßburger Institution nicht akzeptieren, es reicht mir, ich halte von mir aus, mit meinen Gerichten, meinen Verwaltungsbehörden die Rechte ein und ich brauche keine internationale Kontrolle. Damit ist es jetzt vorbei.
Bürger: Lässt sich sagen, welche Punkte der Menschenrechtskonvention über die Jahre für die größten Konflikte gesorgt haben?
Tomuschat: Die Menschenrechtskonvention ist insbesondere wirksam geworden auf dem Gebiet der prozessualen Rechte, sowohl im Strafprozess wie im Zivilprozess, da hat vieles im Argen gelegen. Ein großes Thema ist die überlange Verfahrensdauer. Auch Deutschland ist insoweit nicht ganz unschuldig, auch Deutschland ist mehrfach verurteilt worden wegen überlanger Verfahrensdauer. Auch das Bundesverfassungsgericht ist in einigen Fällen diesem Tadel nicht entgangen, und das hat heute vor allem eine unendlich große Bedeutung, vor allem in den früheren kommunistischen Ländern, in Russland. Die Unparteilichkeit der Justiz, das ist ein ganz großes Thema, und das gilt auch für die Türkei, die in den vielen Jahren immer eine unendlich große Anzahl von Beschwerden auf sich gezogen hat.
Bürger: Immer stärker in den Mittelpunkt gerückt ist vermutlich auch Artikel 9 über die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Ist das noch das richtige Instrument in einer Zeit jetzt, in der in vielen Ländern über Kruzifixe, über Minarette, über Burkas verhandelt wird? In religiösen Fragen und beim Verhältnis von Staat und Kirche gibt es ja innerhalb Europas sehr große Unterschiede.
Tomuschat: Ja, natürlich, das ist nach wie vor eine grundlegende Freiheit, und für viele Autoren ist überdies die Religionsfreiheit die grundlegende Freiheit, aus der alle Menschenrechte erwachsen sind. Ob das stimmt, wage ich zu bezweifeln, aber nach wie vor nimmt die Religionsfreiheit eine zentrale Stellung ein. Nun geht es darum – ich glaube, das Prinzip ist völlig unbestritten –, es geht nur darum, die Grenzen zu ziehen, gewisse Schranken auch zu betonen. Was bedeutet es etwa, wenn in Klassenzimmern ein Kruzifix aufgehängt wird? Ist das zu rechtfertigen als Teil der kulturellen Tradition eines Landes, wie Italien das sagt, oder ist das eine Verletzung der Religionsfreiheit der Kinder und auch der Eltern? Und darüber wird im Augenblick gestritten, da gibt es ein Verfahren vor dem Gerichtshof, das in erster Instanz zum Nachteil von Italien geendet hat, und in zweiter Instanz hofft natürlich Italien, diesen Richterspruch korrigieren zu können.
Bürger: Über 60 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention sprechen wir hier im Deutschlandradio Kultur mit dem Völkerrechtler Christian Tomuschat. Herr Tomuschat, in welchen Ländern entfaltet denn diese Konvention derzeit eine besonders starke Wirkung?
Tomuschat: Ja ich glaube, die Konvention ist besonders wichtig für diejenigen Länder, wo das Rechts- und Verfassungsgebäude noch nicht so gut konsolidiert ist, und ich muss nochmals Russland nennen und auch die Türkei. In Russland liegt das Rechtswesen doch noch im Argen, die Rechtsstaatlichkeit hat sich noch nicht gefestigt in dem Maße, wie es die Konvention verlangt. Im Augenblick sind ungefähr 38.000 Beschwerden gegen Russland beim Europäischen Gerichtshof anhängig. Ob er das jemals wird bewältigen können, ist eine offene Frage. Auch die Türkei hat vor allem wegen der Auseinandersetzungen mit den Kurden immer sehr stark den Gerichtshof beschäftigt und tut es nach wie vor. Italien ist hervorgetreten vor allem wegen der überlangen Verfahrensdauer, die italienische Gerichtsbarkeit ist offenbar nicht gerüstet für eine rasche Erledigung der anhängigen Rechtssachen. Also jedes Land hat so seine Besonderheiten. Im Allgemeinen steht die Bundesrepublik Deutschland sehr gut da, vor allem deswegen, weil es bei uns ja die Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe gibt, und man muss zunächst den Rechtsweg nach Karlsruhe beschreiten, ehe man sich an den Straßburger Gerichtshof wenden kann. Und das Bundesverfassungsgericht erkennt schon, wenn es bei uns zu grundlegenden Verstößen gekommen ist, jedenfalls in der Regel, es bleibt nur noch sehr wenig zu korrigieren für den Straßburger Gerichtshof.
Bürger: Das heißt, in der Tat ist diese Europäische Menschenrechtskonvention so was wie ein Gradmesser dafür, wie ausgeprägt die Demokratie in einem Land ist oder eben auch nicht?
Tomuschat: Das kann man sagen, wobei man die beiden Worte Demokratie und Rechtsstaatlichkeit miteinander verbinden muss. Eine Demokratie könnte ja auch dazu benutzt werden, um rechtsstaatliche Garantien wie Meinungsfreiheit durch eine Herrschaft der Mehrheit außer Kraft zu setzen, also Demokratie, das allein sollte man nicht sagen, sondern sollte die Demokratie immer im Zusammenhang mit Rechtsstaatlichkeit erwähnen.
Bürger: Auch UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon wird ja beim heutigen Festakt in Straßburg dabei sein. Inwieweit reicht die Europäische Menschenrechtskonvention denn über den europäischen Kontinent hinaus? Ist sie ein vorbildliches Modell für globale Menschenrechte?
Tomuschat: Ich glaube, das kann man so sagen. Auf Weltebene gibt es den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der in seinen Formulierungen sehr ähnlich ist der Europäischen Konvention. Das rührt aber daher, dass eben die Europäische Konvention auf den Vorarbeiten der Vereinten Nationen beruht. Es ist also nicht so, dass die Vereinten Nationen von den Europäern abgeschrieben hätten. Und der Internationale Pakt ist deswegen sehr viel weniger wirksam, weil es dieses Individualbeschwerdeverfahren nicht gibt. Es gibt den Menschenrechtsausschuss nach dem Pakt, man kann sich auch mit einer Beschwerde an den Menschenrechtsausschuss wenden, aber die Stellungnahmen zu diesen Beschwerden sind nicht verbindlicher Art. Sie sind lediglich Empfehlungen an die Mitgliedsstaaten, haben deswegen natürlich eine sehr viel geringere Durchsetzungskraft.
Bürger: Auf dem Papier sieht die Einhaltung der Menschenrechte anscheinend also vorbildlich aus, und doch ist die Realität häufig deutlich finsterer. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts jetzt – fehlt Ihnen noch irgendetwas in der Europäischen Menschenrechtskonvention?
Tomuschat: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist bewusst als eine Kodifizierung von Freiheitsrechten geschaffen worden und von politischen Rechten. Sie enthält nur in Ansätzen gewisse ökonomische und soziale Rechte. Es ist die große Frage, ob man mit solchen Rechten auch ein Individualbeschwerdeverfahren kombinieren kann. Das ist nicht so ganz eindeutig. Es ist natürlich sehr viel leichter, die Freiheitsrechte durch ein gerichtliches Verfahren zu schützen als bei solchen Rechten wie dem Recht auf Arbeit oder dem Recht auf ordentliche Arbeitsbedingungen oder dem Recht auf Gesundheit oder dem Recht auf Erziehung, wo der Staat alle möglichen Maßnahmen treffen muss, um dieses Recht wirklich effektiv auszugestalten. Und es ist wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich, den Katalog zu ergänzen oder wäre nicht sehr erfolgreich. Ich glaube, man sollte bei dem Modell bleiben, und muss sich bei den sozialen und wirtschaftlichen Rechten eben andere Durchsetzungsmechanismen ausdenken.
Bürger: 60 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention im Blick des Völkerrechtlers Christian Tomuschat. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Tomuschat!
Tomuschat: Herzlichen Dank!
Christian Tomuschat: Guten Morgen!
Bürger: Ein Katalog einklagbarer Menschenrechte, das war wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Meilenstein. Wurde damals um die Ausarbeitung der Europäischen Menschenrechtskonvention eigentlich hart gerungen, oder ist dieses Instrument vergleichsweise leicht entstanden, weil der Schrecken des Holocausts den Menschen noch im Nacken saß?
Tomuschat: Die Konvention ist relativ leicht entstanden. Sie beruht im Übrigen auch auf Vorarbeiten im Rahmen der Vereinten Nationen, dort hat man auf der Grundlage der UNO-Charta schon früh damit begonnen, einen Menschenrechtskatalog aufzustellen. Und diese Vorarbeiten hat man dann im Rahmen des Europarates auch herangezogen, und man hatte sich in den Vereinten Nationen schon im Wesentlichen auf eine Liste von Menschenrechten geeinigt. Insofern war die Arbeit im Europarat gar nicht mehr so schwer.
Bürger: Was waren 1950 die wichtigsten zu schützenden Menschenrechte?
Tomuschat: Ja, Sie haben es schon gesagt: Man stand ja unter dem Eindruck dessen, was in den Jahren von 1933 bis 1945 sich ereignet hatte an Mord, Zerstörung, Völkermord, der Krieg, die Verneinung der grundlegenden Freiheiten, es gab keine Pressefreiheit natürlich, alles dieses war ein grauenhafter Rückblick. Und das hat man zum Anlass genommen, um nun wirklich den Rechtsstaat zu konsolidieren. Es ging in erster Linie um rechtsstaatliche Errungenschaften und politische Freiheiten, die wollte man in diesem neuen Instrument wirksam verankern.
Bürger: Die Konvention ist im Laufe der Jahrzehnte ja durch viele Zusatzprotokolle erweitert worden. Was waren aus Ihrer Sicht wichtige, notwendige Ergänzungen?
Tomuschat: Ja, das Recht auf Eigentum war zum Beispiel nicht im ursprünglichen Text enthalten. Man konnte sich bei den Beratungen zunächst nicht darauf einigen, zumal in Frankreich und in Großbritannien große Verstaatlichungsaktionen stattgefunden hatten. Es ging dann aber relativ schnell, und das ist heute ein fester Bestandteil des gesamten Vertragsgebäudes. Ich glaube, die größte und entscheidende Reform war diejenige, die die Individualbeschwerde als einen bindenden Bestandteil des Vertragswerkes eingeführt hat. Das geschah im Jahre 1998, bis dahin war die Individualbeschwerde nicht zwingend vorgeschrieben, sondern man konnte sich der Konvention unterwerfen, konnte aber sagen: Ich will den Sanktionsmechanismus der Straßburger Institution nicht akzeptieren, es reicht mir, ich halte von mir aus, mit meinen Gerichten, meinen Verwaltungsbehörden die Rechte ein und ich brauche keine internationale Kontrolle. Damit ist es jetzt vorbei.
Bürger: Lässt sich sagen, welche Punkte der Menschenrechtskonvention über die Jahre für die größten Konflikte gesorgt haben?
Tomuschat: Die Menschenrechtskonvention ist insbesondere wirksam geworden auf dem Gebiet der prozessualen Rechte, sowohl im Strafprozess wie im Zivilprozess, da hat vieles im Argen gelegen. Ein großes Thema ist die überlange Verfahrensdauer. Auch Deutschland ist insoweit nicht ganz unschuldig, auch Deutschland ist mehrfach verurteilt worden wegen überlanger Verfahrensdauer. Auch das Bundesverfassungsgericht ist in einigen Fällen diesem Tadel nicht entgangen, und das hat heute vor allem eine unendlich große Bedeutung, vor allem in den früheren kommunistischen Ländern, in Russland. Die Unparteilichkeit der Justiz, das ist ein ganz großes Thema, und das gilt auch für die Türkei, die in den vielen Jahren immer eine unendlich große Anzahl von Beschwerden auf sich gezogen hat.
Bürger: Immer stärker in den Mittelpunkt gerückt ist vermutlich auch Artikel 9 über die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Ist das noch das richtige Instrument in einer Zeit jetzt, in der in vielen Ländern über Kruzifixe, über Minarette, über Burkas verhandelt wird? In religiösen Fragen und beim Verhältnis von Staat und Kirche gibt es ja innerhalb Europas sehr große Unterschiede.
Tomuschat: Ja, natürlich, das ist nach wie vor eine grundlegende Freiheit, und für viele Autoren ist überdies die Religionsfreiheit die grundlegende Freiheit, aus der alle Menschenrechte erwachsen sind. Ob das stimmt, wage ich zu bezweifeln, aber nach wie vor nimmt die Religionsfreiheit eine zentrale Stellung ein. Nun geht es darum – ich glaube, das Prinzip ist völlig unbestritten –, es geht nur darum, die Grenzen zu ziehen, gewisse Schranken auch zu betonen. Was bedeutet es etwa, wenn in Klassenzimmern ein Kruzifix aufgehängt wird? Ist das zu rechtfertigen als Teil der kulturellen Tradition eines Landes, wie Italien das sagt, oder ist das eine Verletzung der Religionsfreiheit der Kinder und auch der Eltern? Und darüber wird im Augenblick gestritten, da gibt es ein Verfahren vor dem Gerichtshof, das in erster Instanz zum Nachteil von Italien geendet hat, und in zweiter Instanz hofft natürlich Italien, diesen Richterspruch korrigieren zu können.
Bürger: Über 60 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention sprechen wir hier im Deutschlandradio Kultur mit dem Völkerrechtler Christian Tomuschat. Herr Tomuschat, in welchen Ländern entfaltet denn diese Konvention derzeit eine besonders starke Wirkung?
Tomuschat: Ja ich glaube, die Konvention ist besonders wichtig für diejenigen Länder, wo das Rechts- und Verfassungsgebäude noch nicht so gut konsolidiert ist, und ich muss nochmals Russland nennen und auch die Türkei. In Russland liegt das Rechtswesen doch noch im Argen, die Rechtsstaatlichkeit hat sich noch nicht gefestigt in dem Maße, wie es die Konvention verlangt. Im Augenblick sind ungefähr 38.000 Beschwerden gegen Russland beim Europäischen Gerichtshof anhängig. Ob er das jemals wird bewältigen können, ist eine offene Frage. Auch die Türkei hat vor allem wegen der Auseinandersetzungen mit den Kurden immer sehr stark den Gerichtshof beschäftigt und tut es nach wie vor. Italien ist hervorgetreten vor allem wegen der überlangen Verfahrensdauer, die italienische Gerichtsbarkeit ist offenbar nicht gerüstet für eine rasche Erledigung der anhängigen Rechtssachen. Also jedes Land hat so seine Besonderheiten. Im Allgemeinen steht die Bundesrepublik Deutschland sehr gut da, vor allem deswegen, weil es bei uns ja die Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe gibt, und man muss zunächst den Rechtsweg nach Karlsruhe beschreiten, ehe man sich an den Straßburger Gerichtshof wenden kann. Und das Bundesverfassungsgericht erkennt schon, wenn es bei uns zu grundlegenden Verstößen gekommen ist, jedenfalls in der Regel, es bleibt nur noch sehr wenig zu korrigieren für den Straßburger Gerichtshof.
Bürger: Das heißt, in der Tat ist diese Europäische Menschenrechtskonvention so was wie ein Gradmesser dafür, wie ausgeprägt die Demokratie in einem Land ist oder eben auch nicht?
Tomuschat: Das kann man sagen, wobei man die beiden Worte Demokratie und Rechtsstaatlichkeit miteinander verbinden muss. Eine Demokratie könnte ja auch dazu benutzt werden, um rechtsstaatliche Garantien wie Meinungsfreiheit durch eine Herrschaft der Mehrheit außer Kraft zu setzen, also Demokratie, das allein sollte man nicht sagen, sondern sollte die Demokratie immer im Zusammenhang mit Rechtsstaatlichkeit erwähnen.
Bürger: Auch UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon wird ja beim heutigen Festakt in Straßburg dabei sein. Inwieweit reicht die Europäische Menschenrechtskonvention denn über den europäischen Kontinent hinaus? Ist sie ein vorbildliches Modell für globale Menschenrechte?
Tomuschat: Ich glaube, das kann man so sagen. Auf Weltebene gibt es den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der in seinen Formulierungen sehr ähnlich ist der Europäischen Konvention. Das rührt aber daher, dass eben die Europäische Konvention auf den Vorarbeiten der Vereinten Nationen beruht. Es ist also nicht so, dass die Vereinten Nationen von den Europäern abgeschrieben hätten. Und der Internationale Pakt ist deswegen sehr viel weniger wirksam, weil es dieses Individualbeschwerdeverfahren nicht gibt. Es gibt den Menschenrechtsausschuss nach dem Pakt, man kann sich auch mit einer Beschwerde an den Menschenrechtsausschuss wenden, aber die Stellungnahmen zu diesen Beschwerden sind nicht verbindlicher Art. Sie sind lediglich Empfehlungen an die Mitgliedsstaaten, haben deswegen natürlich eine sehr viel geringere Durchsetzungskraft.
Bürger: Auf dem Papier sieht die Einhaltung der Menschenrechte anscheinend also vorbildlich aus, und doch ist die Realität häufig deutlich finsterer. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts jetzt – fehlt Ihnen noch irgendetwas in der Europäischen Menschenrechtskonvention?
Tomuschat: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist bewusst als eine Kodifizierung von Freiheitsrechten geschaffen worden und von politischen Rechten. Sie enthält nur in Ansätzen gewisse ökonomische und soziale Rechte. Es ist die große Frage, ob man mit solchen Rechten auch ein Individualbeschwerdeverfahren kombinieren kann. Das ist nicht so ganz eindeutig. Es ist natürlich sehr viel leichter, die Freiheitsrechte durch ein gerichtliches Verfahren zu schützen als bei solchen Rechten wie dem Recht auf Arbeit oder dem Recht auf ordentliche Arbeitsbedingungen oder dem Recht auf Gesundheit oder dem Recht auf Erziehung, wo der Staat alle möglichen Maßnahmen treffen muss, um dieses Recht wirklich effektiv auszugestalten. Und es ist wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich, den Katalog zu ergänzen oder wäre nicht sehr erfolgreich. Ich glaube, man sollte bei dem Modell bleiben, und muss sich bei den sozialen und wirtschaftlichen Rechten eben andere Durchsetzungsmechanismen ausdenken.
Bürger: 60 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention im Blick des Völkerrechtlers Christian Tomuschat. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Tomuschat!
Tomuschat: Herzlichen Dank!