Wie wirksam sind Psychotherapien?

Trauer oder Wut, Ängste oder Zwänge: Etwa 30 Prozent der Deutschen leiden unter psychischen Problemen. Aber nur ein kleiner Teil begibt sich in Therapie. Welchen Anteil sie an Verbesserung oder Verschlechterung der Symptome hat, wird gerade erforscht.
Beate Holz (Name geändert): "Ich habe öfter gesagt, es hilft mir nicht. Sie kann mir jetzt ja hier schön erzählen, oder sie hört mir 50 Minuten zu, aber es passiert doch gar nichts."
Lukas Schilling (Name geändert): "Dieses ganze Abgekoppelte von ‚Ich setze mich hin und in diesen Sitzungen bewege ich etwas‘, funktioniert einfach in meinem Leben nicht."
Etwa 30 Prozent der Menschen leiden unter psychischen Problemen. Nicht jeder benötigt eine Behandlung, aber für schwer Erkrankte gibt es wirksame Therapien. Doch meist ist es langwierig und kompliziert, die richtige Hilfe zu finden.
Beate Holz: "Ich hatte eine Therapeutin, die sagte: ‚Sie müssen Ihre Einstellung ändern.‘ Im Endeffekt ist das ja richtig. Aber ich habe gesagt: ‚Wie mache ich denn das?‘ Tja, dazu konnte sie mir jetzt nicht eine genaue Anleitung geben."
Lukas Schilling: "Die Therapieformen, wo es darum geht, im Leben zu stehen und ein Leben zu haben, die sind erfolgreicher und so ging es mir tatsächlich auch."
Nicht jede Methode führt bei jedem zu einer Verbesserung der Symptome. Psychotherapien müssen sehr individuell angepasst werden. Dabei wird Patienten viel abverlangt und ihr Leidensweg ist oft viel zu lang.
Beate Holz: "Ich habe wenig Verständnis dafür erlebt, auch in meinem Umfeld. Weil die immer sagten: ‚Du musst doch viel mehr Geduld haben und wenn es dir nicht hilft, es wird schon helfen, es muss ja erst einmal wirken.‘ Und ich habe das dann so ein paar Monate gemacht und als ich dann gemerkt habe, das bringt mir doch nichts. Was soll ich denn da hingehen?"
Lukas Schilling (Name geändert): "Dieses ganze Abgekoppelte von ‚Ich setze mich hin und in diesen Sitzungen bewege ich etwas‘, funktioniert einfach in meinem Leben nicht."
Etwa 30 Prozent der Menschen leiden unter psychischen Problemen. Nicht jeder benötigt eine Behandlung, aber für schwer Erkrankte gibt es wirksame Therapien. Doch meist ist es langwierig und kompliziert, die richtige Hilfe zu finden.
Beate Holz: "Ich hatte eine Therapeutin, die sagte: ‚Sie müssen Ihre Einstellung ändern.‘ Im Endeffekt ist das ja richtig. Aber ich habe gesagt: ‚Wie mache ich denn das?‘ Tja, dazu konnte sie mir jetzt nicht eine genaue Anleitung geben."
Lukas Schilling: "Die Therapieformen, wo es darum geht, im Leben zu stehen und ein Leben zu haben, die sind erfolgreicher und so ging es mir tatsächlich auch."
Nicht jede Methode führt bei jedem zu einer Verbesserung der Symptome. Psychotherapien müssen sehr individuell angepasst werden. Dabei wird Patienten viel abverlangt und ihr Leidensweg ist oft viel zu lang.
Beate Holz: "Ich habe wenig Verständnis dafür erlebt, auch in meinem Umfeld. Weil die immer sagten: ‚Du musst doch viel mehr Geduld haben und wenn es dir nicht hilft, es wird schon helfen, es muss ja erst einmal wirken.‘ Und ich habe das dann so ein paar Monate gemacht und als ich dann gemerkt habe, das bringt mir doch nichts. Was soll ich denn da hingehen?"
Welche Rolle spielen die Gene?
"Martin Keck, Max -Planck-Institut für Psychiatrie."
München. Hier wird zur Wirksamkeit von Psychotherapie geforscht.
Martin Keck: "Das ist gut. Die Studie. Da komme ich gleich vorbei und schaue mir mal die Bilder und Laborwerte an."
Prof. Martin Keck leitet eine Studie, für die über acht Jahre rund 1000 Patienten mit Depressionen begleitet werden sollen. Das Forscherteam um den Mediziner möchte herausfinden, welche Therapieform welchem Patienten hilft und was sich dabei an biologischen Vorgängen verändert.
Martin Keck: "Wir können untersuchen, welche Gene werden zum Beispiel an- oder ausgeschaltet, was geschieht im Immunsystem, wie verändern sich Entzündungszellen, die auch bei der Depression eine große Rolle spielen, wie entstehen neue Nervenzellverbindungen? Das bedeutet ja Lernen, dass sich Nervenzellverbindungen neu bilden und oder verstärken. Das alles geschieht natürlich während einer Psychotherapie, denn es ist ein Lernvorgang, ein Relearning, wo wir krankmachendes Verhalten günstig beeinflussen möchten."
Schädliche oder nicht sinnvolle Verhaltensmuster sollen überschrieben werden. Strukturelle Veränderungen im Gehirn lassen sich dabei zum Beispiel durch moderne Bildgebungsverfahren darstellen.
Martin Keck: "Wir kennen bereits einige Gehirnregionen, die sehr gute Prognosemöglichkeiten bieten. Das ist da sogenannte Cingulum zum Beispiel im Gehirn. Das ist wie eine Schaltstelle zwischen Emotion und Verhalten, das bei bestimmten Depressionsformen eine unterschiedliche Aktivität aufweist und das könnte ein sehr wertvoller prognostischer Parameter sein, den man auch einfach und ohne den Patienten zu sehr belasten zu müssen, untersuchen kann."
Das Gespräch mit den Patienten wird das nicht ersetzen, zumal es integraler Bestandteil jeder Therapie ist. Bei der Suche nach messbaren, aussagekräftigen Parametern geht es den Wissenschaftlern vielmehr um die Objektivierung der Diagnostik. Bisher müssen sich Patienten auf die Erfahrung ihrer Behandler verlassen und die Therapeuten sind fast ausschließlich auf die Schilderungen der Hilfesuchenden angewiesen.
Martin Keck: "Wir sind heute noch ein bisschen auf dem Niveau, wie wenn wir die Diagnose Fieber hätten, 40 Grad Fieber und das dann immer gleich behandeln wollten. Das bringt natürlich nichts, weil hinter 40 Grad Fieber können sich verschiedenste Erkrankungen verbergen. Von einer Lungenentzündung bis zu einer Knochenentzündung. Das muss man ja erst herausfinden, um gezielt behandeln zu können.
München. Hier wird zur Wirksamkeit von Psychotherapie geforscht.
Martin Keck: "Das ist gut. Die Studie. Da komme ich gleich vorbei und schaue mir mal die Bilder und Laborwerte an."
Prof. Martin Keck leitet eine Studie, für die über acht Jahre rund 1000 Patienten mit Depressionen begleitet werden sollen. Das Forscherteam um den Mediziner möchte herausfinden, welche Therapieform welchem Patienten hilft und was sich dabei an biologischen Vorgängen verändert.
Martin Keck: "Wir können untersuchen, welche Gene werden zum Beispiel an- oder ausgeschaltet, was geschieht im Immunsystem, wie verändern sich Entzündungszellen, die auch bei der Depression eine große Rolle spielen, wie entstehen neue Nervenzellverbindungen? Das bedeutet ja Lernen, dass sich Nervenzellverbindungen neu bilden und oder verstärken. Das alles geschieht natürlich während einer Psychotherapie, denn es ist ein Lernvorgang, ein Relearning, wo wir krankmachendes Verhalten günstig beeinflussen möchten."
Schädliche oder nicht sinnvolle Verhaltensmuster sollen überschrieben werden. Strukturelle Veränderungen im Gehirn lassen sich dabei zum Beispiel durch moderne Bildgebungsverfahren darstellen.
Martin Keck: "Wir kennen bereits einige Gehirnregionen, die sehr gute Prognosemöglichkeiten bieten. Das ist da sogenannte Cingulum zum Beispiel im Gehirn. Das ist wie eine Schaltstelle zwischen Emotion und Verhalten, das bei bestimmten Depressionsformen eine unterschiedliche Aktivität aufweist und das könnte ein sehr wertvoller prognostischer Parameter sein, den man auch einfach und ohne den Patienten zu sehr belasten zu müssen, untersuchen kann."
Das Gespräch mit den Patienten wird das nicht ersetzen, zumal es integraler Bestandteil jeder Therapie ist. Bei der Suche nach messbaren, aussagekräftigen Parametern geht es den Wissenschaftlern vielmehr um die Objektivierung der Diagnostik. Bisher müssen sich Patienten auf die Erfahrung ihrer Behandler verlassen und die Therapeuten sind fast ausschließlich auf die Schilderungen der Hilfesuchenden angewiesen.
Martin Keck: "Wir sind heute noch ein bisschen auf dem Niveau, wie wenn wir die Diagnose Fieber hätten, 40 Grad Fieber und das dann immer gleich behandeln wollten. Das bringt natürlich nichts, weil hinter 40 Grad Fieber können sich verschiedenste Erkrankungen verbergen. Von einer Lungenentzündung bis zu einer Knochenentzündung. Das muss man ja erst herausfinden, um gezielt behandeln zu können.
Wir müssen besser in die Lage kommen, objektivierbar zu sagen mit biologischen Messgrößen, das ist Depression a, das ist Depression b, das ist Despression c und aus diesem Grund empfehlen wir Behandlung a, b oder c, denn diese wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schnell helfen."
"Es ist so zum Heulen"
Lukas Tagebuch: "Mir ist echt zum Aufgeben zu Mute. Es ist so zum Heulen. Ich kämpfe und kämpfe und komme nicht vorwärts. Überall, wo ich hingucke, eine Baustelle. Es bewegt sich hier kaum etwas."
Diese Aufnahme ist vier Jahre alt. Damals hat sich Lukas Schilling mit seinem Handy in Situationen aufgezeichnet, in denen es ihm besonders schlecht ging.
Lukas Tagebuch: "Im Augenblick sind starke Schuldgefühle aufgetaucht, die mich richtig auffressen. Das ist ... Das tut richtig im Bauch weh schon. Ich habe da, glaube ich, auch schon bisschen Panik. Das Ganze ausgelöst durch ein Missverständnis mit meiner Chefin. Wo ich denke: ,Oh mein Gott, die wird mich doof finden. Sie wird mich rausschmeißen‘. Dahinter steckt, dass ich einfach richtig Angst habe, dass mich die Leute nicht mögen, dass ich denen vor den Kopf stoße und sie mich dann am Ende verlassen."
Diese Aufnahme ist vier Jahre alt. Damals hat sich Lukas Schilling mit seinem Handy in Situationen aufgezeichnet, in denen es ihm besonders schlecht ging.
Lukas Tagebuch: "Im Augenblick sind starke Schuldgefühle aufgetaucht, die mich richtig auffressen. Das ist ... Das tut richtig im Bauch weh schon. Ich habe da, glaube ich, auch schon bisschen Panik. Das Ganze ausgelöst durch ein Missverständnis mit meiner Chefin. Wo ich denke: ,Oh mein Gott, die wird mich doof finden. Sie wird mich rausschmeißen‘. Dahinter steckt, dass ich einfach richtig Angst habe, dass mich die Leute nicht mögen, dass ich denen vor den Kopf stoße und sie mich dann am Ende verlassen."
Seit der Aufnahme ist viel passiert. Während damals Ängste und selbstzerstörerische Gedanken seinen Alltag prägten, geht es Lukas heute viel besser. Der 34-Jährige ist mittlerweile sogar verheiratet und Vater einer kleinen Tochter.
Lukas Schilling: "Wir laufen jetzt einfach geradeaus und dann da hoch."
Er ist von Berlin in den Schwarzwald gezogen. Oft zieht es ihn in die Natur.
Lukas trägt seine Tochter auf dem Arm. An den Hängen grasen Ziegen. Ein schmaler Wanderweg führt durch das Grün.
Autor: "Warum ist dir die Natur so wichtig?"

Schuldgefühle und Selbstzweifel - die Patienten kommen mit ihrer Umwelt nicht mehr klar.© picture alliance/dpa/Foto: Klaus Rose
Lukas Schilling: "Das hilft mir, mich auf schwierige Gefühle einzulassen. Die ganzen Schmerzen, das Unwohlsein, alles, was ich im Alltag nicht schaffe zu bewältigen, was aber da ist, das kommt dann da raus, weil ich mich sicher fühle. Das heißt, wenn ich mich auf die Natur einlasse, habe ich das Gefühl, dass ich geborgen bin. Dadurch brechen dann richtig krasse Gefühle auch raus, die ich dann auch lange aushalten kann."
Lukas Tagebuch: "Ich bin wieder gerade in einem der ganz großen Löcher. Und es ist kaum auszuhalten. Ich habe immer wieder Ansätze von Flashbacks, die ich immer wieder verdränge, indem ich Krampfanfälle bekomme. So erkläre ich es mir zumindest."
Autor: "Damals, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da hast du ja von Flashbacks gesprochen, konntest das aber gar nicht richtig einschätzen und warst auch gerade dran, überhaupt rauszufinden, was der Ursprung all deiner widersprüchlichen Gefühle ist. Bis du da weitergekommen?"
Lukas Schilling: "Ja, ich habe dann in Traumasitzungen festgestellt, dass das tatsächlich Kindesmissbrauch war und das in jungen Kinderjahren. Und das war auch sehr schwerwiegend, so dass ich mir zusammenreimen kann, weshalb mein Leben dann so schwierig wurde, vor allem weil ich bis ins Erwachsenalter gar nicht gemerkt habe, was dem zugrunde liegt."
Autor: "Du hast das so sehr verdrängt, dass du das gar nicht mehr erinnern konntest?"
Lukas Tagebuch: "Ich bin wieder gerade in einem der ganz großen Löcher. Und es ist kaum auszuhalten. Ich habe immer wieder Ansätze von Flashbacks, die ich immer wieder verdränge, indem ich Krampfanfälle bekomme. So erkläre ich es mir zumindest."
Autor: "Damals, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da hast du ja von Flashbacks gesprochen, konntest das aber gar nicht richtig einschätzen und warst auch gerade dran, überhaupt rauszufinden, was der Ursprung all deiner widersprüchlichen Gefühle ist. Bis du da weitergekommen?"
Lukas Schilling: "Ja, ich habe dann in Traumasitzungen festgestellt, dass das tatsächlich Kindesmissbrauch war und das in jungen Kinderjahren. Und das war auch sehr schwerwiegend, so dass ich mir zusammenreimen kann, weshalb mein Leben dann so schwierig wurde, vor allem weil ich bis ins Erwachsenalter gar nicht gemerkt habe, was dem zugrunde liegt."
Autor: "Du hast das so sehr verdrängt, dass du das gar nicht mehr erinnern konntest?"
Lukas Schilling: "Genau und dann ist es tatsächlich so langsam hochgekrochen. Eben über diese Flashbacks. Als ich dann in diesen Traumasitzungen saß, sind wir von den Flashbacks ausgehend reingegangen und da sind die ganzen Szenen dann aufgetaucht, die damals passiert sind."
Therapie mit Nebenwirkungen
Martin Keck: "Das ist sehr wichtig, weil jeder Patient möchte verstehen, warum stößt mir das zu und anderen nicht? Und da sehen sie die Individualität der Krankheitsentstehung und es ist wichtig, dass ein Patient dann auch ein Modell hat, an dem er nachvollziehen kann: Das sind bei mir Faktoren, die das begünstigt haben. Dann möglicherweise ungünstige Lebensumstände, Dauerstress durch Faktoren, die ich nicht beeinflussen konnte und ich bin daran auch nicht Schuld und ich bin diesen Dingen auch nicht hilflos ausgeliefert, sondern die kann ich jetzt angehen in der Therapie."
Oft tritt zu Beginn der Therapie aber erst einmal eine Verschlechterung ein, weil plötzlich bestimmte Probleme thematisiert werden dürfen und können. Das löst zum Teil heftige Emotionen aus.
Oft tritt zu Beginn der Therapie aber erst einmal eine Verschlechterung ein, weil plötzlich bestimmte Probleme thematisiert werden dürfen und können. Das löst zum Teil heftige Emotionen aus.
Eva-Lotta Brakemeier: "Beispielsweise habe ich eine Patientin im Kopf, die am Anfang wirklich wahnsinnig gelitten hat, wo ich mich auch wirklich gefragt habe, kann ich jetzt hier weitermachen?"
Eva-Lotta Brakemeier, Psychologin und Professorin an der Philipps-Universität Marburg.
Eva-Lotta Brakemeier: "Also wir haben an der Kindheit gearbeitet und da kam so viel hoch, wo sie jahrelang nicht drüber gesprochen hat und in den ersten zwei Wochen hat sie so viel geweint, konnte schlechter schlafen. Und dann ging es ihr aber irgendwann besser und dann deutlich besser. Nach zwölf Wochen konnten wir sie entlassen und sie hat gesagt, so gut wie jetzt hat sie sich noch nie gefühlt."
Eva-Lotta Brakemeier hat zu Nebenwirkungen geforscht, die mit Psychotherapien einhergehen. Denn genau wie bei Medikamenten kann es zu unerwünschte Effekten kommen, die durch die Behandlung verursacht werden. Eine zeitweise Verschlechterung gehört dazu.
Eva-Lotta Brakemeier: "Das muss man als Nebenwirkung bezeichnen. Es ist auch wichtig, Patienten darauf vorzubereiten. Aber letztlich dann schauen, wie hängt das langfristig auch mit der Wirksamkeit zusammen oder wie wirkt sich das aus. Und in manchen Fällen, gerade bei chronischen Patienten, Patienten mit schwierigen frühen Beziehungserfahrungen, kann es gerade wichtig sein, so tief noch einmal in die Kindheit einzusteigen, um sie dann langfristig auch aus dieser chronifizierten Störung rauszubringen."
Lange wurden Nebenwirkungen in der Psychotherapie nicht ausreichend betrachtet. Wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt es erst seit etwa 15 Jahren. In der Studie von Eva- Lotta Brakemeier berichteten 93 Prozent der befragten Patienten von unerwünschten Begleiterscheinungen.
Eva-Lotta Brakemeier: "Sei es eine kurzfristige Verschlechterung, sei es Konflikte mit Teammitgliedern oder Mitpatienten. Sei es langfristig dann auch Schwierigkeiten interpersonell. Es gab auch einige Trennungen nach der Therapie."
Beate Holz: "Es geht ja um mich und wenn ich dann Menschen habe, die nur aus egoistischen Motiven handeln oder immer wollen, dass ich ihre Wünsche erfülle, dann muss ich auch auf die Menschen verzichten. Zum Beispiel habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern."
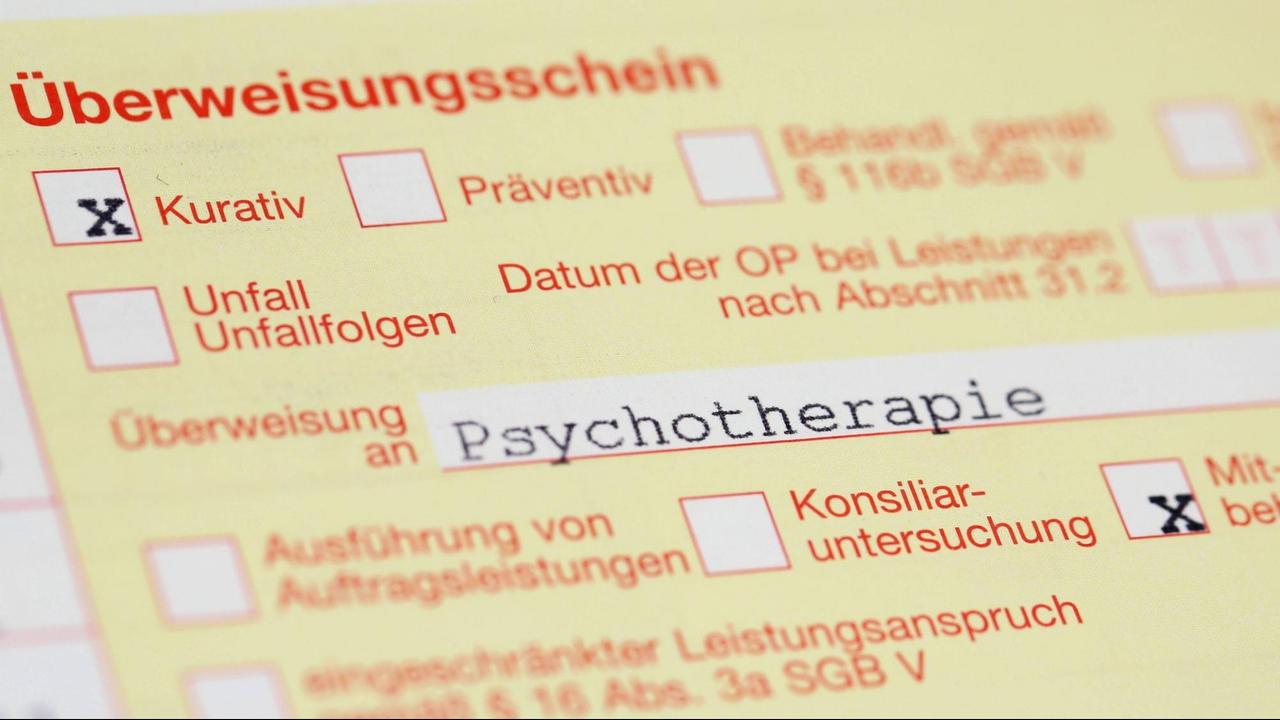
Zu Beginn einer Therapie verstärken sich oftmals die Symptome.© imago stock&people
Behandlungsfehler und falsche Diagnosen
Beate Holz - über 20 Jahre hat die Rheinländerin unter Angstzuständen und einer schweren Depression gelitten. Als endlich eine Therapie zu einer Verbesserung ihres Gesundheitszustandes führte, wuchs ihr Selbstbewusstsein und sie stellte Beziehungen in Frage.
Beate Holz: "Meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben - auch bis heute, ich habe immer wieder den Kontakt gesucht – ich mache etwas falsch, ich bin schuld, an mir ist etwas nicht richtig und sie sind die Opfer. Und mit denen habe ich dann bewusst den Kontakt abgebrochen und habe ihnen aber auch geschrieben warum."
Auch das Verhältnis zu ihrem Mann hat sich verändert.
Beate Holz: "Er sagt, ich bin frecher geworden. Heutzutage sage ich ihm auch, wenn mich etwas verletzt, das finde ich jetzt nicht in Ordnung oder das tut mir weh. Da kann er auch ganz gut mit umgehen, manchmal ist er noch beleidigt, aber dann merke ich auch, es passiert mir ja gar nichts."
Eva-Lotta Brakemeier: "Wichtig ist dann ein Nebenwirkungsmanagement. Also dass der Therapeut aufklärt: Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wird die Therapie Ihnen helfen, aber es kann auch sein, dass es Ihnen erst einmal schlechter geht, dass es Auswirkungen auf das Umfeld hat und so weiter. Ich werde Sie dabei aber begleiten, wenn diese Nebenwirkungen auftreten. Das ist wichtig, dass Sie mir dann davon berichten und dass wir beide dann schauen, wie Sie am besten damit umgehen."
Von Nebenwirkungen sprechen Wissenschaftler nur, wenn die Psychotherapie korrekt durchgeführt wurde. Demgegenüber stehen Behandlungsfehler, also wenn Therapeuten falsche Diagnosen stellen, falsche Techniken anwenden oder sich unethisch verhalten. Auch das kann zu dramatischen Verschlechterungen führen.
Diese Erfahrung musste auch eine Patientin machen, die sich nach einer traumatischen Therapie an den Ethikverein gewandt hat. Dort werden Menschen beraten, die sich falsch behandelt fühlen.
Andrea Schleu: "Die Patientin, die schon als Kind einen sexuellen Missbrauch erlebt hatte, war wegen ihrer Symptomatik zum Arzt gegangen und nach 25 Stunden Kurzzeittherapie war der Therapeut nicht bereit, einen Verlängerungsantrag zu stellen, sondern er hat von der Patientin gefordert, dass sie das jetzt selbst privat zahlt. Er hat das dann so begründet: ‚Sie sind so krank, dass Sie eh kein anderer behandelt. Sie sollten froh sein, dass Sie jemanden gefunden haben.‘"
Erzählt Dr. Andrea Schleu. Die Fachärztin für psychotherapeutische Medizin ist Vorsitzende des Ethikvereins und betreut regemäßig Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen mussten wie die Patientin. Deren Situation eskalierte immer weiter.
Beate Holz: "Meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben - auch bis heute, ich habe immer wieder den Kontakt gesucht – ich mache etwas falsch, ich bin schuld, an mir ist etwas nicht richtig und sie sind die Opfer. Und mit denen habe ich dann bewusst den Kontakt abgebrochen und habe ihnen aber auch geschrieben warum."
Auch das Verhältnis zu ihrem Mann hat sich verändert.
Beate Holz: "Er sagt, ich bin frecher geworden. Heutzutage sage ich ihm auch, wenn mich etwas verletzt, das finde ich jetzt nicht in Ordnung oder das tut mir weh. Da kann er auch ganz gut mit umgehen, manchmal ist er noch beleidigt, aber dann merke ich auch, es passiert mir ja gar nichts."
Eva-Lotta Brakemeier: "Wichtig ist dann ein Nebenwirkungsmanagement. Also dass der Therapeut aufklärt: Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wird die Therapie Ihnen helfen, aber es kann auch sein, dass es Ihnen erst einmal schlechter geht, dass es Auswirkungen auf das Umfeld hat und so weiter. Ich werde Sie dabei aber begleiten, wenn diese Nebenwirkungen auftreten. Das ist wichtig, dass Sie mir dann davon berichten und dass wir beide dann schauen, wie Sie am besten damit umgehen."
Von Nebenwirkungen sprechen Wissenschaftler nur, wenn die Psychotherapie korrekt durchgeführt wurde. Demgegenüber stehen Behandlungsfehler, also wenn Therapeuten falsche Diagnosen stellen, falsche Techniken anwenden oder sich unethisch verhalten. Auch das kann zu dramatischen Verschlechterungen führen.
Diese Erfahrung musste auch eine Patientin machen, die sich nach einer traumatischen Therapie an den Ethikverein gewandt hat. Dort werden Menschen beraten, die sich falsch behandelt fühlen.
Andrea Schleu: "Die Patientin, die schon als Kind einen sexuellen Missbrauch erlebt hatte, war wegen ihrer Symptomatik zum Arzt gegangen und nach 25 Stunden Kurzzeittherapie war der Therapeut nicht bereit, einen Verlängerungsantrag zu stellen, sondern er hat von der Patientin gefordert, dass sie das jetzt selbst privat zahlt. Er hat das dann so begründet: ‚Sie sind so krank, dass Sie eh kein anderer behandelt. Sie sollten froh sein, dass Sie jemanden gefunden haben.‘"
Erzählt Dr. Andrea Schleu. Die Fachärztin für psychotherapeutische Medizin ist Vorsitzende des Ethikvereins und betreut regemäßig Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen mussten wie die Patientin. Deren Situation eskalierte immer weiter.
Therapie und Qualitätskontrolle
Andrea Schleu: "Die Patientin hat zwei Jahre lang die Therapie – in Anführungsstrichen – bezahlt und fühlte sich dann auch noch als besondere Patientin, weil sie für ihn putzen und waschen und ihm auch sonst helfen durfte. Das kam dann am Ende auch zu sexuellem Missbrauch und die hat das erst aber nach Beratungsstelle und Ethikverein und Frauennotruf, sie hat also mehrere Stellen gebraucht, um sich aus dieser Behandlung wirklich lösen zu können."
Mehr als 200 Fälle verzeichnet der Ethikverein im Jahr. Ehrenamtliche kümmern sich um die Patienten. Es fehlt eine öffentlich geförderte Beratungseinrichtung in Deutschland. Zuständig sind momentan die Berufskammern. Nach Meinung von Andrea Schleu erfüllen sie aber ihre Aufgabe nicht.
Andrea Schleu: "In den Berufskammern erleben wir immer wieder, dass Patienten abgewiesen werden. Da steht Aussage gegen Aussage oder sie bekommen überhaupt keine Auskunft, ob überhaupt ein Verfahren eröffnet worden ist und bei den Heilpraktikern Psychotherapie sind die Gesundheitsämter zuständig. Auch da erleben die Patienten eigentlich abgewiesen werden und kein Ernst-nehmen ihrer Beschwerden. Das ist auch eher traumatisierend für solche Patienten und überhaupt nicht hilfreich."
Oft trauen sich Patienten gar nicht erst die Kompetenz oder das Verhalten ihres Behandlers in Frage zu stellen, obwohl sie Bedenken oder Zweifel haben.
Andrea Schleu: "Und das ist das Entscheidende, wenn man ein komisches Gefühl hat, dann sollte man es sehr ernst nehmen. Man sollte zunächst mit dem Therapeuten versuchen, es zu klären und zu fragen. Wenn das nicht geht, sollte man sich eine zweite Meinung holen wie in jedem anderen Gebiet im Gesundheitswesen auch. Da guckt dann letztlich ein Dritter drauf auf eine Therapiesituation, wo ja sonst immer nur zwei sind."
Sami Egli: "Ja, Sarah, wir sehen uns zur Supervision. Und ich würde dich, wie ich es so oft mache, zu Beginn der Supervision fragen, was für ein Anliegen du mitgebracht hast heute."
Ein Mittel zur Qualitätskontrolle in der Psychotherapie könnten Super- oder Intervisionen sein. Also der regelmäßige Austausch von Therapeuten über konkrete, komplexe Fälle im Kollegenkreis oder mit einem Supervisor.
Mehr als 200 Fälle verzeichnet der Ethikverein im Jahr. Ehrenamtliche kümmern sich um die Patienten. Es fehlt eine öffentlich geförderte Beratungseinrichtung in Deutschland. Zuständig sind momentan die Berufskammern. Nach Meinung von Andrea Schleu erfüllen sie aber ihre Aufgabe nicht.
Andrea Schleu: "In den Berufskammern erleben wir immer wieder, dass Patienten abgewiesen werden. Da steht Aussage gegen Aussage oder sie bekommen überhaupt keine Auskunft, ob überhaupt ein Verfahren eröffnet worden ist und bei den Heilpraktikern Psychotherapie sind die Gesundheitsämter zuständig. Auch da erleben die Patienten eigentlich abgewiesen werden und kein Ernst-nehmen ihrer Beschwerden. Das ist auch eher traumatisierend für solche Patienten und überhaupt nicht hilfreich."
Oft trauen sich Patienten gar nicht erst die Kompetenz oder das Verhalten ihres Behandlers in Frage zu stellen, obwohl sie Bedenken oder Zweifel haben.
Andrea Schleu: "Und das ist das Entscheidende, wenn man ein komisches Gefühl hat, dann sollte man es sehr ernst nehmen. Man sollte zunächst mit dem Therapeuten versuchen, es zu klären und zu fragen. Wenn das nicht geht, sollte man sich eine zweite Meinung holen wie in jedem anderen Gebiet im Gesundheitswesen auch. Da guckt dann letztlich ein Dritter drauf auf eine Therapiesituation, wo ja sonst immer nur zwei sind."
Sami Egli: "Ja, Sarah, wir sehen uns zur Supervision. Und ich würde dich, wie ich es so oft mache, zu Beginn der Supervision fragen, was für ein Anliegen du mitgebracht hast heute."
Ein Mittel zur Qualitätskontrolle in der Psychotherapie könnten Super- oder Intervisionen sein. Also der regelmäßige Austausch von Therapeuten über konkrete, komplexe Fälle im Kollegenkreis oder mit einem Supervisor.
Sarah Leissner: "Ja, ich habe ein Video mitgebracht zur letzten Stunde eines Patienten und mein Anliegen wäre, dass wir meine Modelleinordnung vielleicht noch einmal überprüfen und ableiten, was wären denn jetzt so die nächsten Schritte für die nächsten Stunden."
Sami Egli: "Ok, gut."
Die Psychologen Dr. Sami Egli und Sarah Leissner treffen sich am Max-Planck- Institut für Psychiatrie in München regelmäßig zur Supervision. Im Rahmen der Studie zur Wirksamkeit von Psychotherapie findet sie für jede Behandlung statt, damit alle Therapeuten die zu untersuchenden Methoden gleich und korrekt anwenden. Nur so lassen sich die Ergebnisse hinterher vergleichen. Aber auch in der klinischen Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten ist die Supervision verpflichtend.
Sami Egli: "Ok, gut."
Die Psychologen Dr. Sami Egli und Sarah Leissner treffen sich am Max-Planck- Institut für Psychiatrie in München regelmäßig zur Supervision. Im Rahmen der Studie zur Wirksamkeit von Psychotherapie findet sie für jede Behandlung statt, damit alle Therapeuten die zu untersuchenden Methoden gleich und korrekt anwenden. Nur so lassen sich die Ergebnisse hinterher vergleichen. Aber auch in der klinischen Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten ist die Supervision verpflichtend.
Supervision für Therapeuten ist freiwillig
Sarah Leissner: "Das ist wichtig, dass es einen weiterbringt und man sich entwickelt als Therapeut und die Möglichkeit hat, einfach bei einem erfahrenen Therapeuten einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Man lernt sich selber auch besser kennen, also der Supervisor hilft einen auch dabei, eigene Anteile, die man vielleicht ins Patientengespräch einbringt, deutlicher kennenzulernen. Und es gibt mit Sicherheit Situationen, wo es vielleicht auch schwierig ist, weiter zu kommen und man froh ist, wenn man den Input von außen noch einmal bekommt."
Nach Abschluss der Ausbildung findet Supervision für Therapeuten allerdings nur noch freiwillig statt. Sami Egli bedauert das.
Sami Egli: "Weil man mit der Zeit natürlich blinde Flecken entwickelt und gerade auch weil man weiß aus der Expertiseforschung, Psychotherapeuten werden mit zunehmender Erfahrung nicht unbedingt besser. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass Feedbacksysteme - und Supervision ist ein Feedbacksystem - erstens nicht gut etabliert sind und zweitens, dass sie das Feedbacksystem nicht so gut nutzen. Vor der Perspektive ist es noch mal wichtiger, dass man es macht und es wäre eigentlich auch wichtig, das zu verankern."
Sami Egli: "Weil man mit der Zeit natürlich blinde Flecken entwickelt und gerade auch weil man weiß aus der Expertiseforschung, Psychotherapeuten werden mit zunehmender Erfahrung nicht unbedingt besser. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass Feedbacksysteme - und Supervision ist ein Feedbacksystem - erstens nicht gut etabliert sind und zweitens, dass sie das Feedbacksystem nicht so gut nutzen. Vor der Perspektive ist es noch mal wichtiger, dass man es macht und es wäre eigentlich auch wichtig, das zu verankern."
Wie das funktionieren könnte, zeigt das Beispiel der Schweiz. Dort ist Supervision Bestandteil der regelmäßigen Weiterbildung, die Therapeuten ohnehin absolvieren müssen. Eva-Lotta Brakemeier beschäftigt sich an der Universität Marburg mit der Qualitätssicherung von Psychotherapien. Für sie ist zusätzlich noch ein anderer Punkt wichtig.
Eva-Lotta Brakemeier: "Dass der Therapeut auch eine Diagnostik hat. Dass man im Verlauf immer wieder, dass der Patient auch Fragebögen ausfüllt, dass man immer wieder auch so ein objektives Interview durchgeht. Wir Therapeuten überschätzen uns leider. Also 80 Prozent glauben, dass sie selber zu den 20 Prozent Besten gehören und dass der Therapeut, wenn es auch mal schlecht läuft, dann eher sagt: ‚Ok, das sind halt die Umstände oder das ist der Patient und das ist nicht meine Therapie.‘"

In der Schweiz nehmen Therapeuten regelmäßig an Supervisionen teil.© dpa / picture alliance / Julian Stratenschulte
Angst, Zweifel, fehlende Selbstkontrolle
Lukas Schilling: "Ich schließe jetzt mal auf. Dann Willkommen in unserem Laden."
Lukas Schilling hat im letzten Jahr zusammen mit seiner Frau einen Tante-Emma- Laden eröffnet.
Lukas Schilling hat im letzten Jahr zusammen mit seiner Frau einen Tante-Emma- Laden eröffnet.
Lukas Schilling: "Wir haben einen großen Thekenbereich mit allem Möglichen zum Essen und Zeitschriften, dann Regale für Regionales und eine Gemüseecke."
Vor vier Jahren wäre ein eigenes Geschäft wegen seiner psychischen Probleme gar nicht denkbar gewesen, wie eine Aufnahme aus seinem Audiotagebuch von damals zeigt.
Vor vier Jahren wäre ein eigenes Geschäft wegen seiner psychischen Probleme gar nicht denkbar gewesen, wie eine Aufnahme aus seinem Audiotagebuch von damals zeigt.
Lukas Tagebuch: "Die Tagesbilanz sieht heute nicht so pralle aus. Auf Arbeit war ich komplett überfordert, habe total langsam gearbeitet, mein Denken hat nicht richtig funktioniert, weil die Anspannung so hoch war. Und immer wenn die Anspannung so hoch ist, fängt es an, dass sich Fehler einschleichen, dass ich wie neben mir stehe und dann die einfachsten Sache verpeile. Die einfachsten Sachen! Ich bin fix und alle ... Ja, scheiße!"
Lukas Schilling: "Was sich auf jeden Fall gebessert hat und was auch funktioniert, ich bekomme die Sachen gemacht und das auch Tag für Tag. Manchmal habe ich Probleme damit, das Ganze super effektiv zu machen. Das heißt Reihenfolgen 1a einhalten, aber das stört auch gar nicht. Ich habe da nicht diesen großen Druck."
Mit 24 hat Lukas die Diagnose Borderline bekommen. Erst einmal hat sie ihm geholfen zu verstehen, was mit ihm los ist.
Lukas Schilling: "Die Sache mit dem Einordnen ist sehr wichtig. Es ist nicht irgendetwas Rätselhaftes los, sondern dass ich weiß, das und das ist es. Und das war auch etwas, was mir Halt gegeben hat und auch Trost."
Viele von seinen Problemen passten in die Beschreibung der Persönlichkeitsstörung. Betroffenen ist es nicht möglich, funktionierende soziale Bindungen aufzubauen. Angst vor dem Verlassen werden einerseits und vor zu großer Nähe andererseits prägen ihren Alltag genauso wie Selbstzweifel und das Unvermögen zur Selbstkontrolle. Doch die Diagnose war auch eine Last.
Lukas Schilling: "Dadurch, dass ich mich sehr auf die Diagnose fokussiert habe, das sehr eng genommen habe, dass das eine Krankheit ist, das hat mich eingeschränkt. Und als ich das losgelassen habe, haben sich dann dadurch auch mehr Freiheiten entwickelt. Ich habe mir mehr zugetraut: Die ganzen Anforderungen mit einer kleinen Tochter, mit einem eigenen Laden, der vielen Arbeit. Das frisst zwar schon ordentlich an der Substanz, aber das hat nicht mehr dieses Beängstigende nach dem Motto ‚Oh Gott, jetzt muss ich wieder in die Psychiatrie’, oder so. Sondern das ist ein menschliches Problem und da kann mach sich ja rausarbeiten. Und durch diese Lockerheit verändert sich die Erwartungshaltung, so dass ich tatsächlich stärker bin."
Sebastian von Peter: "Ich glaube, er hat sich selber sehr stark in dieser Diagnose wiedergefunden und es hat ihm dazu verholfen, zu einer Sprache zu finden, sich mit bestimmten Problembereichen auseinandersetzen zu können und dann ist es ja gut. Die Gefahr besteht, dass eine Diagnose dazu führt, dass eine Person eine Diagnose als Label akzeptiert oder damit auch das Anderssein festschreibt."
Mit 24 hat Lukas die Diagnose Borderline bekommen. Erst einmal hat sie ihm geholfen zu verstehen, was mit ihm los ist.
Lukas Schilling: "Die Sache mit dem Einordnen ist sehr wichtig. Es ist nicht irgendetwas Rätselhaftes los, sondern dass ich weiß, das und das ist es. Und das war auch etwas, was mir Halt gegeben hat und auch Trost."
Viele von seinen Problemen passten in die Beschreibung der Persönlichkeitsstörung. Betroffenen ist es nicht möglich, funktionierende soziale Bindungen aufzubauen. Angst vor dem Verlassen werden einerseits und vor zu großer Nähe andererseits prägen ihren Alltag genauso wie Selbstzweifel und das Unvermögen zur Selbstkontrolle. Doch die Diagnose war auch eine Last.
Lukas Schilling: "Dadurch, dass ich mich sehr auf die Diagnose fokussiert habe, das sehr eng genommen habe, dass das eine Krankheit ist, das hat mich eingeschränkt. Und als ich das losgelassen habe, haben sich dann dadurch auch mehr Freiheiten entwickelt. Ich habe mir mehr zugetraut: Die ganzen Anforderungen mit einer kleinen Tochter, mit einem eigenen Laden, der vielen Arbeit. Das frisst zwar schon ordentlich an der Substanz, aber das hat nicht mehr dieses Beängstigende nach dem Motto ‚Oh Gott, jetzt muss ich wieder in die Psychiatrie’, oder so. Sondern das ist ein menschliches Problem und da kann mach sich ja rausarbeiten. Und durch diese Lockerheit verändert sich die Erwartungshaltung, so dass ich tatsächlich stärker bin."
Sebastian von Peter: "Ich glaube, er hat sich selber sehr stark in dieser Diagnose wiedergefunden und es hat ihm dazu verholfen, zu einer Sprache zu finden, sich mit bestimmten Problembereichen auseinandersetzen zu können und dann ist es ja gut. Die Gefahr besteht, dass eine Diagnose dazu führt, dass eine Person eine Diagnose als Label akzeptiert oder damit auch das Anderssein festschreibt."
Oftmals sind die Diagnosen zu starr
Dr. Sebastian von Peter. Der Psychiater hat Lukas Schilling am Berliner St. Hedwig Krankenhaus begleitet. Der Arzt kritisiert seit langem zu starre Diagnosen, weil auch sie sehr wirkmächtig sein können.
Sebastian von Peter: "Dass so etwas wie Borderline dann plötzlich als eine Identität dasteht, als gebe es so etwas in der Welt, Ursachen unbezogen und abgelöst von der Lebensgeschichte oder sozialen Zusammenhängen. Und wenn man das als solches akzeptiert, dann hört auch die Suchbewegung auf, zu verstehen, was im Vorfeld passiert ist, wie ich geworden bin, was mir helfen könnte. Alle diese Dinge sind wichtig. Und diese Fragen können im schlechtesten Fall ausgesetzt werden, indem man denkt, jetzt habe ich eine Diagnose, vielleicht gibt es noch ein passendes Medikament dazu, damit will ich mich jetzt begnügen."
Von Peter betont, dass es für Patienten nicht nur einen Weg aus der Krise gibt. Sie müssten lernen, auf sich selbst zu hören. Unterstützung und Austausch mit Freunden oder Familienmitgliedern sei dabei entscheidend. Wichtig wäre auch, dass Patienten sich von professionellen Kategorien und Diagnosen lösen. Eine Sicht, die nicht alle seine Kollegen teilen.
Sebastian von Peter: "Weil es auch dazu führt, dass unsere professionelle Kompetenz vielleicht nicht mehr ganz so notwendig ist, also dass wir entmachtet werden oder ein Stück unserer Macht abgeben müssen oder müssten. Und ich glaube, das beunruhigt das System. Letztendlich geht es darum, Menschen zu begleiten in Krisen und sich zur Verfügung zu stellen. Eher als Mensch als als Profi mit Fachwissen und auch eher als jemand, der selbst auch Krisenerfahrung hat, als jemand, der offiziell gesund ist. Ich glaube, das hilft den Menschen nur begrenzt."
Beate Holz: "Ich habe da manchmal gedacht, ich rede da jetzt ja mit einer Statue. Die geben dann zwar sehr schöne Worte von sich: ‚Versuchen Sie doch mal dieses, oder machen Sie doch mal jenes. Und das kommt daher, weil Ihre Mutter so krank war` Aber dieses persönliche Feedback oder diese Nähe war nicht da."
Ein Grund, warum Beate Holz bei ihren zahlreichen Therapien jahrelang nicht weiterkam. Immer wieder versuchte sie vergeblich, ihrer schweren Depression etwas entgegen zu setzen
Beate Holz: "Ich habe dann noch eine zweijährige Analyse gemacht, wo ich dreimal die Woche zur Therapeutin gegangen bin und als diese Therapie aufhörte, bin ich wieder in ein tiefes Loch gefallen. Ich hatte die ganze Zeit Angstzustände und Schuldgefühle, habe gedacht: ‚Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich habe doch so eine lange Therapie gemacht? Warum hilft mir das denn nicht?"
Bei etwa 30 bis 40 Prozent der Patienten tritt durch eine Psychotherapie keine Verbesserung ein, das zeigen mehrere Studien. Die Wissenschaft spricht hier von sogenannten Non Respondern. Die Kombination verschiedener Methoden könnte eine mögliche Lösung sein. Bei der Behandlung von Menschen mit chronischen Depressionen ist CBASP so ein moderner Ansatz. Die Abkürzung steht für Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy."
Eva-Lotta Brakemeier: "Das ist eine Kombination aus Psychoanalyse, kognitiver Verhaltenstherapie und interpersoneller Therapie."
Psychologieprofessorin Eva-Lotta Brakemeier wendet sie seit einigen Jahren erfolgreich an.
Sebastian von Peter: "Dass so etwas wie Borderline dann plötzlich als eine Identität dasteht, als gebe es so etwas in der Welt, Ursachen unbezogen und abgelöst von der Lebensgeschichte oder sozialen Zusammenhängen. Und wenn man das als solches akzeptiert, dann hört auch die Suchbewegung auf, zu verstehen, was im Vorfeld passiert ist, wie ich geworden bin, was mir helfen könnte. Alle diese Dinge sind wichtig. Und diese Fragen können im schlechtesten Fall ausgesetzt werden, indem man denkt, jetzt habe ich eine Diagnose, vielleicht gibt es noch ein passendes Medikament dazu, damit will ich mich jetzt begnügen."
Von Peter betont, dass es für Patienten nicht nur einen Weg aus der Krise gibt. Sie müssten lernen, auf sich selbst zu hören. Unterstützung und Austausch mit Freunden oder Familienmitgliedern sei dabei entscheidend. Wichtig wäre auch, dass Patienten sich von professionellen Kategorien und Diagnosen lösen. Eine Sicht, die nicht alle seine Kollegen teilen.
Sebastian von Peter: "Weil es auch dazu führt, dass unsere professionelle Kompetenz vielleicht nicht mehr ganz so notwendig ist, also dass wir entmachtet werden oder ein Stück unserer Macht abgeben müssen oder müssten. Und ich glaube, das beunruhigt das System. Letztendlich geht es darum, Menschen zu begleiten in Krisen und sich zur Verfügung zu stellen. Eher als Mensch als als Profi mit Fachwissen und auch eher als jemand, der selbst auch Krisenerfahrung hat, als jemand, der offiziell gesund ist. Ich glaube, das hilft den Menschen nur begrenzt."
Beate Holz: "Ich habe da manchmal gedacht, ich rede da jetzt ja mit einer Statue. Die geben dann zwar sehr schöne Worte von sich: ‚Versuchen Sie doch mal dieses, oder machen Sie doch mal jenes. Und das kommt daher, weil Ihre Mutter so krank war` Aber dieses persönliche Feedback oder diese Nähe war nicht da."
Ein Grund, warum Beate Holz bei ihren zahlreichen Therapien jahrelang nicht weiterkam. Immer wieder versuchte sie vergeblich, ihrer schweren Depression etwas entgegen zu setzen
Beate Holz: "Ich habe dann noch eine zweijährige Analyse gemacht, wo ich dreimal die Woche zur Therapeutin gegangen bin und als diese Therapie aufhörte, bin ich wieder in ein tiefes Loch gefallen. Ich hatte die ganze Zeit Angstzustände und Schuldgefühle, habe gedacht: ‚Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich habe doch so eine lange Therapie gemacht? Warum hilft mir das denn nicht?"
Bei etwa 30 bis 40 Prozent der Patienten tritt durch eine Psychotherapie keine Verbesserung ein, das zeigen mehrere Studien. Die Wissenschaft spricht hier von sogenannten Non Respondern. Die Kombination verschiedener Methoden könnte eine mögliche Lösung sein. Bei der Behandlung von Menschen mit chronischen Depressionen ist CBASP so ein moderner Ansatz. Die Abkürzung steht für Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy."
Eva-Lotta Brakemeier: "Das ist eine Kombination aus Psychoanalyse, kognitiver Verhaltenstherapie und interpersoneller Therapie."
Psychologieprofessorin Eva-Lotta Brakemeier wendet sie seit einigen Jahren erfolgreich an.
Neue Verhaltensmuster für den Alltag lernen
Eva-Lotta Brakemeier: "Der Begründer, der das entwickelt hat, James McCullough in den USA, der ist eben selbst chronisch depressiv und hat gemerkt, wenn ich jetzt rein psychoanalytisch arbeite, komme ich bei diesen Patienten, die eine chronisch Depression haben, irgendwann nicht weiter. Wenn ich rein kognitiv verhaltenstherapeutisch arbeite, komme ich nicht weiter und wie kann ich jetzt eine Therapie entwickeln, wo ich genau an der Problematik dieser Patienten ansetze."
In McCollough’s Verfahren reflektieren Patienten nicht nur ihre Vergangenheit und deren Einfluss auf aktuelle Probleme, sie lernen auch ganz konkret Stresssituationen anders zu bewältigen und sie üben immer wieder den Umgang mit Menschen in Gruppensitzungen.
In McCollough’s Verfahren reflektieren Patienten nicht nur ihre Vergangenheit und deren Einfluss auf aktuelle Probleme, sie lernen auch ganz konkret Stresssituationen anders zu bewältigen und sie üben immer wieder den Umgang mit Menschen in Gruppensitzungen.
Beate Holz: "Dann wird ein Rollenspiel gemacht, weil da ganz viel hängenbleibt. Der eine spielt meinen Mann und der andere bin ich. Und dann sagt die Gruppe, aus dem und dem Grund wird dein Mann jetzt wahrscheinlich nicht drauf eingehen, weil du dich nicht geöffnet hast. ‚Guck mal auf deine Körperhaltung, guck mal auf deine Bewegungen, wie hast du es rübergebracht?‘ Und derjenige sagt: ‚Ich empfinde dich aber als kalt, bisschen zugewandt wäre ganz schön‘. Wenn man diese Situation vorher geübt hat, geht man raus ins Leben und wendet diese Situation an und dann fallen einem oft diese Dinge ein."
Damit gelernte Verhaltensmuster überschrieben und Prägungen überwunden werden können, bedarf es eines intensiven Trainings.
Eva-Lotta Brakemeier: "Dass die Patienten nicht nur reden, sondern auch wirklich arbeiten. Therapie ist auch Arbeit und dass sie konkrete Strategien lernen, also wirklich Hilfe zur Selbsthilfe eben. Dass man am Ende auch schaut: ‚Was sind Ihre Frühwarnzeichen? Was können Sie dann machen, wenn Sie merken zum Beispiel, Sie ziehen sich zurück? Sie haben an nichts mehr Freude. Was genau machen Sie dann?‘"
Beate Holz: "Wenn ich dann mal merke, es geht mir nicht so gut, versuche ich das zu analysieren, mache eine Situationsanalyse oder komme in die Aktivität. Und je aktiver ich werde oder mehr aus mir herausgehe oder mich ablenke, geht es mir besser."
Durch die konkreten Anleitungen und neuen Erfahrungen im Umgang mit anderen, konnte Beate Holz ihre Depression angehen.
Beate Holz: "Jetzt habe ich so diese Gedanken: ‚Na ja, du könntest jetzt noch ein paar Jahrzehnte länger leben vielleicht‘ Um das alles auszuleben, diese Möglichkeiten, die ich jetzt spüre."
Martin Keck: "Wir können heute eigentlich jede psychische Erkrankung mit einer spezifischen Psychotherapie behandeln und haben dafür nachvollziehbare Vorgehensweisen, strukturierte Manuale, die wir individualisiert anwenden können. Das sind große Fortschritte."
Für den Direktor der Klinik des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, Martin Keck, geht es jetzt darum, die Krankheiten auf biologischer Ebene besser zu verstehen. Gute Labor- und Bildgebungsparameter könnten dann zukünftig nicht nur die Diagnostik erleichtern und die Wirksamkeit der Therapien kontrollieren, die Wissenschaftler kämen auch einem anderen großen Ziel näher.
Martin Keck: "Leidenszeit verkürzen. Das ist natürlich das Wichtigste und je schneller sie wirken, je gezielter sie eingesetzt werden, diese Behandlungen werden dann günstiger sein und können noch mehr Patienten, so hoffen wir, zuteilwerden."

Angst und Selbstzweifel führen oft zu Einsamkeit.© imago








