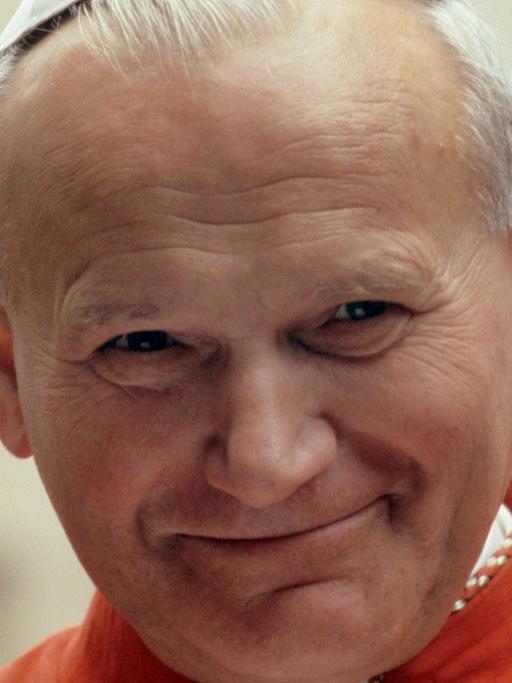Nadezhda Beljakova, Thomas Bremer, Katharina Kunter: "Es gibt keinen Gott!" - Kirchen und Kommunismus Eine Konfliktgeschichte, Herder, 255 Seiten, 29,99 Euro
Stalin statt Gott

14.08.2016
Religion sei "das Opium des Volkes", schreibt Karl Marx. Aus Sicht der Kommunisten stand der Glaube der Modernisierung im Wege. Kirchenhistorikerin Katharina Kunter hat den historischen Konflikt zwischen Kommunismus und Religion untersucht.
Religion sei "das Opium des Volkes", schreibt Karl Marx. Aus Sicht der Kommunisten stand der christliche Glauben der Modernisierung der Gesellschaft im Wege. Doch es gab auch Anknüpfungspunkte zwischen den beiden Denksystemen, sagt Kirchenhistorikerin Katharina Kunter: In der Apostelgeschichte wurde beispielsweise Privateigentum als unnötig dargestellt.
Anne Françoise Weber: "Die Kirche in der DDR klagt den Kommunismus an!" - das stand auf einem der Plakate des Pfarrers Oskar Brüsewitz. Grund zur Anklage gab es sicherlich, aber wie war nun eigentlich genau diese Haltung der DDR zu den Kirchen, wie überhaupt die der sogenannten kommunistischen Staaten zur Christenheit? Wir wollen uns dieses Verhältnis genauer anschauen und dabei besonders die Sowjetunion in den Blick nehmen. Vor Kurzem ist ein neues Überblickswerk zum Thema erschienen.
Der Titel ist ein Zitat des Sowjetastronauten Juri Gagarin: "Es gibt keinen Gott!" und der Untertitel lautet: "Kirchen und Kommunismus. Eine Konfliktgeschichte". Eine der drei Autoren und Autorinnen, neben Nadezhda Beljakova und Thomas Bremer, ist Katharina Kunter, Kirchenhistorikerin und Privatdozentin an der Universität Karlsruhe. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen.
Kirchen und Kommunismus haben sicherlich eine Konfliktgeschichte, aber christlicher Glaube und sozialistische Ideen waren nicht immer ein Gegensatz. Es gab schon lange vor der Oktoberrevolution und es gibt bis heute Menschen, die da durchaus Brücken schlagen. Wo liegen denn die Anknüpfungspunkte zwischen den beiden Denksystemen Christentum und Kommunismus?
Katharina Kunter: Anknüpfungspunkte gibt es eigentlich seit dem Beginn des Christentums, und zwar in der Apostelgeschichte. Diese Passage, wo Christen, die christliche Gemeinde sich zusammenbringt, ohne dass sie Privateigentum braucht, also dass jeder, der Teil dieser christlichen Gemeinde ist, alles mit allen teilt und gemeinsam den christlichen Glauben lebt. Und diese Stelle ist eigentlich in der Kirchengeschichte immer wieder auch zitiert worden, wenn es darum ging, zu zeigen, dass das Christentum eben keine individualisierte, auf Privateigentum sich stützende Gemeinschaft ist, sondern eine, deren Hauptsinn darin besteht, den gemeinsamen Glauben auszudrücken und in der Gemeinschaft die Welt besser und sozialer zu machen. Das sind eigentlich auch die großen Anknüpfungspunkte, die sich dann in der neueren Kirchengeschichte in den Dialog mit dem Kommunismus oder mit der kommunistischen Ideologie auch gestellt haben.
Kampf gegen Religion und den Glauben
Weber: Und warum wurde es aber dann doch hauptsächlich eine Konfliktgeschichte? War das Problem der fehlende Gott im Kommunismus?
Kunter: Genau das war das Hauptproblem. Man muss sagen, die Überschneidungen sind auch eher kleinere Gruppen des Christentums, also beispielsweise das Mönchtum, die natürlich eine eigene kommunitaristische Bewegung bildet, aber der große Knackpunkt in der Geschichte zwischen Christentum und Kommunismus ist tatsächlich der Gott, an den die Kommunisten nicht glauben und den sie im Bestandteil ihrer Ideologie auch weghaben wollten.
Also der Kampf gegen Religion und den Glauben und diesen Gott ist wichtig für die Modernisierung der Gesellschaft, und alle, die an Gott und Christus glauben, behindern diesen Fortschritt der Gesellschaft zu einer gerechteren Gesellschaft. Das ist eigentlich der Knackpunkt der gesamten Geschichte zwischen Christentum und Kommunismus seit dem 19. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert.
Weber: Aber interessant ist ja, dass besonders Lenin und Stalin die Religion bekämpft haben, aber sie doch zum Teil durch profane Feste und, ja, durch eine Art Heiligenverehrung kommunistischer Helden ersetzt haben. Also war da doch dann die Erkenntnis, irgendwas Quasireligiöses brauchen die Menschen, irgendwelche Riten und Heilige sind schon nötig?
Kunter: Ja, offensichtlich war die Ideologie dann eben doch nicht so ausgereift, dass sie das Volk und all das, was sie sich vorgestellt hatten, in der Umwälzung der Gesellschaft hin ausgereicht hätte, denn der Glauben ließ sich einfach in den verschiedenen historischen Kontexten nicht so schnell ausrotten. Die Menschen haben weiterhin an Gott geglaubt. Es gab weiterhin Kirchen, die sich gegen die neuen Ideologien, die neuen Bewegungen, die Herrscher jetzt auch in Russland und dann in der Sowjetunion gewährt haben. Das war einfach nicht so schnell möglich, diese alte Elite, dieses Bourgeoise, der Teil der alten Gesellschaft auszurotten.
Offensichtlich konnte man das nur - wenn man jetzt heute so zurückblickt auf diese Zeit -, indem man sich selber den Kommunismus stärker als eine politische Religion manifestiert hat, und da gab es dann gerade bei Stalin und Lenin, wie Sie angesprochen haben, eben vielfältige Kultformen - Beerdigungen, Ketten, Gebete, also wirklich, wie wir das auch teilweise aus dem Nationalsozialismus kennen, eine religiöse Funktion, die eine politische Ideologie dann übernommen hat.
Weber: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, und wenn wir uns das anschauen, die historischen Entwicklungen eigentlich seit der Französischen Revolution, dann war es doch also sowohl 1789 als auch 1848, bei der Russischen Revolution von 1905 und dann natürlich bei der Oktoberrevolution von 1917 immer eine Revolution, die sich auch gegen die Kirche richtete, weil die Kirche eben zu nah am Staat war. Also war das im Grunde der Fehler der Kirche oder der Christenheit gewesen, dass sie sich zu sehr mit der herrschenden Politik identifiziert hat?
Kunter: Neben dem sozusagen Kernpunkt des Gottesglaubens kann man das durchaus sagen, denn Kirche hat in großen Teilen Europas, also Westeuropas, Mittel- und Osteuropas war sie ein Teil der Machtelite, ganz besonders natürlich in Frankreich während der Französischen Revolution. Deshalb hatte auch der Kommunismus oder die kommunistische Bewegung durchaus was Attraktives für die Schichten gehabt, die sozial keine Macht hatten und war da attraktiv und konnte etwas bieten, durchaus auch für, sagen wir mal, den niederen Klerus, für die einfachen Pfarrer, auch für die Minderheitskirchen wie jetzt in Frankreich im Protestantismus. Die sahen eben da auch die Chance darin, dass sie in dieser großen Gemengelage zum Teil aus ihrer Minderheitsposition herauskommen und dann eben auch eine stärkere Anerkennung als Konfession bekommen.
Zwischen Toleranz und repressiver Diktatur
Es war immer auch ein ganz realer konkreter Machtkampf, der damit zu tun hatte, dann eben auch in der Sowjetunion, dass die alten Machteliten gestürzt werden sollten, die einerseits natürlich kulturelle Elite im eigenen Land waren, aber teilweise eben auch für ein bestimmtes Bündnissystem oder bestimmte Herrschersysteme und Kooperationen standen.
Weber: Interessanterweise hat ja der Zweite Weltkrieg einen wirklichen Kurswechsel in der stalinistischen Kirchenpolitik gebracht, also von der brutalen Vernichtungspolitik kam man eher zur Vereinnahmung. Warum?
Kunter: Auch da auf einmal ganz interessant - es geht eben nicht nur um die konkrete Kirche vor Ort, die lokale Kirche, die Priester, die Bischöfe, in dem Fall die orthodoxe Kirche, sondern auf einmal spielt das Bündnissystem eine große Rolle, wer mit wem verbündet ist, und man möchte, in dem Fall Stalin, auch nicht zu schlecht bei den Bündnispartnern dastehen, in dem Fall das Deutsche Reich. Deshalb ist der Kurs ein bisschen zurückgefahren worden, und man wollte sich jetzt doch als ein Bündnispartner zeigen, mit dem man vorangehen kann und nicht der Bündnispartner, der jetzt für die Christenverfolgung steht im ganzen Land und der deshalb vielleicht nicht mehr als Bündnispartner loyal genug sein kann oder akzeptabel genug sein kann.
Das sehen wir in verschiedenen Kontexten, aber auch immer wieder später, also wenn wir dann einen Sprung in die Zeit der Entspannungspolitik machen, da ist dann eben schon wieder diese Situation, jetzt möchte man aufgenommen werden in die internationale Anerkennung in den 70er-Jahren, und da liegt dann dem kommunistischen System in den verschiedenen sozialistischen Ländern dann sehr daran, zu zeigen, dass sie bündnisfähig sind, dass sie eben nicht diese autoritäre, repressive Diktatur sind, in die sie als Zerrbild ihrerseits meinen hineingestellt zu werden, sondern dass ihre Vertreter und ihre Kirchen für eine gemeinsame gerechte Gesellschaft sich einsetzen. Da sieht man auch wieder, dass die Kirche dann instrumentalisiert wird für die eigene Außenpolitik.
Weber: Ist das auch ein Grund dafür, dass es so ein großes Spektrum am Umgang mit den Kirchen gab in den unterschiedlichen Staaten, also von der ganz starken Repression bis hin zu einer gewissen inneren Autonomie für die Kirchen, also besonders in der DDR? Die DDR war ja nun auch der sichtbarste Teil sozusagen nach Westen hin. Also wollte man da einfach auch mehr Freiheit lassen, weil man wusste, da ist man sonst besonders angreifbar?
Kunter: Ja, das kann man sagen. Die DDR ist, wenn man das ganze Feld betrachtet, auch sicherlich eine Ausnahme, wie Polen, weil da ja sehr starke volkskirchliche Strukturen herrschten, bis 1972 zur Anerkennung von DDR und Bundesrepublik ja auch der Status nicht so ganz geklärt war. Das ist sicherlich ein Sonderfall, und da haben es die Kirchen auch bis zum Ende geschafft, eine große Autonomie zu behalten. Die Kirchen konnten eben auch selber ihre Pfarrer einstellen, bezahlen. Das war wirklich ein Sonderfall.
Untergrundbewegung von Laien und Pfarrern
Wenn man andere Länder sich anschaut, wie die Tschechoslowakei zum Beispiel, da wurden die Pfarrer vom Staat bezahlt, und in dem Moment, wo sie eben nicht treu genug gegenüber dem Staat waren und sich oppositionell oder einfach gegen die Einschränkung von religiösem Leben wandten, wurde ihnen schon die staatliche Genehmigung entzogen, und das hatte natürlich zur Folge, dass dadurch ein viel größerer Untergrund entstand, auch eine größere Untergrundbewegung von Laien und von Pfarrern, die nicht mehr einfach ihren Beruf ausüben konnten, ihre Berufung ausüben konnten. Da sieht man eben, es gibt so ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die dann die jeweiligen kommunistischen Herrscher entwickeln mussten, um mit den Kirchen umzugehen. Die Kirchen hatten eben sehr, sehr unterschiedliche nationale Kontexte, die es dann in dem jeweiligen Land auch schwerer machten, alle Kirchen, sozusagen alle Christen unter eine Religionspolitik zu stellen.
Weber: Interessant ist ja auch, nicht nur auf die Kirchen vor Ort zu gucken, sondern sich auch anzuschauen, was die Kirchen im Westen getan haben. Also einerseits gab es da durchaus Bemühungen, die Beziehungen zu halten, die Glaubensbrüder und -schwestern im Ostblock zu unterstützen. Möglicherweise kann man aber doch auch den Vorwurf erheben, dass da nicht genug Kritik an der Verfolgung geübt wurde?
Kunter: Ja, da haben Sie genau das Spektrum angesprochen, und man muss vielleicht das auch noch ein bisschen zeitlich differenzieren so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als im Fall der russischen Revolution es auch sehr viele Menschen gab, die Exil dann im Westen gesucht haben, Exilkirchen gegründet haben, einfach noch sehr viele Augenzeugenberichte gebracht haben, war der Verfolgungscharakter und die Bedrückung bei vielen christlichen Kreisen auch in der ökumenischen Bewegung sehr viel deutlicher. Das hat dann nach gelassen. Je stärker die Kirchen isoliert wurden mit dem Eisernen Vorhang, umso schwerer war es, Kontakte zu knüpfen, und die Kontakte, die geknüpft wurden, waren natürlich in vielerlei Hinsicht oft ausgewählt, waren Teil eben der loyaleren Kirchenvertreter, und so hat man im Westen dann teilweise, vor allen Dingen dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch ein einseitigeres Bild immer mehr gewonnen.
Das war das eine, das andere war, dass man immer aus dem christlichen Auftrag davon überzeugt war, wir müssen Brücken in den Osten schlagen, wir müssen Dialoge führen, denn das ist unsere gemeinsame Hoffnung, dass Christen eins sind, und zwar unabhängig von welcher Konfession und von welchem historischen Kontext – die gemeinsame Christenheit, die müssen wir am Leben erhalten als Hoffnung. Da gab es eben verschiedene Ansätze. Es gab Kirchen im Westen, die den Dialog förderten, die auf Dialog setzten und auch in Kauf nahmen, dass man mit loyaleren Leuten sprach aus den Kirchen, und es gab aber auch verschiedene Gruppen, die das Ganze sehr viel stärker unter der Perspektive der eingeschränkten Religionsfreiheit, der Nichtbeachtung von Menschenrechten betrachteten und gezielt auch diejenigen Christen und Christinnen im Osten unterstützten, die im Gefängnis waren, die Schwierigkeiten hatten, ihren Glauben zu unterstützen. Das sind eigentlich so die beiden großen Pole, die man sagen kann.
Ob man den Kirchen und dem Christentum im Westen einen Vorwurf machen kann – ich glaube, in gewisser Art und Weise ja, zumindest, wenn ich das auf die westeuropäischen Kontexte beziehe, und wenn man all das, was man heute weiß, in Beziehung setzt zu dem, was man damals auch wissen konnte, war einfach Osteuropa kein großes Interesse mehr in den 70er und 80erJahren, DDR noch ein bisschen, aber das Christentum in Westeuropa war eben auch sehr viel stärker interessiert an Befreiungstheologie in Lateinamerika, an Südafrika. Also die Perspektive ist sehr viel globaler geworden, und da sind die Kirchen und Christen in Osteuropa doch auch sehr an die Peripherie der Wahrnehmung gerückt.
Kirchen kämpfen um Zugang zu Geheimdienst-Akten
Weber: Sie haben schon von den Loyaleren gesprochen, also es gab ja wirklich sehr unterschiedliche Grade der Kooperation zwischen Kirchenleuten und Staaten, auch Geheimdiensten. Das war zum Teil aus der Not geboren, zum Teil auch aus der Überzeugung. Viel wurde in Deutschland aufgearbeitet auch anhand von Stasiakten. Anderswo tut man sich aber da anscheinend doch noch schwer damit.
Kunter: Ja, Deutschland ist in der Beziehung, kann man sagen, natürlich ein Sonderfall, weil auch sehr, sehr viel Geld aus den verschiedenen Bereichen von Kirche, Gesellschaft, öffentlicher Aufarbeitung, Politik zur Verfügung gestellt wurde, und entsprechend sind eben sehr, sehr viele gründliche Fallstudien erschlossen worden, und von Anfang an war es eben möglich, auch die Archive der Stasi zu benutzen. Dieser Fall ist in vielen anderen osteuropäischen, mitteleuropäischen Ländern nicht der Fall.
Da wurde gekämpft darum, dass überhaupt ein Teil der Geheimdienstakten geöffnet wird, dass Kirchen Zugang haben, aber die professionellen Möglichkeiten, so etwas aufzuarbeiten, sind eben sehr viel geringer gewesen. Man kann sagen, dass eigentlich zum Teil jetzt erst nach über 25 Jahren es in einigen Ländern beginnt, dass man ein breiteres Bild über die Religionspolitik in dem jeweiligen Abschnitt hat, aber eben auch über das Verhalten der eigenen Kirchenvertreter. Das führt jetzt teilweise in manchen Ländern - ich nenne vielleicht Bulgarien als ein Beispiel - zu Situationen und emotionalen Diskussionen in der Öffentlichkeit, die denjenigen gleichen, die wir Anfang der 90er-Jahre in Deutschland hatten.
Weber: Sie selbst sind evangelische Kirchenhistorikern. Gerade wurde Ihr Buch "500 Jahre Protestantismus" neu aufgelegt. Ihr Kollege Thomas Bremer an der Universität Münster ist katholischer Theologe und Spezialist für Ostkirchenkunde, und Nadezhda Beljakova ist eine russische Kollegin am Zentrum für Religions- und Kirchengeschichte an der Russischen Akademie der Wissenschaften. Sie haben dieses Buch zu dritt geschrieben auch nicht namentlich gekennzeichnet, wer sich vorrangig um welches Kapitel gekümmert hat. Hatten Sie denn zum Teil unterschiedliche Einschätzungen aufgrund Ihrer unterschiedlichen wissenschaftlichen und auch nationalen und religiösen Hintergründe?
Kunter: Wir hatten Expertisen auf jeden Fall, die sich auf Länder und Perspektiven erstreckte, und daraus haben sich auch teilweise unterschiedliche Einschätzungen ergeben, die wir aber dann, weil wir das Buch wirklich gemeinsam geschrieben haben, als Lücken auch entdeckt haben. Also ich zum Beispiel - Sie haben es schon genannt - mit der stärker evangelischen Perspektive habe natürlich den Protestantismus immer stärker aus dieser Minderheitsposition wahrgenommen und habe in der Kooperation mit meinen beiden Mitautoren auch gelernt, ah, das verändert noch mal die Perspektive der Minderheitenposition, wenn man sieht, dass der Katholizismus in vielen Fällen eben eigentlich auch in einer Minderheitsposition war und dass es aber den orthodoxen Kirchen auch nicht unbedingt viel besser gegangen ist.
Da haben sich auch die Einschätzungen verändert und sehr viel stärker dahingehend, das Christentum auch als einen gemeinsamen kulturellen Faktor in Mittel- und Osteuropa wahrzunehmen, dessen Kultur in der Breite grundlegend zerstört worden ist. Ich glaube, diese Perspektive und diese Einschätzung hätten wir alle nicht vorher einzeln in unseren Expertisen so formulieren können.
Weber: Herzlichen Dank, Katharina Kunter, Kirchenhistorikerin und Privatdozentin an der Universität Karlsruhe und Mitautorin des Buches "Es gibt keinen Gott! Kirchen und Kommunismus. Eine Konfliktgeschichte". Erschienen ist es im Herder-Verlag, hat 255 Seiten und kostet rund 30 Euro.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.