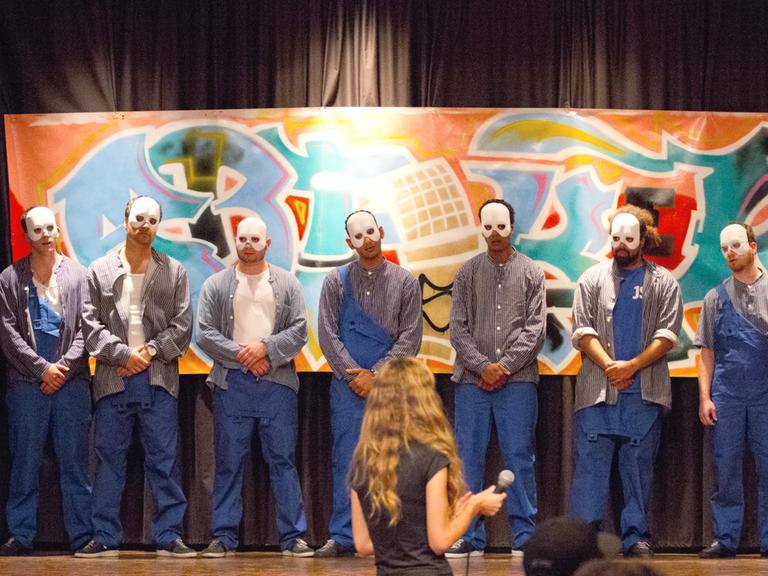Wovon Künstler leben (müssen)

Was wäre die Welt ohne Bücher, Filme, Gemälde oder ohne Musik – kurz, ohne Kunst? Mit Sicherheit ein ziemlich langweiliger Ort. Trotzdem verdienen Künstler meist nicht einmal den Mindestlohn. Ist in unserer Gesellschaft Kunst nichts wert?
Arme Künstler gab es zu allen Zeiten, nicht nur als Gegenstand in der Kunst, sondern auch im wahren Leben: Mozart und Vivaldi starben arm, die Schriftsteller Karl Philipp Moritz und Franz Kafka, ebenso wie Van Gogh, Rembrandt und Gauguin.
In ihren Biografien ist nachzulesen, dass das Leben als armer Künstler sich nicht nur in ekstatischen Höhen an der Seite von Gott abspielt, sondern einem unten auf der Erde auch sehr zusetzen kann.
Das ist heute nicht anders, als damals.
"Ein Stundenlohn von 1,54 Euro"
Astrid Vehstedt ist Vorstandsvorsitzende vom Landesverband der Schriftsteller in Berlin. Sie ist selbst Autorin, kennt die Situation aus erster Hand:
"Nach den Zahlen, die ich zur Verfügung habe, können überhaupt nur 5 Prozent der Autoren von ihren Büchern leben. Ich hab' auch noch eine andere Zahl, wenn man 3000 Bücher in zwei Jahren verkauft, dann hat man einen Stundenlohn von 1,54 Euro."
Schriftsteller arbeiten in Fabriken, als Taxifahrer, Kellner oder im Baumarkt an der Kasse. Wolfgang Herrndorf war bei der Post, Ian Rankin Steuereintreiber, Sekretär und Schweinehirte. Manche bieten Schreibwerkstätten und Kurse an, andere bringen es zum Stadtschreiber für 900 Euro im Monat, plus Kost und Logis. Aber nicht jeden zieht es in eine Stadt wie Erfurt, Gotha oder Eisenbach, um sich schreibend den dortigen Belangen zu widmen. Der Schriftsteller wünscht sich vor allem Geld, um sein eigenes Werk voranzubringen.
Bernd Cailloux hat gerade ein neues Buch veröffentlicht. "Surabaya Gold", ein Sammelband von Haschisch-Geschichten. Gewisse Erfahrungen hat er auch selbst mit dem Thema, aber das ist lange her.
Bernd Cailloux ist Jahrgang 1945, schreibt seit Anfang der 70er Jahre. Damals ist er Mitte 20 und gerade aus einer Firma ausgestiegen, die er selbst mit gegründet hat. Die war erfolgreich mit dem Nachbau und Verkauf von Stroboskopen geworden, doch der Erfolg war gar nicht beabsichtigt gewesen. Ursprünglich wollten die drei Betreiber, ganz dem Geist der 68er und der Kunst verpflichtet, nur Lichttechnik für Diskotheken und Konzerte liefern, das Grünspan in Hamburg oder Frank Zappa.
Doch es folgten zunehmend Anfragen aus dem Messebetrieb oder der Werbung, die Firma expandierte. Der Anfang vom Ende der "Leisure Society", moralisch geht es bergab. Die drei Betreiber zerstreiten sich, auch über Geld, Cailloux verlässt die Firma. Die ihm jedoch immerhin so viel einbringt, dass er davon etwa zehn Jahre lang leben kann. Er beginnt zu schreiben, erst einige Erzählbände, schließlich auch zwei Romane. An dem dritten arbeitet er gerade.
"Also, Geld, Geld, Geld, ja."
Er mag das Thema eigentlich nicht. Seit dem Fiasko mit seiner Hippiefirma hat er Geld negativ besetzt, erzählt er.
"Geld trennt Liebende irgendwann. Und ich wollte frei sein davon."
Bernd Cailloux‘ persönlicher Bestseller ist 2005 erschienen, mittlerweile in der 7. Auflage. Ein Buch mit dem spröden Titel "Das Geschäftsjahr 68, 69". Darin verarbeitet er seine Erfahrungen aus der Firmen-Zeit. Ein gut besprochenes Buch, im selben Jahr nominiert für den Deutschen Buchpreis.
"Es gibt natürlich jedes Jahr ein paar Leute, die durchbrechen, und die 20-, 50-, 80-Tausend Bücher verkaufen, das gibt es natürlich. Aber die normalen Romane, auch namhafter Leute, kämpfen mit der 5000-Auflagen-Grenze."
"Wenn man schreibt, kann man nicht saufen"
5000 gilt als Erfolg, ab 15.000 spricht man in der Branche von einem Bestseller. Die Marke hat das Buch von Bernd Cailloux jedenfalls geknackt, über genaue Zahlen spricht er nicht gern. Wenn ein Buch zwischen 10 und 20 Euro kostet und der Autor bekommt 10 Prozent davon, dann liegt der Verdienst für das "Geschäftsjahr" vermutlich irgendwo bei 20.000 Euro. Für fünf Jahre Arbeit. In der Zeit hat er zwei Stipendien erhalten, die anderthalb Jahre gehalten haben. Wovon hat er sonst noch gelebt damals?
"Keine Ahnung. Wenn man schreibt, kann man nicht saufen, dann gibt man kein Geld aus. Also braucht man fast kein Geld. Die Askese ist eben eine Grundbedingung. Wenn man in die Kunst reingeht, muss man mit der Askese rechnen, nicht mit Geld."
Lange Zeit war auch das billige Leben in Berlin eine gute Künstlerförderung, 600 Mark reichten zum Leben, eine Hundert-Quadratmeter-Wohnung kostete 180 Mark. Doch das ist lange vorbei.
"Es gibt natürlich auch Leute, die Geld von Zuhause haben, keine Ahnung. Oder die einen Job machen nebenbei, oder ich hab‘ sehr lange sehr viel Radioarbeit gemacht, was ja dann alles auch störend ist. Wenn man sich im Schreiben weiterentwickelt hat, dann kann man sich mit den Massenmedien nicht mehr befassen, dann läuft ein anderer Film."
Bernd Cailloux ist heute über 70, im Rentenalter. Hat er vorgesorgt?
"Nö. Ich bin in der Künstlerkasse und VG Wort von Anfang an immer drin, ich krieg‘ zwei kleine Renten und den Rest erarbeite ich, das hab‘ ich mir unter dem Beruf auch vorgestellt. Also, ich werde bis zum letzten Tag arbeiten."
Von einer Verbesserung der finanziellen Situation für die Schriftsteller scheint man weit entfernt zu sein. Die Konkurrenz hat stark zugenommen, immer mehr Bücher werden von den Verlagen auf den Markt geworfen. Dazu kommen dank der Digitalisierung eine Vielzahl von Veröffentlichungen, die Autoren ganz ohne einen Verlag herausbringen, als "Selfpublisher", einfach über das Internet.
"Im vergangenen Jahr gab es knapp 85.500 neue Titel. Wer soll das alles lesen? Ja, könnte man ketzerisch fragen. Also es ist ein unglaubliches Angebot natürlich da."
Die Frage scheint eher zu sein, wie man verhindern kann, dass Autoren noch weniger Geld verdienen. Denn die wenigen Einnahmen über den Buchverkauf schrumpfen noch angesichts der Vertriebswege über das Internet, wenn Billiganbieter wie Amazon und Co sogar gerade erst veröffentlichte Bücher zu Dumpingpreisen anbieten, meint Astrid Vehstedt. Sie appelliert daher vor allem an die Verantwortung der Konsumenten. Auch im Bereich der Lesungen.
"Ich weiß von einer Initiative hier in Berlin Moabit, wo die Autoren überhaupt nicht bezahlt werden, sowas geht gar nicht! Es wird ja 'ne Leistung erbracht. Also sollte man vielleicht auch wieder darauf hinweisen, dass auch Eintritt verlangt werden sollte, für Lesungen."
Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, wusste Karl Valentin. Auch Bertolt Brecht beklagt in seinem "Lied der preiswerten Lyriker", wie anstrengend es sei, Lyrik zu machen. Es wird eine Leistung erbracht. Aber wenn kaum jemand die Leistung will? Das Gedicht nicht liest, den Free Jazz nicht hört. Ist das dann nicht das persönliche Problem des Künstlers?
Warum sollte die Gesellschaft für eine Kunst bezahlen, die nur ein Handvoll von Leuten interessiert? Welchen Wert haben Kunst und Kultur für eine Gesellschaft, ganz unabhängig davon, wie viele Menschen sie konsumieren?
"Aus dem Jazz entstehen unglaublich viele kreative Impulse"
Gebhard Ullmann, Vorsitzender der Union Deutscher Jazzmusiker, kennt eine Antwort:
"Die Gesellschaft fördert ja auch jede Art von wissenschaftlicher Grundlagenforschung. Wenn wir mit Jazz aufhören würden, einfach von heute auf morgen, dann ist das Forschungslabor der Musik geschlossen. Aus dem Jazz entstehen unglaublich viele kreative Impulse."
Heute gilt es als hip, in der Kreativbranche zu arbeiten, doch die Bedeutung von Kunst und Kultur für eine Gesellschaft scheint vergessen, meint der Jazz-Trompeter Nikolaus Neuser. In der Wahrnehmung sind sie nicht mehr als ein nettes Accessoire.
"Und es ist ja im Grunde eigentlich viel mehr. Es ist ja eigentlich ein Rückgrat einer Gesellschaft. Denn nur mit Kunst können wir Kultur entwickeln. Und nur mit Kultur bekommen wir eine Identität. Und nur auf Grundlage einer Identität können wir Werte entwickeln. Und dafür brauchen wir auch insbesondere eine Kunst, die natürlich die Gegenwart ausleuchtet, und auch da gerne die Extrempunkte betritt, und die Extremblickwinkel mit einbezieht."
Silke Eberhard und Nikolaus Neuser sind ein eingespieltes Team im Leben, wie in der Musik. Das Jazz-Musiker-Paar lebt zusammen, spielt zusammen in verschiedenen Bands. Silke Eberhard Saxophon und Klarinette, Nikolaus Neuser Trompete.
Beide haben Jazzmusik studiert, spielen in mehreren Bands und Projekten, reisen viel in der Welt herum und machen Musik, in Europa, den USA, Asien, der arabischen Welt. Das hört sich gut an und das ist es auch.
Dennoch keine leichte Aufgabe, mit Jazzmusik sein Geld zu verdienen. 70 Prozent der Jazzmusiker verdienen weniger als 12.500 Euro im Jahr. Und vermutlich nicht einmal die Hälfte davon mit ihrer Musik.
Die Grundlagen, sich trotzdem für ein Leben als Musikerin zu entscheiden, liegen bei Silke Eberhard in der Kindheit: Der Vater leitet im Schwabenland eine lokale Blaskappelle. Mit neun wünscht sie sich eine Gitarre, mit elf bekommt sie eine Klarinette, spielt im Orchester mit. Doch heimlich schielt sie aufs Saxophon.
"Also Klarinette war Blasmusik, Saxophon war Jazz."
Silke Eberhard will Musikerin werden, aber die Eltern raten davon ab: Kunst sei doch ein brotloses Gewerbe. So macht sie zunächst eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin. Aber schnell stellt sich Ernüchterung ein.
"Als ich dann anfing da zu arbeiten, dann hatte ich jeden Tag das gleiche Bild auf dem Bildschirm. Furchtbar. Und ich hab' so gelitten. Und wo wir dann zum Verdienst kommen: Ich hab' dann zufällig gesehen, dass eine andere Mitarbeiterin, die war so Mitte 40 und ich war 20, die hat das gleiche verdient wie ich. Und es war so wenig! Und die Männer alle das Doppelte. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, als Frau hast du ja sowieso gar keine Möglichkeiten. Also, das geht mit Jazz-Spielen auch."
Mit 22 beginnt sie ihr Studium an der Musikhochschule "Hanns Eisler" in Berlin, ein Jahr später, 1996, gründet sie ihr erstes Trio.
"Das war ja 'ne super Zeit in Berlin. Da konnte man in irgendwelchen Kellern, Bars, - also, keine offiziellen Bars, irgendwelche Hinterhöfe -, konnte man alles machen. Und Leute kamen und haben teilweise getanzt, zum Free Jazz, das war super. Und ja, auch in den Jazzclubs damals gab’s so die Festgage: 100 Mark - pro Person!"
Keine schlechte Gage, verglichen mit heutigen Standards. Die Union Deutscher Jazzmusiker hat zwar mit vielen Veranstaltern eine Mindestgage von 250 Euro ausgehandelt. Die wird aber fast nie gezahlt.
"Da gibt’s eben viele Clubs, wo man auf Eintritt spielt, manche auch auf Donation, da geht der Hut rum. Da gibt’s dann auch gute Beispiele von einem Club, wo jemand vorne steht und dann sagt, was die Mindest-Donation sein sollte, und dann geht man eigentlich mit einer guten Gage raus. 200 Euro hab ich da bekommen, für einen Jazz-Gig. Das sind so aktuelle Preise, aber wenn man natürlich in einem ganz klitzekleinen Laden in Neukölln spielt, wo nur 20 Leute reinpassen und jeder gibt fünf, kann man es sich ausrechnen, was dann bei der Band bleibt."
100 Euro – die sich eine Band teilen muss. Doch mehr können die Clubs oft nicht zahlen – finanziell sind sie in derselben Situation, wie die Musiker.
"Du zahlst, um eine CD rauszubringen"
Mit Auftritten seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist praktisch unmöglich. Man sollte meinen, dass der Verkauf von CDs einiges einbringt. Tut es aber nicht.
"Als ökonomischer Faktor spielt das CD-Verkaufen eigentlich keine nennenswerte Rolle. So. Aber als künstlerisches Statement und zur Akquise von Konzerten, ist es einfach nötig, das zu tun."
Die letzte Veröffentlichung von Silke Eberhard und Nikolaus Neuser mit ihrem Trio "I am three" wurde international sehr gut aufgenommen, bekam im "DownBeat Magazine", bei "New York City Jazz Records" oder "All about Jazz" herausragende Beurteilungen.
"Aber ich kann wirklich nicht sagen, wieviel da verkauft wurden, aber das wird, wenn man Glück hat, 'ne vierstellige Zahl."
"1000 ist schon ein Renner. Muss man sagen. Dann ist es auch so, wenn man eine CD macht heute, das sind ja oft ganz kleine Firmen, das sind zwei Leute, zum Beispiel, die das nebenher machen. Da muss man selber als Musiker eine bestimmte Stückzahl abnehmen, damit der das überhaupt machen kann. Das heißt, man muss dem einen Teil des Risikos abnehmen. Das heißt du zahlst, um eine CD rauszubringen, manchmal durchaus 3000, 4000 Euro als Musiker. Also, es wird schon gar nicht mehr darüber geredet, dass man irgendwelches Geld für eine CD kriegt, sondern man bezahlt."
Eine gute Verdienstmöglichkeit bieten Festivals, 500 Euro sollen es im Schnitt sein, nach oben hin gibt es für Stars keine Grenzen. Doch erfolgreiche Musiker ergattern vielleicht fünf Festivalauftritte im Jahr, unbekannte können sich schon über einen Auftritt freuen. Viele Musiker unterrichten daher oder spielen wie Silke Eberhard häufig in Theaterproduktionen mit.
Silke Eberhard und Nikolaus Neuser kommen heute gut zurecht, brauchen aber auch nicht viel. Sie empfinden ihr Leben als privilegiert.
"Aber selbstverständlich stehen Arbeitsaufwand und Entlohnung in keiner Relation, wenn man das mit äquivalent ausgebildeten anderen Berufen vergleicht."
Die Union Deutscher Jazzmusiker hat eine Studie in Auftrag gegeben, um die Situation der Musiker sichtbarer zu machen.
Veraltete Förderstrukturen
"Wenn man diese Zahlen hat, dann kann man natürlich durchaus in den politischen Raum gehen und sagen: So und so ist die Situation und wenn ihr nicht wollt, dass die Leute alle irgendwann, wenn sie 65 sind, beim Sozialamt vor der Tür stehen, müsst ihr jetzt was machen. Zum Beispiel."
Die Union Deutscher Jazzmusiker wie auch die Koalition der Freien Szene beklagen veraltete Förderstrukturen, viel zu wenig komme an der Basis an. Und die Fördermittel müssten deutlich erhöht werden.
"Die deutschen Jazzpreise sind in der Regel bei 15.000 Euro gedeckelt. Der Genius-Award, MacArthur Genius Award, das ist das Pendent in New York, liegt jetzt bei 650.000 Dollar. Den kann man kriegen als Jazzmusiker. In Dänemark, in Kopenhagen, gibt es einen Jazzpreis, der liegt bei 250.000 Euro. Und in Deutschland bewirbt man sich für 5000 Euro. Mit derselben Band."
Was man sich bei den Skandinaviern außerdem abgucken könnte, fällt unter das Stichwort: Exportförderung. "Skandinavischer Jazz" hat nicht zufällig internationales Renommee erlangt, sondern weil der Staat den Export einer Marke gefördert hat. Finanziell kommt das allen Seiten zu Gute.
Im Vertrag der Großen Koalition hieß es: Kultur ist keine Subvention, sondern eine Investition in die Zukunft.
Doch wo wird investiert? Die meisten Ausgaben im Kulturbereich verbrauchen sich in der Erhaltung bestehender Einrichtung wie Theatern und Konzerthäusern, in Museen, Bibliotheken und der Denkmalpflege. Doch die Zukunft wird an der Basis geschmiedet, von einzelnen Künstlern. Für sie bleibt kaum etwas übrig. Und erschwert wird ihre Situation noch durch die steigenden Kosten für Wohnraum, Proberäume, Ateliers.
Lorcan O’Byrne ist Mitte 50, geboren in Dublin. Seit 30 Jahren lebt er in Berlin, die Lebenshaltungskosten haben sich seit damals dramatisch verändert. Nebenjobs muss er aber nicht mehr machen, er lebt von etwa 1000 Euro im Monat. Das Atelier kostet 600 Euro.
Lorcan O’Byrne hat an der Hochschule der Künste studiert, Preise und Stipendien erhalten, hat Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Antwerpen, Dublin.
1996 wird die Galeristin Helen Adkins auf ihn aufmerksam. Im Jahr darauf zeigt sie eine erste Einzelausstellung seiner Arbeiten in ihrer Galerie in Berlin-Mitte, vertritt ihn fünf Jahre lang. Doch 2002 muss die Galerie schließen, die Miete hat sich verdoppelt. Eine feste Vertretung hat er seit dem nicht gefunden.
"Ich meine, eine Galerie zu haben, ist richtig gut. You know, du hast einen Platz zum Zeigen. Und selbst das ist schon was wert. Und dann, man bezahlt die Galerie für Connections und so weiter. Ich würde gern jetzt eine Galerie haben in Berlin."
Nur etwa 10 Prozent der Künstler haben eine feste Galeriebindung. Wer keine hat, muss sich selbst managen: vermarkten, netzwerken, Ausstellungen organisieren – um seine Bilder an den Mann oder die Frau zu bringen. Eine Aufgabe, die viel Zeit kostet. Wenn dann noch Nebenjobs dazukommen, wird die eigentliche Kunst-Produktion immer schwieriger, weiß Herbert Mondry vom Berufsverband Bildender Künstler in Berlin.
"Das sind drei Bereiche: das Kunstmachen, das Management und dann das Geld verdienen. So, dann können Sie sich ausrechnen, wie lange das gut geht. 10 Jahre? 15 Jahre? Dann ist ein Künstler in der Regel, oder eine Künstlerin, schon fast verbrannt."
"Manchmal nur 35 Euro pro Woche"
Lorcan O’Byrne hat Glück, einige Sammler bleiben ihm erhalten, kommen regelmäßig zu ihm ins Atelier, kaufen seine Bilder. Und er kann ab und zu in Galerien ausstellen, im vorletzten Jahr erhielt er außerdem ein Stipendium. Er kann von seiner Kunst leben, doch die Lebensbedingungen sind bescheiden.
"Ich hab' nichts. Ich brauche nichts. Ich meine, ich habe Material und Pinsel und ich hab' auch eine gute Beziehung mit meiner Tochter und meiner Ex und mit ein paar Leuten hier, das ist viel mehr wichtig als Geld. Ich habe auch manchmal mit 35 Euro pro Woche, im Moment sind es 50, 70. Urlaub ist immer drin! Urlaub nach Irland ist immer drin, auch wenn ich Geld krieg von Irland, um in Irland Urlaub zu machen. Mein Jerry, mein Unterstützer, der bucht die Karten für mich manchmal. Und er bezahlt die. Und deswegen auch vielleicht bin ich nicht so miserabel. Weil ich hab das im Hintergrund. Und wenn die nicht da waren, ich meine Familie und Freunde und so, dann wäre es auch anders."
Wie in allen anderen künstlerischen Berufen auch, kann nur eine kleine Minderheit gut von der künstlerischen Arbeit leben. Schätzungsweise 10.000 Künstler gibt es allein in Berlin, Anfang der 90er Jahren waren es noch 3500. Der Kampf darum, überhaupt wahr genommen zu werden, ist deutlich härter geworden. Die schiere Masse an Künstlern senkt die Verdienstmöglichkeiten, das Durchschnittseinkommen in Berlin liegt bei 850 Euro.
Einige erhalten, wie Lorcan O’Byrne, zusätzliche Unterstützung: von der Familie, vom Partner oder vom Jobcenter. Doch die meisten müssen fast ausschließlich von Nebenjobs leben.
Um die Situation der Kunstschaffenden zu verbessern, fordert der Berufsverband seit Jahren, dass Künstler, deren Arbeiten in kommunalen Galerien ausgestellt werden, bezahlt werden. Wie jeder andere, der dort arbeitet, auch.
"Das ist natürlich eine sehr komische Sache, weil die Toilettenfrau, die kriegt eben sogar Geld, weil sie eben sauber macht, und alles Mögliche macht. Das heißt alle verdienen mit an dem Ausstellungsbetrieb, aber ausgerechnet der Künstler, der eigentlich den eigentlichen Inhalt liefert, kriegt nichts! Also eine total bescheuerte Geschichte, die keiner richtig begründen kann."
Seit 2016 gibt es in der Hauptstadt das "Berliner Modell", die Künstler erhalten 1000 Euro für eine Einzelausstellung und 150 bis 350 Euro für die Teilnahme an einer Gruppenausstellung.
Auch die Zahl der Arbeitsstipendien wurde erhöht, von ehemals 15 auf 54 Stipendien. Doch im Bereich der Atelierförderung etwa ist die Entwicklung eher rückläufig. Die Preise für Wohn- und Arbeitsräume steigen stetig an.
Die Ausgaben für den Kultursektor machen etwa 1,7 Prozent der öffentlichen Haushalte aus. In den letzten 10 Jahren ist der Kulturetat von jährlich 9 auf etwa 10 Milliarden Euro gestiegen. Doch diejenigen, die zeitgenössische Kultur produzieren, in denen die Themen der Gegenwart verhandelt werden, haben kaum etwas davon. Mit Hilfe von Interessenverbänden, mit vereinten Kräften, ändert sich das vielleicht in Zukunft. Aber bis dahin sollten Künstler besser von einem Leben in bescheidenen Verhältnissen ausgehen.