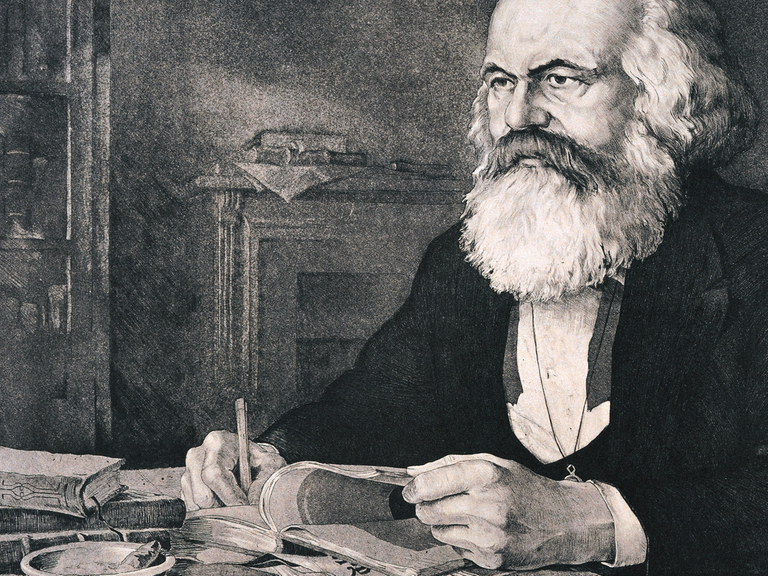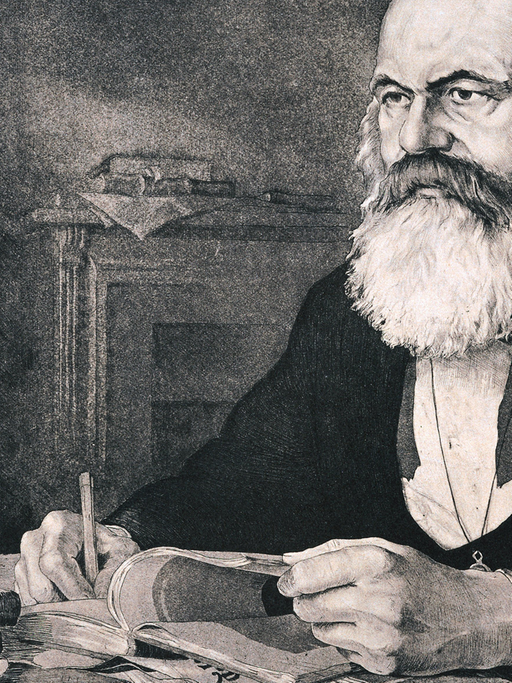Urs Marti-Brander: "Die Freiheit des Karl Marx. Ein Aufklärer im bürgerlichen Zeitalter"
Rowohlt-Verlag 2018
384 Seiten, 24 Euro
Erscheint am 24. April.
"Das Kommunistische Manifest ist ein Loblied auf den Kapitalismus"

Christian Lindner und Urs Marti-Brander im Gespräch mit Annette Riedel · 21.04.2018
Welches Verhältnis hätte Karl Marx zur FDP gehabt? Vielleicht gar kein so schlechtes. Zumindest habe sich Marx weniger für Verteilungsgerechtigkeit interessiert als für bürgerliche Freiheiten, so der Philosoph Urs Marti-Brander im Gespräch mit FDP-Chef Christian Lindner.
Marx ist tot. Der Marxismus auch? Viele Wissenschaftler und Autoren beschäftigen sich neu mit dem Denken von Karl Marx, nicht nur, weil sich sein Geburtstag am 5. Mai zum 200. Mal jährt.
Was hätten Karl Marx und heutige Politiker einander zu sagen? Marx trifft auf Politik, eine Reihe in der Sendung Tacheles – heute Christian Lindner, FDP-Partei- und Bundestagsfraktionsvorsitzender, im Gespräch mit Urs Marti-Brander, Autor des Buches "Die Freiheit des Karl Marx: Ein Aufklärer im bürgerlichen Zeitalter".
Deutschlandfunk Kultur: Willkommen zu diesem Zwiegespräch! Herr Lindner, Sie haben Politikwissenschaften, Staatsrecht und Philosophie studiert. In den 70er-Jahren wäre ganz klar gewesen, dass Sie mit dieser Studienfachkombination an Karl Marx nicht vorbei gekommen wären. Zu Ihrer Studienzeit Ende der 90er - war das da, nach dem Abdanken der real-sozialistischen Modelle in Europa, anders?
Christian Lindner: Nein, das war nicht anders. Denn Karl Marx ist in der Praxis widerlegt, vielfach auch in der ökonomischen Theorie, aber er ist unverändert ja ein faszinierender Gelehrter, Denker, eine Projektionsfläche, vielleicht auch ein Nadelöhr zum Verständnis bestimmter historischer Entwicklungen und vielleicht auch gegenwärtiger Debatten. – Also: An Marx kommt man nicht vorbei.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Marti-Brander, kommende Woche erscheint Ihr Buch "Die Freiheit des Karl Marx: Ein Aufklärer im bürgerlichen Zeitalter". Marx war Journalist, Wissenschaftler, Analytiker. Man könnte sagen, er war Forscher. Er wollte die sozialen und ökonomischen Verhältnisse in erster Linie verstehen, begreifen. – Irren diejenigen, die sagen, er war ein Dogmatiker?
Was hätten Karl Marx und heutige Politiker einander zu sagen? Marx trifft auf Politik, eine Reihe in der Sendung Tacheles – heute Christian Lindner, FDP-Partei- und Bundestagsfraktionsvorsitzender, im Gespräch mit Urs Marti-Brander, Autor des Buches "Die Freiheit des Karl Marx: Ein Aufklärer im bürgerlichen Zeitalter".
Deutschlandfunk Kultur: Willkommen zu diesem Zwiegespräch! Herr Lindner, Sie haben Politikwissenschaften, Staatsrecht und Philosophie studiert. In den 70er-Jahren wäre ganz klar gewesen, dass Sie mit dieser Studienfachkombination an Karl Marx nicht vorbei gekommen wären. Zu Ihrer Studienzeit Ende der 90er - war das da, nach dem Abdanken der real-sozialistischen Modelle in Europa, anders?
Christian Lindner: Nein, das war nicht anders. Denn Karl Marx ist in der Praxis widerlegt, vielfach auch in der ökonomischen Theorie, aber er ist unverändert ja ein faszinierender Gelehrter, Denker, eine Projektionsfläche, vielleicht auch ein Nadelöhr zum Verständnis bestimmter historischer Entwicklungen und vielleicht auch gegenwärtiger Debatten. – Also: An Marx kommt man nicht vorbei.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Marti-Brander, kommende Woche erscheint Ihr Buch "Die Freiheit des Karl Marx: Ein Aufklärer im bürgerlichen Zeitalter". Marx war Journalist, Wissenschaftler, Analytiker. Man könnte sagen, er war Forscher. Er wollte die sozialen und ökonomischen Verhältnisse in erster Linie verstehen, begreifen. – Irren diejenigen, die sagen, er war ein Dogmatiker?
Marx war kein Marxist
Urs Marti-Brander: Das würde ich schon sagen. Er war kein Dogmatiker. Es gibt ja dieses berühmte Bonmot: "Was mich betrifft, so bin ich kein Marxist". Das hat er mal gesagt und ich denke, das war nicht einfach so eine billige Ausrede, sondern das war eigentlich, ich möchte fast sagen, das Bekenntnis eines Scheiterns. Wenn man die ganzen ökonomischen Schriften liest, dann sieht man, wie vieles ihn interessiert hat und wie wenig er eigentlich eben zu einem systematischen Abschluss bringen konnte.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben gesagt, Herr Lindner, man kommt an ihm nicht vorbei, auch wenn man ihn nicht unbedingt lieben muss und seine Einschätzungen, seine Analysen teilen muss. – Würden Sie denn sehen, dass dieser Karl Marx, wenn schon keine praktische Handlungsanleitung, so doch eine Mission hatte?
Christian Lindner: Sicherlich hatte er eine politische Mission, insbesondere dann auch mit Engels zusammen. Ein Stück großer politischer Literatur ist das Manifest der Kommunistischen Partei mit Formulierungen, dass alles Stehende und Ständische verdampft, wie ich jetzt sofort erinnere, und das hohe Tempo, mit dem das Kapital auf der Welt mobilisiert, Produktivkräfte entfesselt - all das beschreibt er ja in einer wunderbar prosaischen Sprache. Deshalb habe ich das in jüngeren Jahren auch gerne gelesen.
Nur bestimmte Grundannahmen und auch historische Vermutungen, vorweggenommene Entwicklungen sind eben so nicht eingetroffen.
Mich würde interessieren, wie Marx heute bestimmte Fragen einschätzen würde – also, beispielsweise die Rolle des Kapitals, das wesentlich weniger wichtig geworden ist als zu seinen Zeiten. Denken wir etwa an die Bedeutung von Wissen heute als wesentlicher Rohstoff. Es ist auch möglich, dass ganze Gesellschaften die Phase der Industrialisierung überspringen und sozusagen direkt in der digitalisierten Ökonomie ankommen.
Der zweite Punkt ist, dass durch Entwicklungen wie Blockchain und andere Aspekte der Digitalisierung der Einzelne viel wichtiger wird und die zentralen Zwischenstellen, die Banken, an Bedeutung verlieren, und nicht zuletzt diese Trennung zwischen Reich der Freiheit, Reich der Notwendigkeit - vereinfachend gesagt, zwischen Arbeit und selbst gestalteter Zeit - ich glaube, dass auch dieser Aspekt, angesichts der Industriearbeitnehmerschaft, die vor bitteren Verhältnissen stand in den 90er-Jahren, und heute dem selbstbestimmten Arbeitnehmer, vielleicht auch anders einzuschätzen ist. Zumindest würde mich interessieren, wie er es sieht.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben gesagt, Herr Lindner, man kommt an ihm nicht vorbei, auch wenn man ihn nicht unbedingt lieben muss und seine Einschätzungen, seine Analysen teilen muss. – Würden Sie denn sehen, dass dieser Karl Marx, wenn schon keine praktische Handlungsanleitung, so doch eine Mission hatte?
Christian Lindner: Sicherlich hatte er eine politische Mission, insbesondere dann auch mit Engels zusammen. Ein Stück großer politischer Literatur ist das Manifest der Kommunistischen Partei mit Formulierungen, dass alles Stehende und Ständische verdampft, wie ich jetzt sofort erinnere, und das hohe Tempo, mit dem das Kapital auf der Welt mobilisiert, Produktivkräfte entfesselt - all das beschreibt er ja in einer wunderbar prosaischen Sprache. Deshalb habe ich das in jüngeren Jahren auch gerne gelesen.
Nur bestimmte Grundannahmen und auch historische Vermutungen, vorweggenommene Entwicklungen sind eben so nicht eingetroffen.
Mich würde interessieren, wie Marx heute bestimmte Fragen einschätzen würde – also, beispielsweise die Rolle des Kapitals, das wesentlich weniger wichtig geworden ist als zu seinen Zeiten. Denken wir etwa an die Bedeutung von Wissen heute als wesentlicher Rohstoff. Es ist auch möglich, dass ganze Gesellschaften die Phase der Industrialisierung überspringen und sozusagen direkt in der digitalisierten Ökonomie ankommen.
Der zweite Punkt ist, dass durch Entwicklungen wie Blockchain und andere Aspekte der Digitalisierung der Einzelne viel wichtiger wird und die zentralen Zwischenstellen, die Banken, an Bedeutung verlieren, und nicht zuletzt diese Trennung zwischen Reich der Freiheit, Reich der Notwendigkeit - vereinfachend gesagt, zwischen Arbeit und selbst gestalteter Zeit - ich glaube, dass auch dieser Aspekt, angesichts der Industriearbeitnehmerschaft, die vor bitteren Verhältnissen stand in den 90er-Jahren, und heute dem selbstbestimmten Arbeitnehmer, vielleicht auch anders einzuschätzen ist. Zumindest würde mich interessieren, wie er es sieht.
Das Kommunistische Manifest war ein Bekenntnis zum Liberalismus
Deutschlandfunk Kultur: Wäre Karl Marx vielleicht sogar zufrieden mit den Entwicklungen? Würde er sie, so wie Herr Lindner sie beschrieben hat, als Fortschritt im Sinne des Individuums und der Freiheit des Individuums, der Selbstbestimmung des Individuums begreifen können?
Urs Marti-Brander: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen: Ja und Nein. Ja aus den Gründen, die Herr Lindner bereits angesprochen hat: Das Kommunistische Manifest ist ja ein Loblied auf den Kapitalismus. Das muss man wirklich so sehen. Und es ist auch ein Bekenntnis zum Liberalismus. Hier darf ich als Schweizer vielleicht eine kleine Geschichte anfügen: Es gibt ja im Kommunistischen Manifest diese verschiedenen Vorschläge, mit welchen politischen Kräften man sich verbinden soll. Da heißt es, "in der Schweiz werden wir uns mit den Liberalen verbünden", also, das, was quasi in Deutschland die FDP wäre.
Und ein wichtiger Punkt auch im Kommunistischen Manifest ist eben: Jener Sozialismus, der zurück will in die Vergangenheit, jener Sozialismus, der kollektivistisch ist, den hat er ganz eindeutig abgelehnt.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben schon eben gesagt, Marx hat von sich selbst gesagt, er ist kein Marxist. Wäre er denn Liberaler? Wäre er in der FDP?
Urs Marti-Brander: Das eigentlich jetzt weniger. Ich habe gestern noch das Vergnügen gehabt, eine Rede von ihm zu lesen. Mit sehr vielem war ich einverstanden. Wo ich nicht einverstanden war oder bin, das ist die Einschätzung des Neoliberalismus. Ich möchte jetzt nicht die bekannten Sprüche über den Neoliberalismus hier loswerden, sondern auf etwas hinweisen.
Es gibt von Friedrich von Hayek, der ja – denke ich doch – der wichtigste Vordenker des Neoliberalismus gewesen ist, eine Schrift aus den 50er Jahren über die Angestellten, wo er sagt: Die Angestellten, gut, dass es sie gibt, schlecht, dass es so viele davon gibt, schlecht, dass jetzt gerade die Demokratisierung beginnt, weil jetzt quasi jene Leute, die politisch nicht kompetent sind, ans Ruder kommen. – Das kritisiere ich eigentlich am Neoliberalismus, diesen Elitarismus, diese Auffassung, dass nur diejenigen, die über privates Eigentum verfügen, politisch kompetent sind.
Urs Marti-Brander: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen: Ja und Nein. Ja aus den Gründen, die Herr Lindner bereits angesprochen hat: Das Kommunistische Manifest ist ja ein Loblied auf den Kapitalismus. Das muss man wirklich so sehen. Und es ist auch ein Bekenntnis zum Liberalismus. Hier darf ich als Schweizer vielleicht eine kleine Geschichte anfügen: Es gibt ja im Kommunistischen Manifest diese verschiedenen Vorschläge, mit welchen politischen Kräften man sich verbinden soll. Da heißt es, "in der Schweiz werden wir uns mit den Liberalen verbünden", also, das, was quasi in Deutschland die FDP wäre.
Und ein wichtiger Punkt auch im Kommunistischen Manifest ist eben: Jener Sozialismus, der zurück will in die Vergangenheit, jener Sozialismus, der kollektivistisch ist, den hat er ganz eindeutig abgelehnt.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben schon eben gesagt, Marx hat von sich selbst gesagt, er ist kein Marxist. Wäre er denn Liberaler? Wäre er in der FDP?
Urs Marti-Brander: Das eigentlich jetzt weniger. Ich habe gestern noch das Vergnügen gehabt, eine Rede von ihm zu lesen. Mit sehr vielem war ich einverstanden. Wo ich nicht einverstanden war oder bin, das ist die Einschätzung des Neoliberalismus. Ich möchte jetzt nicht die bekannten Sprüche über den Neoliberalismus hier loswerden, sondern auf etwas hinweisen.
Es gibt von Friedrich von Hayek, der ja – denke ich doch – der wichtigste Vordenker des Neoliberalismus gewesen ist, eine Schrift aus den 50er Jahren über die Angestellten, wo er sagt: Die Angestellten, gut, dass es sie gibt, schlecht, dass es so viele davon gibt, schlecht, dass jetzt gerade die Demokratisierung beginnt, weil jetzt quasi jene Leute, die politisch nicht kompetent sind, ans Ruder kommen. – Das kritisiere ich eigentlich am Neoliberalismus, diesen Elitarismus, diese Auffassung, dass nur diejenigen, die über privates Eigentum verfügen, politisch kompetent sind.
Liberalismus und Marxismus neu zusammen denken?
Christian Lindner: Ich würde mir diese Lesart ausdrücklich nicht zu eigen machen wollen. Mein Verständnis von neuem Liberalismus leitet sich eher ab von der Abgrenzung gegenüber dem alten Liberalismus. Wenn der alte Liberalismus an Laissez-faire gedacht hat, die Verhältnisse ordnen sich selbst, es gibt eine spontane Ordnung ohne Eingriff eines Gesetzgebers, eines Schiedsrichters, dann ist spätestens mit der Weltwirtschaftskrise der 20er und 30er Jahre diese Auffassung ja widerlegt. Also, dieser neue Liberalismus, über den ich sprechen möchte, der ist eher in der Ordo-Tradition, also einer Ordnung, eines Rahmens, den wir brauchen, damit sich innerhalb der Ordnung, geordnet durch einen Schiedsrichterstaat, der Einzelne entfalten kann.
Wichtig ist, dass nicht ein übermächtig bürokratischer Staat oder starke wirtschaftliche Spieler so viel Macht über den Einzelnen gewinnen, dass sie die Regeln des Spiels diktieren können und dass sie selbstherrlich über Lebenschancen auch entscheiden. Da vielleicht ist der emanzipatorische Gedanke von Marx in einem entfernten Verwandtschaftsverhältnis zu Liberalismus.
Deutschlandfunk Kultur: Sehr entfernt?
Christian Lindner: Ja, relativ entfernt. Das wurde historisch auch unterschiedlich gesehen. Nimmt man die Geschichte der deutschen Liberalen der FDP, so gab es in den 70er-Jahren tatsächlich eine Debatte über Liberalismus und Marxismus. Karl-Hermann Flach und andere haben solche Gedanken gehegt. Deren These war, dass ungefähr um die Jahrhundertwende, 19./20. Jahrhundert, die liberalen, davor emanzipatorischen Kräfte sich verbündet hätten mit dem Besitzbürgertum und den eigenen emanzipatorischen Charakter aufgegeben hätten. Und deshalb müsse man Liberalismus und Marxismus neu zusammen denken.
Deutschlandfunk Kultur: Sie sagen das sehr distanziert. Es ist nicht Ihre Sicht?
Wichtig ist, dass nicht ein übermächtig bürokratischer Staat oder starke wirtschaftliche Spieler so viel Macht über den Einzelnen gewinnen, dass sie die Regeln des Spiels diktieren können und dass sie selbstherrlich über Lebenschancen auch entscheiden. Da vielleicht ist der emanzipatorische Gedanke von Marx in einem entfernten Verwandtschaftsverhältnis zu Liberalismus.
Deutschlandfunk Kultur: Sehr entfernt?
Christian Lindner: Ja, relativ entfernt. Das wurde historisch auch unterschiedlich gesehen. Nimmt man die Geschichte der deutschen Liberalen der FDP, so gab es in den 70er-Jahren tatsächlich eine Debatte über Liberalismus und Marxismus. Karl-Hermann Flach und andere haben solche Gedanken gehegt. Deren These war, dass ungefähr um die Jahrhundertwende, 19./20. Jahrhundert, die liberalen, davor emanzipatorischen Kräfte sich verbündet hätten mit dem Besitzbürgertum und den eigenen emanzipatorischen Charakter aufgegeben hätten. Und deshalb müsse man Liberalismus und Marxismus neu zusammen denken.
Deutschlandfunk Kultur: Sie sagen das sehr distanziert. Es ist nicht Ihre Sicht?
Verzicht auf individuelles Eigentum entmündigt und fesselt den Einzelnen
Christian Lindner: Es ist nicht meine Sicht. Es ist, glaube ich, eine zeitgebundene Sicht der 1970er Jahre, weil ich doch sehr stark glaube, dass mit Marxismus und damit dem Verzicht auf individuelles Eigentum mindestens an den Produktivkräften nicht nur gesellschaftlicher Fortschritt gehemmt wird, dass es ein Stück auch Entmündigung und Fesselung des Einzelnen ist. Ich glaube, dass Eigentum nicht die Voraussetzung von Freiheit sein darf, aber die Möglichkeit es zu besitzen und es auch einsetzen zu können, das ist sehr stark doch mit meinem freiheitlichen Menschen- und Weltbild verbunden.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Marti-Brander, wenn man sagt, es hat zumindest zumindest Berührungspunkte gegeben zwischen dem liberalen Denken von Marx und dem liberalen Denken der aktuellen Liberalen der FDP Berührungspunkte, wo hätte sich denn Marx aus Ihrer Sicht am ehesten gerieben mit der real existierenden FDP?
Urs Marti-Brander: Da muss ich jetzt ein bisschen chronologisch zurückgehen. Das beginnt ja eigentlich beim englischen Philosophen John Locke. John Locke hat gesagt, dass Recht auf Eigentum ein Menschenrecht ist. Und dann wollte er das begründen. Und dann hat er gesagt: Wenn ich einen Apfel auflese, dann habe ich gearbeitet. Und mit dieser Arbeit habe ich mir das als Eigentum verdient. – Das ist richtig. Das sieht Marx genauso.
Dann fügt Locke aber hinzu: Oder ich habe meinen Knecht arbeiten lassen, also habe ich gearbeitet. – Und das ist nicht richtig. Da würde Marx widersprechen.
Jetzt würde ich aber Herrn Lindner insofern widersprechen: Wenn wir das Kapital lesen, dann fällt uns doch auf, dass der Begriff Kommunismus nie vorkommt. Der Kollektivismus gilt als Sünde des Kapitalismus, also die Großbetriebe, Konzentrationsprozesse. Und ganz im letzten Kapital des ersten Buchs des Kapitals sagt er: Was ist eigentlich das Ziel? Das Ziel ist die Restitution des individuellen Eigentums. Wenn ich etwas selbst erarbeitet habe, gehört es natürlich mir. Dann ist diese Privatheit absolut legitim. Aber in der Regel ist das ja nicht der Fall, weil die Arbeiter gezwungen werden, etwas zu tun, wofür sie nicht ausreichend belohnt werden.
Urs Marti-Brander: Da muss ich jetzt ein bisschen chronologisch zurückgehen. Das beginnt ja eigentlich beim englischen Philosophen John Locke. John Locke hat gesagt, dass Recht auf Eigentum ein Menschenrecht ist. Und dann wollte er das begründen. Und dann hat er gesagt: Wenn ich einen Apfel auflese, dann habe ich gearbeitet. Und mit dieser Arbeit habe ich mir das als Eigentum verdient. – Das ist richtig. Das sieht Marx genauso.
Dann fügt Locke aber hinzu: Oder ich habe meinen Knecht arbeiten lassen, also habe ich gearbeitet. – Und das ist nicht richtig. Da würde Marx widersprechen.
Jetzt würde ich aber Herrn Lindner insofern widersprechen: Wenn wir das Kapital lesen, dann fällt uns doch auf, dass der Begriff Kommunismus nie vorkommt. Der Kollektivismus gilt als Sünde des Kapitalismus, also die Großbetriebe, Konzentrationsprozesse. Und ganz im letzten Kapital des ersten Buchs des Kapitals sagt er: Was ist eigentlich das Ziel? Das Ziel ist die Restitution des individuellen Eigentums. Wenn ich etwas selbst erarbeitet habe, gehört es natürlich mir. Dann ist diese Privatheit absolut legitim. Aber in der Regel ist das ja nicht der Fall, weil die Arbeiter gezwungen werden, etwas zu tun, wofür sie nicht ausreichend belohnt werden.
Arbeitnehmer sind heute Unternehmer ihrer eigenen Lebenschancen
Christian Lindner: Weil der Unternehmer den Mehrwert, der geschaffen wird, für sich einstreicht. – Das, glaube ich, ist eine verkürzte Sicht.
Natürlich ist die Bereitschaft, Risiken einzugehen, Kapital, Wissen einzusetzen, neues Wissen zu schöpfen, auch eine Form von Arbeit. Ich glaube, dass – zumindest nach meinem Eindruck, Sie, Herr Marti-Brander, sind natürlich vertieft in der Literatur – aber doch Marx sehr stark geprägt ist von einem Begriff von Arbeit, der aus dem Frühkapitalismus bzw. der beginnenden Industriegesellschaft erwächst und wir heute natürlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, die selbst Unternehmer ihrer eigenen Lebenschance, ihres eigenen Arbeitsplatzes sind, die selbstbestimmt leben und arbeiten wollen, die die Trennung zwischen Arbeit und Leben auch gar nicht mehr so klar ziehen wie früher, wo Arbeit nicht nur Quelle von Eigentum, sondern eben auch von Sinn und Struktur im Leben ist.
Insofern weiß ich nicht, ob wir davon noch für die heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse so viel lernen können. Wenn wir in die Praxis zumindest der Rezeption der marxschen Schriften für die Politik und die konkreten Gesellschaftsmodelle schauen, gibt's das alte Bonmot, die Theorie sei Marx gewesen, die Praxis Murks.
Jenseits dieses Bonmots muss man sagen, dass all die Versuche, seine Theorien in gesellschaftliche Praxis umzusetzen, nicht zu mehr Humanität geführt haben, sondern eher zum Gegenteil, weshalb ich glaube, dass es eine Art Interdependenz der Ordnung gibt: Offene Gesellschaft, die kein Ziel verfolgt, eine Gesellschaft der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten, die dann aber auch ein Wirtschaftsmodell braucht, das auf Eigentum, individuelles Eigentum, und Wettbewerb basiert. Ich glaube, man kann diese Sphären nicht voneinander trennen.
Deutschlandfunk Kultur: Ich glaube, wo wir uns alle sofort einigen könnten, wäre auch so ein Satz von Karl Marx, wie Sie ihn in Ihrem Buch zitieren: "Menschlich gut kann nur sein, was eine Verwirklichung der Freiheit ist." – Wo es dann schwierig wird, ist die Diskussion darüber, welche Form von Freiheit meinen wir und wo werden über kapitalistische Verhältnisse zwar neue Freiheiten geschaffen, auf der anderen Seite aber auch wieder Selbstbestimmung und individuelle Freiheit eingeschränkt.
Da ist doch die Frage, inwieweit diese real existierenden Modelle, die es mal gab, also, in Europa gibt es sie ja zumindest nicht mehr, dazu geführt haben, dass alles, was im Kern auch über Freiheit gerade richtig sein mag, zustimmungsfähig sein mag bei Karl Marx, diabolisiert wurde, weil man sagt: Schaut euch an, was für ein Murks draus gemacht wurde. – Dafür kann der gute Karl ja aber nix.
Natürlich ist die Bereitschaft, Risiken einzugehen, Kapital, Wissen einzusetzen, neues Wissen zu schöpfen, auch eine Form von Arbeit. Ich glaube, dass – zumindest nach meinem Eindruck, Sie, Herr Marti-Brander, sind natürlich vertieft in der Literatur – aber doch Marx sehr stark geprägt ist von einem Begriff von Arbeit, der aus dem Frühkapitalismus bzw. der beginnenden Industriegesellschaft erwächst und wir heute natürlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, die selbst Unternehmer ihrer eigenen Lebenschance, ihres eigenen Arbeitsplatzes sind, die selbstbestimmt leben und arbeiten wollen, die die Trennung zwischen Arbeit und Leben auch gar nicht mehr so klar ziehen wie früher, wo Arbeit nicht nur Quelle von Eigentum, sondern eben auch von Sinn und Struktur im Leben ist.
Insofern weiß ich nicht, ob wir davon noch für die heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse so viel lernen können. Wenn wir in die Praxis zumindest der Rezeption der marxschen Schriften für die Politik und die konkreten Gesellschaftsmodelle schauen, gibt's das alte Bonmot, die Theorie sei Marx gewesen, die Praxis Murks.
Jenseits dieses Bonmots muss man sagen, dass all die Versuche, seine Theorien in gesellschaftliche Praxis umzusetzen, nicht zu mehr Humanität geführt haben, sondern eher zum Gegenteil, weshalb ich glaube, dass es eine Art Interdependenz der Ordnung gibt: Offene Gesellschaft, die kein Ziel verfolgt, eine Gesellschaft der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten, die dann aber auch ein Wirtschaftsmodell braucht, das auf Eigentum, individuelles Eigentum, und Wettbewerb basiert. Ich glaube, man kann diese Sphären nicht voneinander trennen.
Deutschlandfunk Kultur: Ich glaube, wo wir uns alle sofort einigen könnten, wäre auch so ein Satz von Karl Marx, wie Sie ihn in Ihrem Buch zitieren: "Menschlich gut kann nur sein, was eine Verwirklichung der Freiheit ist." – Wo es dann schwierig wird, ist die Diskussion darüber, welche Form von Freiheit meinen wir und wo werden über kapitalistische Verhältnisse zwar neue Freiheiten geschaffen, auf der anderen Seite aber auch wieder Selbstbestimmung und individuelle Freiheit eingeschränkt.
Da ist doch die Frage, inwieweit diese real existierenden Modelle, die es mal gab, also, in Europa gibt es sie ja zumindest nicht mehr, dazu geführt haben, dass alles, was im Kern auch über Freiheit gerade richtig sein mag, zustimmungsfähig sein mag bei Karl Marx, diabolisiert wurde, weil man sagt: Schaut euch an, was für ein Murks draus gemacht wurde. – Dafür kann der gute Karl ja aber nix.
Marx nicht verantwortlich für das, was Politiker aus seinen Schriften gelesen haben
Christian Lindner: Nein, man kann ihn auch nicht dafür verantwortlich machen, was später Politiker aus seinen Schriften gelesen haben und wo vielleicht auch ganz andere Machterwägungen dahinter standen und er nur genutzt wird.
Aber mich würde schon, Herr Marti-Brander, interessieren, wie Sie diese Theorie der Arbeit sehen, die marxsche Vorstellung von Entfremdung von Arbeit, wie Sie das im heutigen Kontext sehen, eben vom stärker selbstbestimmten Arbeiten mit sozialen Sicherheiten, der Möglichkeit, aus Arbeit Identität zu schöpfen. Wie schätzen Sie das ein?
Urs Marti-Brander: Ja, ich denke, in dieser Hinsicht sind wir nicht so weit voneinander entfernt. Ich muss nochmal zurückgehen auf Aristoteles. Die klassische Definition, was ist Freiheit, hieß für Aristoteles ganz platt: nicht arbeiten müssen. Also, wer arbeiten muss, kann nicht frei sein.
Und Marx war ja natürlich sehr stark beeinflusst von Aristoteles, aber genau in dem Punkt hat er ihm widersprochen. Er spricht dann von der Fremdbestimmung.
Hier scheint mir aber wichtig zu sein, dass für ihn Arbeit ja doch positiv konnotiert ist in dem Sinne, als sie eben die Selbstschöpfung des Menschen ist. Hier zeigt sich auch das Problem des Kapitalismus, dass die Unabhängigkeit des Individuums eben nicht gewährleistet wird, wenn die Arbeit so organisiert ist, dass ein Unternehmer, ein Kapitaleigner befehlen kann, kommandieren kann.
Aber mich würde schon, Herr Marti-Brander, interessieren, wie Sie diese Theorie der Arbeit sehen, die marxsche Vorstellung von Entfremdung von Arbeit, wie Sie das im heutigen Kontext sehen, eben vom stärker selbstbestimmten Arbeiten mit sozialen Sicherheiten, der Möglichkeit, aus Arbeit Identität zu schöpfen. Wie schätzen Sie das ein?
Urs Marti-Brander: Ja, ich denke, in dieser Hinsicht sind wir nicht so weit voneinander entfernt. Ich muss nochmal zurückgehen auf Aristoteles. Die klassische Definition, was ist Freiheit, hieß für Aristoteles ganz platt: nicht arbeiten müssen. Also, wer arbeiten muss, kann nicht frei sein.
Und Marx war ja natürlich sehr stark beeinflusst von Aristoteles, aber genau in dem Punkt hat er ihm widersprochen. Er spricht dann von der Fremdbestimmung.
Hier scheint mir aber wichtig zu sein, dass für ihn Arbeit ja doch positiv konnotiert ist in dem Sinne, als sie eben die Selbstschöpfung des Menschen ist. Hier zeigt sich auch das Problem des Kapitalismus, dass die Unabhängigkeit des Individuums eben nicht gewährleistet wird, wenn die Arbeit so organisiert ist, dass ein Unternehmer, ein Kapitaleigner befehlen kann, kommandieren kann.
Wenn man den ersten Band des Kapitals liest - man kann von seiner ökonomischen Theorie halten, was man will - aber es ist eigentlich ein politisch sehr interessantes Buch, weil er zeigt, dass die Freiheit der arbeitenden Menschen doch durch dieses kapitalistische – ich sage jetzt mal – Ausbeutungssystem, man könnte auch sagen Kommandosystem sehr stark eingeschränkt wird. Das zeigt sich am Beispiel der Gesundheit am Arbeitsplatz. Und das zeigt sich eben in dem willkürlichen – wie soll ich sagen – willkürlichen Diebstahl von Zeit.
Deutschlandfunk Kultur: Karl Marx' Kritik an liberalen Doktrinen zielte ja im Kern auf die ihnen – wie er es sah – "eigene Unfähigkeit" ab, "neue Formen von Unfreiheiten, die über den Kapitalismus entstehen, zur Kenntnis zu nehmen".
Deutschlandfunk Kultur: Karl Marx' Kritik an liberalen Doktrinen zielte ja im Kern auf die ihnen – wie er es sah – "eigene Unfähigkeit" ab, "neue Formen von Unfreiheiten, die über den Kapitalismus entstehen, zur Kenntnis zu nehmen".
Wenn der Wohlfahrtsstaat die Kommandos übernimmt, ist das freiheitseinschränkend
Christian Lindner: Er kritisiert ja am Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Wir hatten ja mehrfach schon Gelegenheit herauszuarbeiten, dass auch liberale Denker nicht mehr in der Steinzeit leben, sondern den Staat als Schiedsrichter brauchen. Wenn der Staat bürokratisch wird, wenn er den Menschen auch die Möglichkeiten der Selbstbestimmung durch Schablonen der Wohlfahrtsstaatlichkeit einschränkt, weil Menschen sich an Sozialsystemen in ihren Lebensentscheidungen anpassen müssen, Herr Marti, wenn der Wohlfahrtsstaat die Kommandos erteilt, dann kann das genauso freiheitseinschränkend sein wie ein Unternehmer, der die Kommandos erteilt, weil beide Macht über den Einzelnen ausüben.
Wir haben uns angewöhnt, dann, wenn die Macht politisch vermittelt ist über einen Staat, über den Bürokratismus, empfinden wir es eher als legitim – ich nicht, weil ich die Freiheitsbilanz eines jeden Einzelnen sehe, unabhängig davon, ob es eine Shitstorm-Kultur bei Twitter ist, die die Meinungsfreiheit einschränkt, oder ein bürokratischer Wohlfahrtsstaat oder ein machtvoller Unternehmer.
Da muss man aufpassen. Das ist vielleicht die historische Falle, in die Liberale einmal getreten sind, den Status quo zu verteidigen. Wenn man eins lernen kann, aus der Annäherung von Liberalen und Marxisten 19. Jahrhundert und die Trennung, dann dass auch der Liberale sich mit dem Status quo genauso wenig zufrieden geben darf wie der Marxist. Der Unterschied ist, der klassische Marxist geht von einem vielleicht historischen Endzustand aus, während der Liberale mit Popper sagt: die Gesellschaft muss offen bleiben. Wir wissen nicht, wohin die Entwicklung uns führt. Aber wir geben uns nicht zufrieden mit dem, was wir haben.
Heißt konkret: Wir wollen natürlich, dass auch der einzelne Mensch in der Wirtschaft sich entfalten kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass er über Qualifikation verfügt. Je qualifizierter er ist, desto selbstbestimmter, desto weniger werden andere ihn auch für einfache stumpfe Tätigkeiten nutzen können – gerade jetzt in unserer sich verändernden Ökonomie eine Chance auch für die individuelle Emanzipation von – wie man früher sagte – abhängig Beschäftigten stärker unabhängig zu werden.
Das Zweite: Wenn wir sprechen über den Kapitalismus, steckt dahinter das Bild der Ballung von Kapital in wenigen Händen. Das müsste eigentlich der zweite Reformimpuls sein, dass das Eigentum an Kapital, an Produktivmitteln stärker in der Gesellschaft verteilt wird.
Das Zweite: Wenn wir sprechen über den Kapitalismus, steckt dahinter das Bild der Ballung von Kapital in wenigen Händen. Das müsste eigentlich der zweite Reformimpuls sein, dass das Eigentum an Kapital, an Produktivmitteln stärker in der Gesellschaft verteilt wird.
Volk von Eigentümern statt Volkseigentum
Deutschlandfunk Kultur: Höre ich da Herrn Lindner von Umverteilung reden?
Christian Lindner: Der Herr Lindner redet nicht von Volkseigentum. Er redet von einem Volk von Eigentümern. Gerade der Kapitalismus in seiner modernen Form bietet ja die Chance, dass der Einzelne – vermittelt über unsere Kapitalmärkte – kleine Anteile auch am Produktivvermögen, sprich Aktiengesellschaften, also, Daimler, Deutsche Bank, erwerben kann. Ich glaube, da liegt eine Chance der Versöhnung der unterschiedlichen Modelle und auch eine Chance, dass der Einzelne sich als Miteigentümer begreift, selbst wenn er nicht der Besitzer eines großen Unternehmens ist.
Deutschlandfunk Kultur: Hätte Karl Marx an der Stelle dann nachgerade zwingend anfügen müssen, guckt euch die Finanzkrise an. Die Leidtragenden sind in erster Linie genau die kleinen Anteilseigner, von denen Herr Lindner gerade gesprochen hat.
Deutschlandfunk Kultur: Hätte Karl Marx an der Stelle dann nachgerade zwingend anfügen müssen, guckt euch die Finanzkrise an. Die Leidtragenden sind in erster Linie genau die kleinen Anteilseigner, von denen Herr Lindner gerade gesprochen hat.
Urs Marti-Brander: Herr Lindner hat ja wichtige Punkte angesprochen, wo ich einfach widersprechen möchte. Es gibt einen späten Text von Marx. Das ist die Kritik des Gothaer Programms. Heute würde man sagen, das ist die Kritik des Parteiprogramms der Sozialdemokraten, wo er all das ja genau kritisiert, was Sie auch kritisieren. Was sagt das? Das ist ein Umverteilungsprogramm. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht den materiellen Reichtum umverteilen, sondern wir wollen einen Zustand, in dem die Abhängigkeit des Einzelnen von anderen, seien es Unternehmen, sei es Staat, sei es Wohlfahrtsstaat, möglichst gering ist. Das scheint mir wichtig zu sein.
Das wird immer wieder vergessen. Marx ist kein Gerechtigkeitstheoretiker. Marx ist kein Theoretiker der distributiven Gerechtigkeit. Im Gegenteil, er sagt, darum geht es nicht. Gerechtigkeit ist für ihn eigentlich ein rein deskriptiver Begriff. Das heißt, in jeder Gesellschaft braucht es gewisse Regeln der Umverteilung. So wie es die Sozialdemokraten tun, ist es falsch. Das führt nicht zu größerer Freiheit des Individuums.
Ich möchte aber vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. Ich versuche ja in meinem Buch auch zu zeigen, wie stark der Einfluss von Benjamin Constant, des französischen Liberalen, auf Marx gewesen ist. Und tatsächlich hat Marx sehr viel von Constant übernommen. Man muss dann die Frage stellen: Weshalb kam es 1848 zu einem radikalen Kurswechsel?
Christian Lindner: Und warum?
Das wird immer wieder vergessen. Marx ist kein Gerechtigkeitstheoretiker. Marx ist kein Theoretiker der distributiven Gerechtigkeit. Im Gegenteil, er sagt, darum geht es nicht. Gerechtigkeit ist für ihn eigentlich ein rein deskriptiver Begriff. Das heißt, in jeder Gesellschaft braucht es gewisse Regeln der Umverteilung. So wie es die Sozialdemokraten tun, ist es falsch. Das führt nicht zu größerer Freiheit des Individuums.
Ich möchte aber vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. Ich versuche ja in meinem Buch auch zu zeigen, wie stark der Einfluss von Benjamin Constant, des französischen Liberalen, auf Marx gewesen ist. Und tatsächlich hat Marx sehr viel von Constant übernommen. Man muss dann die Frage stellen: Weshalb kam es 1848 zu einem radikalen Kurswechsel?
Christian Lindner: Und warum?
Klassenkampf ist eine Erfindung der Liberalen
Urs Marti-Brander: Weshalb gilt jetzt plötzlich die Kritik des Liberalismus? Weil das nicht mehr der gleiche Liberalismus, derjenige von Constant oder Tocqueville, gewesen ist. Ich denke, man kann das am besten zeigen mit etwas, was Marx an unzähligen Beispielen gezeigt hat. Das ist das Motiv des Klassenkampfs.
Klassenkampf, Marx hat das selbst gesagt, aber das ist bekannt, ist keine Erfindung von Marx, Klassenkampf ist eine Erfindung der Liberalen. Es hieß: Bürgertum gegen den Adel. Man darf nicht vergessen, die Französische Revolution ist wesentlich ein Produkt der – ich sage jetzt mal etwas ironisch – Politik des Adels, der sich strikt geweigert hat Steuern zu zahlen. Nur die armen Leute mussten Steuern zahlen. Also: Klassenkampf des liberalen Bürgertums gegen den Adel.
Und dann sagt Marx, und ich denke, er sagt es zu Recht: Aber jetzt gibt es eine neue Klasse. Jetzt wird diese neue Klasse unterdrückt - in dem Sinne, dass man ihr das Recht auf politische Partizipation abspricht, weil angeblich nur diejenigen, die privates Eigentum haben, politisch kompetent sind.
Christian Lindner: Das hatte ich ja zum Ausdruck zu bringen versucht, dass es die Gefahr gab, auch von Liberalen gesehen, dass man sich im Status quo einrichtet und dass man sich verbindet mit dem Besitzbürgertum. Ich glaube, da ist der emanzipatorische Gehalt des liberalen Denkens dann auch verloren gegangen.
Klassenkampf sagen Sie. Ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft von Klassen zu sprechen, fällt schwerer als damals, weil unsere Gesellschaft viel fragmentierter, individualisierter ist, als dass es so einfache Klassengegensätze gibt. Aber eins gibt es heute vielleicht sogar mehr denn je als Gefahr im Silicon-Valley-Plattform-Kapitalismus und einer entfesselten Wohlfahrtsstaatlichkeit andererseits, dass es Machtverhältnisse gibt in einer Gesellschaft.
Deutschlandfunk Kultur: Datenkapitalismus.
Christian Lindner: Datenkapitalismus, Datensammlungen. Wir denken an Facebook, Amazon, die sehr machtvoll agieren, wo ein Einzelner tatsächlich dann auch über enorme Möglichkeiten verfügt. Das muss Reformer von allen Seiten auf den Plan rufen, die vielleicht mit unterschiedlichen Rezepten agieren. Aber ich bin davon überzeugt, dass das eine Schlüsselfrage für die weitere Entwicklung liberaler Gesellschaften in den nächsten Jahrzehnten sein wird, diese Verfügung über die Einzelnen durch machtvolle Instanzen auch wieder zu brechen, damit es eben nicht zu einer Unterdrückung kommt.
Kommerzialisierung von Journalismus bedroht Pressefreiheit
Deutschlandfunk Kultur: Ich möchte in den letzten Minuten dieses Tacheles gern noch auf einen Aspekt kommen, der Karl Marx sehr wichtig war, eine Form der Freiheit, nämlich der Pressefreiheit als Ausdruck jeglicher liberaler demokratischer Gesellschaftsform. Was ich dann interessant fand, auch in Ihrem Buch habe ich diesen Satz gefunden: "Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein."
Mit welchem Blick meinen Sie – lassen Sie uns noch eine Runde spekulieren – würde Karl Marx auf unsere Medienlandschaft heute schauen, gerade vor dem Hintergrund eines solchen Satzes?
Mit welchem Blick meinen Sie – lassen Sie uns noch eine Runde spekulieren – würde Karl Marx auf unsere Medienlandschaft heute schauen, gerade vor dem Hintergrund eines solchen Satzes?
Urs Marti-Brander: Man kann ihn ja nicht fragen.
Christian Lindner: Gerade vor dem Hintergrund seiner eigenen Lebenssituation als Journalist, der nicht immer vom Reichtum bedroht war.
Urs Marti-Brander: Ja, so kann man es auch ausdrücken.
Ich denke, dass tatsächlich - wenn ich jetzt hier ganz kurz von der Schweiz sprechen darf, aber ich denke, die Verhältnisse sind überall vergleichbar - die Zeitungen, die Medien ganz allgemein sich diesem Wettbewerb stellen müssen. Und dieser Wettbewerb, ich sage es jetzt vielleicht mal ein bisschen allzu grob, führt zu einer Entleerung des Inhaltlichen, führt dazu natürlich zu großen Abhängigkeiten von Unternehmen, von der Werbung, was auch immer, führt dazu, dass das Niveau oder die Anstrengung, politisch komplexe Realitäten zu beschreiben und zu analysieren, immer mehr fehlt.
Deutschlandfunk Kultur: Beschneidet die Freiheit der Presse also.
Urs Marti-Brander: Ja.
Christian Lindner: Wir haben ja eine paradoxe Situation, dass wir über soziale Medien auch eine Art Demokratisierung der Produktion von Inhalten erhofft haben. Diese Hoffnung ist leider dadurch getrübt, dass es nicht nur Qualität gab, sondern eben auch Fake News. Und man hatte das Gefühl, dass manche sozialen Medien übernommen werden von Trollen, die nur ihre eigene schlechte Laune und ihre Ressentiments verbreiten wollen.
Insofern: Die journalistischen Medien haben eine große Rolle auch für das Selbstverständnis einer Gesellschaft, für den sozialen Frieden einer Gesellschaft, weil sie in der Lage sind, Aspekte von Wahrheit und von Fakten herauszuarbeiten, eben auch mit dem Anspruch, objektiv zu beschreiben, was Sache ist.
So, jetzt Marx' Satz – Journalismus, Presse, kein Gewerbe: Ich empfehle da zu unterscheiden. Der Verleger, das ist ein Gewerbe mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Journalist, der lebt von seiner Freiheit und natürlich auch von seinen originellen Gedanken und seiner originellen Art, etwas zu schreiben. Und die Aufgabe des Verlegers ist es, Geschäftsmodelle zu finden, damit journalistische Qualität sich entfalten kann. Ich würde da nicht nur pessimistisch sein. Der Journalismus ändert sich, aber die Qualitätsmedien werden immer eine Chance haben. Da wird es immer ein Publikum geben. – Und notfalls haben wir ja auch noch öffentlich-rechtliche.
Presse muss auch denjenigen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden
Urs Marti-Brander: Und darf ich etwas noch anfügen, was mir sehr wichtig zu sein scheint, nämlich diese frühen Schriften zur Pressefreiheit. Natürlich, die Pressefreiheit ist ein Prinzip, das für Marx sehr wichtig gewesen ist, auch in seiner Rolle als Chefredakteur der "Neuen Rheinischen Zeitung". Aber es kommt noch etwas anderes hinzu, was oft übersehen wird. Diese Schriften über Pressefreiheit wurden ja geschrieben als Kommentar zu den Verhandlungen der Landstände, der preußischen Landstände. Das war eine Körperschaft, in der nur die Angehörigen des Adels vertreten gewesen sind. Das städtische Bürgertum hatte einige Sitze, aber nicht genug Gewicht.
Und dann gibt es ein schönes Beispiel, nämlich das Elend der Weinbauern an der Mosel. Das hatte damals auch sehr viel mit dem Beschluss Preußens, den Freihandel einzuführen, zu tun, weil, die Moselweinbauern gehörten ja zu Frankreich. Dort machten sie ein gutes Geschäft und dann konnten sie den Wein nicht mehr verkaufen. Dann sagt Marx: Jetzt schaut euch mal die Zeitungen oder, was man als Medien bezeichnen kann, an. Niemand spricht von den Moselbauern. – Also ist die Presse eigentlich auch ein Instrument dafür, den Blick auf jene armen Leute, Leute im Elend zu werfen, die sonst niemand zur Kenntnis nimmt.
Christian Lindner: Was ich interessant finde an diesem Gedanken Pressefreiheit, nur ganz kurz: Wir haben ja auf der Welt Systeme, die sich noch auf Marx berufen, etwa in chinesischer Lesart, und die paradoxerweise, wie in der Theorie, auch kritisch eingestellt sind gegenüber einer vielfältigen Gesellschaft - sprich, von unterschiedlichen Klassen gegenüber dem Eigentum. Und ausgerechnet dort aber wird die Pressefreiheit eingeschränkt.
Deutschlandfunk Kultur: Weil sie den revolutionären Gedanken entgegenwirkt?
Christian Lindner: Die freie Presse zumindest stellen sie infrage, den Dominanzanspruch, oder würde den Dominanzanspruch einer Partei infrage stellen, einer politischen Grundrichtung usw. usf. Freiheit ist kein Spartenprogramm. Das kann es nur ganz oder gar nicht geben.
Deutschlandfunk Kultur: Ganz zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch, mit der Bitte um eine kurze Kommentierung, einen Satz von Gregor Gysi zitieren: "Karl Marx war einer der größten Historiker und Ökonomen nicht nur unseres Landes, sondern in der Geschichte." – Egal, wo man politisch verortet ist, kann man das heute noch so stehenlassen?
Urs Marti-Brander: Mich würde das jetzt nicht stören. Es sagt nur nicht sehr viel aus. Aber vielleicht wird vergessen, wenn man so etwas ausspricht, Marx – und das hat er selbst ja immer wieder betont – hatte so viele Vorbilder. Historiker, Ökonomen haben ihn alle stark beeinflusst.
Christian Lindner: Sicher, ein großer Denker, Gelehrter, wirkmächtig und insofern eine historische Größe und Figur. Bei der Beschreibung der Gegenwart und Zukunft würde ich mich aber eher an Popper und Dahrendorf orientieren wollen.
Deutschlandfunk Kultur: Weil sie den revolutionären Gedanken entgegenwirkt?
Christian Lindner: Die freie Presse zumindest stellen sie infrage, den Dominanzanspruch, oder würde den Dominanzanspruch einer Partei infrage stellen, einer politischen Grundrichtung usw. usf. Freiheit ist kein Spartenprogramm. Das kann es nur ganz oder gar nicht geben.
Deutschlandfunk Kultur: Ganz zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch, mit der Bitte um eine kurze Kommentierung, einen Satz von Gregor Gysi zitieren: "Karl Marx war einer der größten Historiker und Ökonomen nicht nur unseres Landes, sondern in der Geschichte." – Egal, wo man politisch verortet ist, kann man das heute noch so stehenlassen?
Urs Marti-Brander: Mich würde das jetzt nicht stören. Es sagt nur nicht sehr viel aus. Aber vielleicht wird vergessen, wenn man so etwas ausspricht, Marx – und das hat er selbst ja immer wieder betont – hatte so viele Vorbilder. Historiker, Ökonomen haben ihn alle stark beeinflusst.
Christian Lindner: Sicher, ein großer Denker, Gelehrter, wirkmächtig und insofern eine historische Größe und Figur. Bei der Beschreibung der Gegenwart und Zukunft würde ich mich aber eher an Popper und Dahrendorf orientieren wollen.
Deutschlandfunk Kultur: Vielen Dank für ein Gespräch, das sehr schnell vorbei gegangen ist.
Urs Marti-Brander: Vielen Dank.
Christian Lindner: Danke Ihnen.