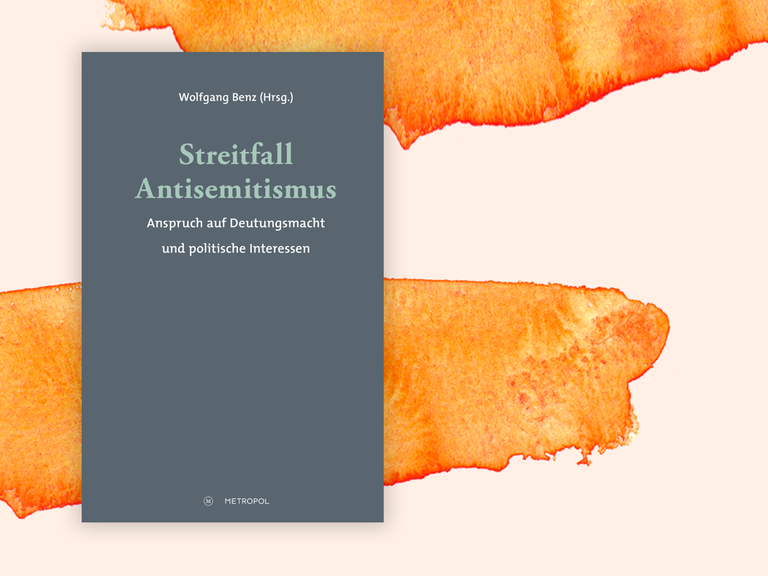„Der Historiker ist nicht dazu da, Geschichten zu erzählen“
34:15 Minuten

Moderation: Ulrike Timm · 04.06.2021
Ursprünglich wollte Wolfgang Benz Journalist werden. Doch erfreulicherweise ist der Historiker auf dem Weg in die Medienwelt in der Wissenschaft hängen geblieben. Heute gilt er als einer der wichtigsten Forscher des Antisemitismus.
Aus den sozialen Medien hält sich Wolfgang Benz fern. Das habe "ungeheure Vorteile", sagt der Historiker. Denn einen Großteil der Anfeindungen, denen er als Antisemitismusforscher ausgesetzt ist, bekommt er so nicht zu Gesicht. Der Rest der "Bosheiten und Unanständigkeiten" erreichen ihn altmodisch auf postalischem Weg: "Zu mir kommen die Schmähungen ganz klassisch."
Würdigungen zum Geburtstag – auch in den sozialen Medien
Wären nicht gute Freunde, die ihn mit entsprechenden Informationen versorgten, würde Wolfgang Benz womöglich sogar die Würdigungen verpassen, die ihm auch in "den sogenannten Neuen Medien" anlässlich seines 80. Geburtstags am 9. Juni zuteilwerden.
Der Historiker mit seiner gut fünf Jahrzehnte währenden Karriere gilt als einer der renommiertesten Vorurteilsforscher des Landes und hat 20 Jahre das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin geleitet.
"Das war das Mekka"
Dabei wollte Wolfgang Benz, geboren 1941 und aufgewachsen in konservativem Elternhaus in Baden-Württemberg, eigentlich Journalist werden – entgegen dem Willen des ultrakatholischen Vaters. Mit einem Studium der Geschichte, ergänzt durch Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und ein wenig Philosophie, scheint die befürchtete "verkrachte Existenz" programmiert, bis "im fünften Semester die Weichen auf Wissenschaft" gestellt werden.
Im Institut für Zeitgeschichte in München erhält Wolfgang Benz, der sich schon damals vor allem für die "Geschichte der Mitlebenden" interessiert, eine Stelle als Hilfswissenschaftler: "Das war das Mekka. Da wollte ich hin. Das hat alles verändert."
Zeithistoriker – ein Job für’s Grobe
Zeitgeschichte – das heißt Anfang der 60er-Jahre vor allem die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Das Fach, ebenso wie Benz‘ neue Wirkungsstätte in München, ist in dieser Zeit noch dabei, sich zu etablieren. Schiefe Blicke von Kollegen aus anderen Bereichen sind keine Seltenheit. "Die Zeitgeschichtler waren da, um den Schutt wegzukehren, das Grobe zu erledigen."
In den folgenden Jahrzehnten untersucht Wolfgang Benz die Mechanismen, die am Ende zum Holocaust führten. Er forscht in KZ-Gedenkstätten, sucht mit seinen Erkenntnissen die Öffentlichkeit und betrachtet in seiner Arbeit immer wieder persönliche Schicksale.
Als er 1990 mit seiner Familie ins frisch vereinte Berlin zieht und die Leitung des Zentrums für Antisemitismusforschung übernimmt, erweitert er nach und nach seine Forschung auch auf Ausgrenzungsmechanismen gegen andere Minderheiten – Roma, Homosexuelle, Muslime.
"Das ist der alte Antisemitismus"
Sein Ansatz, islamfeindliche Ausgrenzungsmechanismen der Gegenwart mit der Ausgrenzung gegen Jüdinnen und Juden zu vergleichen, hat ihm viel Kritik eingebracht und schlägt sich auch in Schmähungen gegen seine Person nieder. Dabei habe er keineswegs Muslime und Juden verglichen, betont er. Oder den Holocaust relativiert, wie ihm wiederholt vorgeworfen wurde.
Einen neuen oder wachsenden Antisemitismus kann Wolfgang Benz hierzulande nicht erkennen. "Das ist der alte Antisemitismus." Er werde nur "immer wieder aufs Neue erfunden".
Vorurteile werde es immer geben
Vorurteile, so die Bilanz des Wissenschaftlers, lassen sich nicht ausrotten, man könne sie nur bekämpfen. "Man kann immer nur versuchen, die Mehrheit, die nicht infiziert ist, so groß zu halten und so zu stärken, dass es nicht überspringt." Zuletzt erschien sein Buch "Vom Vorurteil zur Gewalt. Politische und soziale Feindbilder in Geschichte und Gegenwart".
Ob er denke, dass die Menschen etwas aus der Geschichte lernen könnten? "Die Hoffnung muss ich ja haben!" Der Historiker sei schließlich "nicht dazu da, Geschichten zu erzählen. Der Zweck besteht darin, dass er an einer besseren Gesellschaft mitarbeitet."
"Wenn ich die Hoffnung aufgeben würde, wäre alles fehlgeschlagen. Dann wäre ich vollkommen gescheitert." Und das sei ein Offenbarungseid, den man am Vorabend des 80. Geburtstag nun wirklich nicht haben wolle.
(era)