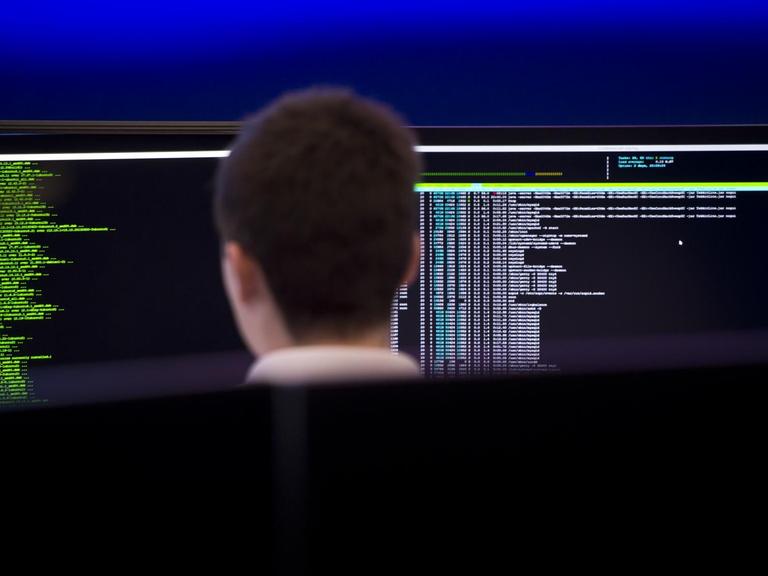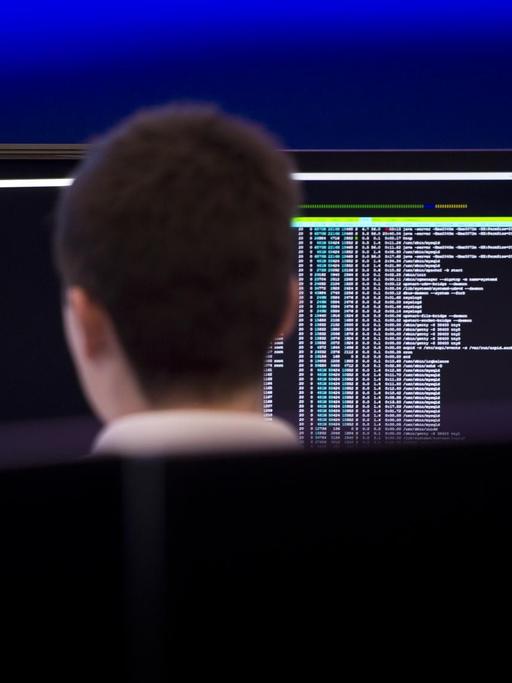Dark Posts zersetzen die Öffentlichkeit

Von David Lauer · 10.09.2017
Zum Wahlkampf haben Politiker die sogenannten Dark Posts auf Facebook entdeckt. Das sind Botschaften, die nicht auf der Profilseite des Absenders erscheinen, sondern nur auf der Empfängerseite. Dark Posts seien deshalb ein zwielichtiges Werkzeug, kommentiert David Lauer.
Die dunkle Seite der sozialen Netzwerke hat Einzug gehalten in den deutschen Wahlkampf. Parteien und Politiker haben das Instrument der Dark Posts entdeckt, mit dem maßgeschneiderte politische Botschaften ausgesuchten Nutzergruppen exklusiv zugespielt werden können. Na und, könnte man nun meinen. Sind nicht immer schon unterschiedliche Wählergruppen mit unterschiedlichen Inhalten umworben worden? Auch die Bundeskanzlerin wird vor dem Arbeitgeber-Gesamtverband eine andere Rede halten als auf einem Gewerkschaftskongress.
Aber nicht gegen die Diversifizierung der Inhalte sind Bedenken geboten, sondern gegen die Form ihrer Kommunikation. Zwei Eigenheiten machen Dark Posts zu einem zwielichtigen Werkzeug. Erstens verstecken sie sich vor Außenstehenden: Ein Dark Post erscheint nicht auf der Profilseite des Absenders. So wissen allein seine Empfänger, dass es ihn überhaupt gegeben hat. Zweitens tarnt sich ein Dark Post für seine Adressaten, weil er nicht unmittelbar als solcher erkennbar ist. Er gibt sich als gewöhnliche öffentliche Kommunikation aus – ist es aber nicht. Und das unterscheidet Dark Posts von politischer Kommunikation der alten Schule.
Politik geht uns alle an
Denn auch wenn die Bundeskanzlerin eine Rede vor exklusivem Publikum hält, so verheimlicht sie doch nicht, eine solche Rede gehalten zu haben, deren Inhalte zudem in der Regel medial verbreitet werden. Zweitens wissen die Zuhörer der Rede voneinander, dass sie die Rede gehört haben. Sie nehmen nicht nur die Botschaft, sondern auch einander wechselseitig als solche wahr, die dieselbe Botschaft hören und in der Folge darüber diskutieren können.
Genau diese zwei Elemente werden durch Dark Posts gezielt ausgehebelt. Und das ist nichts anderes als die bewusste Umgehung eines Prinzips, das für demokratische Meinungs- und Willensbildung konstitutiv ist: Öffentlichkeit. Vor einem halben Jahrhundert hat Jürgen Habermas in Strukturwandel der Öffentlichkeit die prinzipielle Offenheit des Zugangs zur politischen Debatte als wesentliches Element der Demokratie herausgestellt. Politik ist das, was alle angeht. Was alle angeht, darüber müssen alle diskutieren können. Dazu aber müssen alle darüber Konto führen können, wer in der Debatte was zu wem gesagt hat. Was Frau Merkel im Urlaub mit ihrem Gatten bespricht, muss niemand wissen. Was sie ihren politischen Anhängern in Aussicht stellt, müssen alle wissen können.
Ein gefährliches Spiel
Diesen für moderne Gesellschaften konstitutiven Gegensatz zwischen Öffentlichem und Privatem verletzen Dark Posts systematisch – und versuchen zugleich, dies zu verschleiern. Damit sind sie ein Musterbeispiel für das, was in Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns als verdeckt strategisches Handeln bezeichnet wird: ein Handeln, das nur funktioniert, weil einige der Handlungspartner absichtlich im Unklaren darüber gelassen werden, was vor sich geht.
Im Fall der Dark Posts sollen sie glauben, sie seien gemeinsame Rezipienten eines öffentlichen politischen Angebots, während in Wahrheit jedem von ihnen in verdunkelten Séparées je unterschiedliche Bückware ins Ohr geflüstert wird. Ein gefährliches Spiel, denn nur solange diese Illusion unentdeckt bleibt, kann die verdeckt strategische Handlung ihre Wirkung erzielen. Wird sie enttarnt, verliert die Botschaft jede Glaubwürdigkeit. Wenn mein Gegenüber ernst meint, was er sagt, wieso sagt er es dann nicht laut? Öffentlichkeit zersetzt die Wirkung von Dark Posts. Und umgekehrt: Dark Posts als Mittel der politischen Kommunikation zersetzen Öffentlichkeit – und damit die Bedingung der Möglichkeit demokratischer Politik.