Zustandsskizzen aus der Pandemie
07:02 Minuten
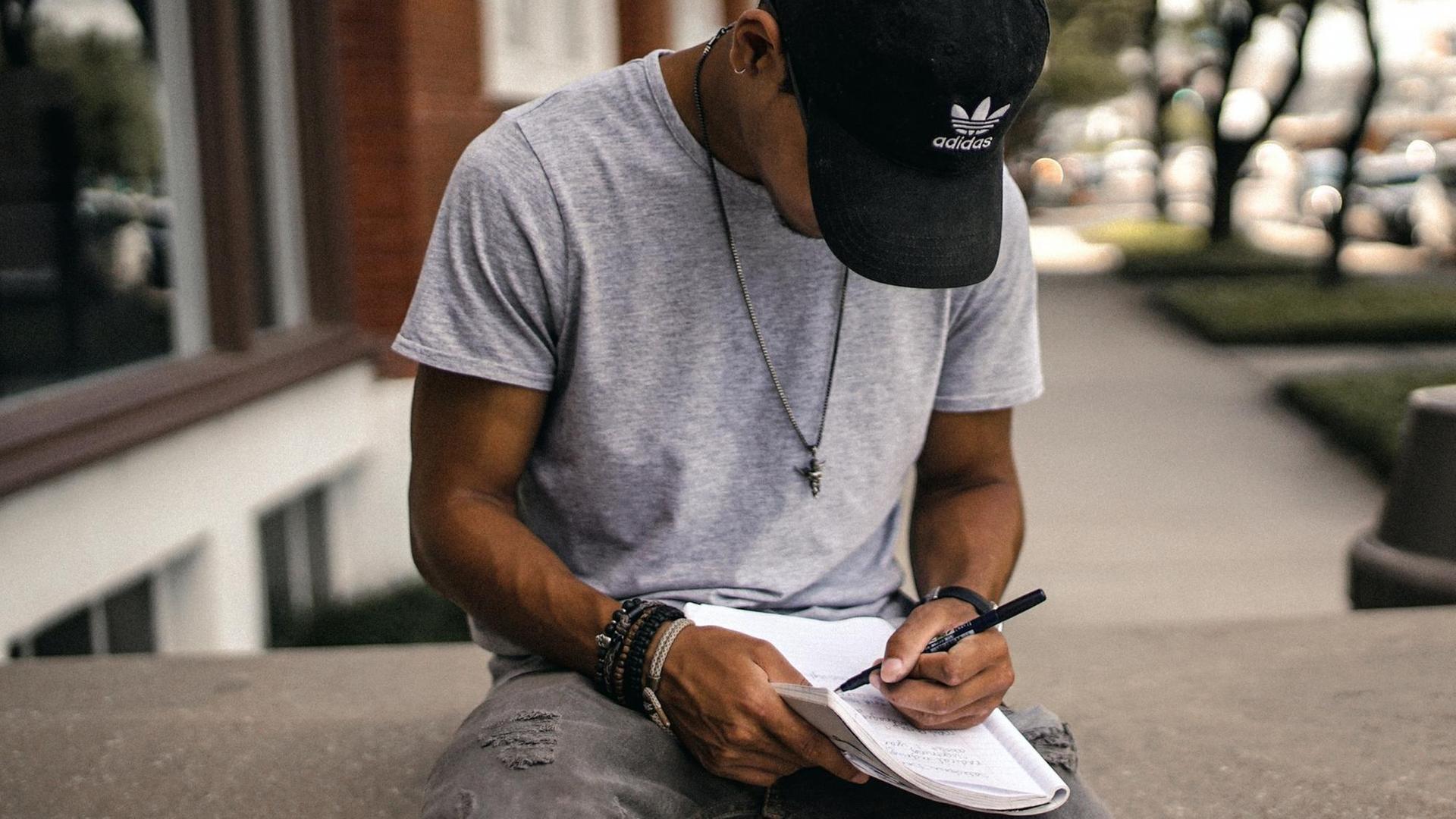
Von Katja Ridderbusch · 03.06.2021
Isolation, Angst, Dankbarkeit, Schuld: Ein US-Forschungsprojekt untersucht Berichte aus dem Alltag der Menschen in der Coronakrise. Dass Schreiben den Teilnehmern hilft, den Stress des Ausnahmezustands zu verarbeiten, ist ein positiver Nebeneffekt.
Die Pandemie habe die Menschen voneinander getrennt, sagt ein Mann. Jeder lebe in seiner Blase, viele fühlten sich allein und verwundbar.
Das ist ein Beitrag aus dem Pandemic Journaling Project – ein Forschungsprojekt an der Universität von Connecticut, das die Anthropologin Sarah Willen gemeinsam mit ihrer Kollegin Katherine Mason von der Brown University ins Leben gerufen hat. Die Idee: Alltagserfahrungen aus der Pandemie in einem digitalen Logbuch zusammenzutragen.
"Das Projekt gibt den Menschen die Möglichkeit, ihre Gedanken festzuhalten", sagt Willen – für sich und ihre Familien. Und gleichzeitig könnten künftige Forschergenerationen Einblicke gewinnen in das Leben währen der Coronakrise. "Jeder Eintrag – ob als Text, Audio oder Foto – ist ein Beitrag zum historischen Archiv."
Herausgekommen ist eine Collage von Zustandsskizzen in Zeiten der Pandemie. Seit Mai vergangenen Jahres haben die Forscherinnen 12.000 Einträge aus 45 Ländern gesammelt. Bis heute gibt es mehr als 1.400 Teilnehmer.
Tagebuchschreiben im Ausnahmezustand hilft
Ein Nebeneffekt des Projekts: Es könne Menschen helfen, den Stress des permanenten Ausnahmezustands zu bewältigen, sagt Andrea Horn. Sie ist Dozentin für Psychologie an der Universität Zürich und widmet sich den therapeutischen Aspekten des Tagebuchschreibens.
Wenn man beim Aufschreiben Worte für das eigene Erleben finde, dann sei das schon ein Wirkmechanismus, betont Horn. "Wir haben dann die Möglichkeit, unser inneres Erleben in Kontext zu setzen und besser zu verstehen oder auch auf Erfahrungen zurückzugreifen, wie wir ähnliche Situationen früher geschafft haben."
Doch das Schreiben selbst sei nur der erste Schritt, um schwierige Erlebnisse zu verarbeiten. Ebenso wichtig sei für viele Menschen, das Erlebte zu teilen, setzt die Psychologin hinzu. "Neben dem inneren Ordnen und dem inneren Formen von Geschichten erfüllt dieses Teilen von Geschichten ein menschliches Grundbedürfnis des Nicht-Alleine-Seins in der Krise."
"Eine Mischung aus Dankbarkeit und Schuld"
Auch Sarah Willen hat festgestellt: Viele, die bei ihrem Projekt mitmachen, finden in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten Trost – und kreative Ausdrucksformen. So nahm eine junge Frau ein Lied auf, in dem sie davon singt, wie sehr sie sich nach ihrem alten Leben zurücksehnt.
Die Auswirkungen der Pandemie auf den Alltag der Projektteilnehmer seien ganz unterschiedlich, sagt Willen – je nach Alter, Lebensphase oder wirtschaftlicher Situation. Auffällig dabei: In vielen Einträgen spiegele sich eine Mischung aus Dankbarkeit und Schuld. "Es gibt eine Dankbarkeit, ein Dach über dem Kopf zu haben, ein Auskommen und Menschen im eigenen Umfeld, die man umarmen kann. Und gleichzeitig Schuldgefühle gegenüber denen, die all das nicht haben."
Interessant sei, dass diese Gefühle nicht nur bei den vermeintlich Privilegierten auftreten, sagt Willen, "sondern auch in sozial schwächeren Gruppen, die stärker unter den Folgen der Pandemie leiden, wie etwa Schwarze und Latinos".
Das Schreiben in der Corona-Pandemie verbindet sich mit einem weiteren Trend: dem Wunsch, sich in der eigenen Familien- und Lebensgeschichte zu verankern. "Unsere Identität konstituiert sich aus der Geschichte, die wir konstruieren", sagt Andrea Horn. In den Momenten, in denen das Selbsterleben herausgefordert werde, wie in einer weltweiten Krise, gebe es noch stärker das Bedürfnis, Ordnung zu finden, einen Bogen zu schlagen, mit "Anfang, Mittelteil und Ende".
Die Pandemie schafft Zeit und Raum für Erinnerungen
So ist es auch kein Zufall, dass die Nachfrage bei Ahnenforschungsdiensten wie Ancestry im vergangenen Jahr gestiegen ist. Die Deutsch-Amerikanerin Linda Tietje hat sich das zunutze gemacht. Sie gründete im Sommer 2020 das Startup Storyna – eine Online-Plattform, die Menschen bei der Niederschrift ihrer Lebensgeschichte begleitet.
Die Idee für das Projekt kam Tietje, als sie selbst erkrankte, vermutlich an Covid. "Da wurde das Thema für mich sehr aktuell und sehr dringlich", sagt sie. Sie selbst hat zwei Kinder, "und ich dachte, wenn mir mal etwas passiert, wäre es mir am wichtigsten, neben dem Finanziellen, dass meine Kinder meine Gedanken und meine Perspektive nicht verlieren".
Die Pandemie habe ihrem Start-up einen zusätzlichen Schub gegeben. Die meisten ihrer Kunden sind Frauen, die den Eltern oder Großeltern einen Gutschein schenken. Storyna habe sicherlich vielen Menschen dabei geholfen, "in dieser Zeit eine sinnvolle Aufgabe zu finden, die einen aus dem Heute rauszieht und an schöne Zeiten erinnert".
Der Weg zurück in die Normalität – eine Herausforderung
Für viele ihrer Kunden sei die Motivation auch gewesen, "gerade in der Pandemie die Verbindung mit den Eltern aufrechtzuerhalten, mehr über sie zu lernen", sagt Tietje. Weil einem bewusster werde, "dass man vielleicht nicht ewig Zeit hat, bestimmte Fragen zu fragen, bestimmte Unterhaltungen zu führen".
Anthropologin Sarah Willen erwartet, dass das Bedürfnis, den eigenen Alltag zu dokumentieren, noch eine Weile anhalten wird. Denn auch der Weg zurück in die Normalität stelle viele vor ganz eigene Herausforderungen, wie die Einträge im digitalen Pandemiejournal zeigen.
So wie eine Frau, die sich überwältigt fühlt. Davon, dass sich so vieles so plötzlich ändert: das Ende von Maskenpflicht, Versammlungsverboten und Abstandsregeln in vielen amerikanischen Bundesstaaten etwa. Und überwältigt von der Angst, dass die Pandemie noch einmal zurückschlägt.




