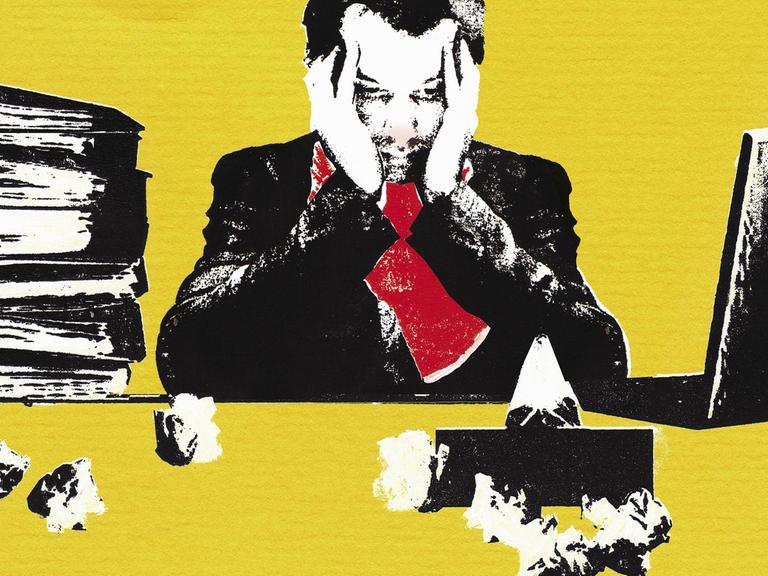Neue Wege zur Behandlung von Migräne
08:22 Minuten

Tim Jürgens im Gespräch mit Dieter Kassel · 21.10.2020
Bis heute halten sich Vorurteile gegenüber Migräne-Patienten. Dabei handele es sich um eine schwere und komplexe Erkrankung, sagt Tim Jürgens. Laut dem Facharzt gibt es Hoffnung, dass Kranke künftig individueller und besser versorgt werden können.
Dieter Kassel: Eigentlich sollte der deutsche Schmerzkongress in Mannheim tatsächlich stattfinden - als eine Mischung aus Präsenzveranstaltungen und virtuellen Diskussionen und Vorträgen. Das geht nun nicht mehr, auch in Mannheim ist die Inzidenz auf über 50 gestiegen, und das Ganze wird nun eine rein virtuelle Veranstaltung, an der Tim Jürgens teilnimmt. Er ist der Präsident der Deutschen Migräne- und Kopfschmerz-Gesellschaft und Leiter des Kopfschmerzzentrums der Universitätsmedizin an der Uni Rostock. Wenn man sagt, Migräne, sagen die, die das selber noch nie hatten, das sind halt starke Kopfschmerzen, und manche Leute kommen nicht gut damit zurecht. Das Vorurteil kennen Sie vermutlich?
Tim Jürgens: Ja, das ist nicht ganz neu. Wenn Sie zum Beispiel Erich Kästner lesen, der seine Bücher in den 20er-, 30er-Jahren geschrieben hat, dann taucht dort die Mutter von Pünktchen als die etwas hysterisch anmutende Fabrikantenehefrau auf, die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hat, als einzukaufen und dann unter ihren Kopfschmerzen leidet. Die Tochter sagt, Migräne sind Kopfschmerzen, wenn man eigentlich gar keine hat. Das ist ein altes Vorurteil, das die Migräne in den Kontext einer neurasthenen, wie man früher gesagt hätte, Erkrankung stellt. Ein Bild, was wir glücklicherweise überwunden haben.
Schwere neurologische Erkrankung
Seit den 50er-Jahren gibt es Hinweise darauf, dass die Migräne tatsächlich eine neurologische Erkrankung ist. Erst hat man gedacht, dass es mit dem Durchmesser der Gefäße zusammenhängt, dass also während der Migräneattacke sich Gefäße im Kopf schmerzhaft erweitern. Das ist ja schon ein erster biologischer Ansatz. Dann musste man entdecken, dass das zwar auftritt, diese Gefäßerweiterung, dass die aber vermutlich gar nicht ursächlich dafür ist. Heute wissen wir, dass die Migräne letztlich eine Dysfunktion des Nervensystems ist und da viele verschiedene komplexe Mechanismen zusammengreifen.
Neulich hat ein Kollege einen Artikel geschrieben, einen Übersichtsartikel, auf über 70 Seiten sehr kondensiert, und versucht, die Pathophysiologie der Migräne zu beschreiben. Er hat es aber letztlich auch nicht geschafft. An vielen Stellen muss er immer noch sagen, dass das im Detail noch nicht verstanden ist.
Um es zusammenzufassen: Wir haben eine ganz komplexe Biologie, die dem Ganzen unterliegt, sodass man heute sagen kann, es ist eine komplexe neurologische Erkrankung. Und es ist absolut nicht gerechtfertigt, die Migräne in diesem Kontext des etwas nervösen, ja simulierenden Patienten zu stellen.
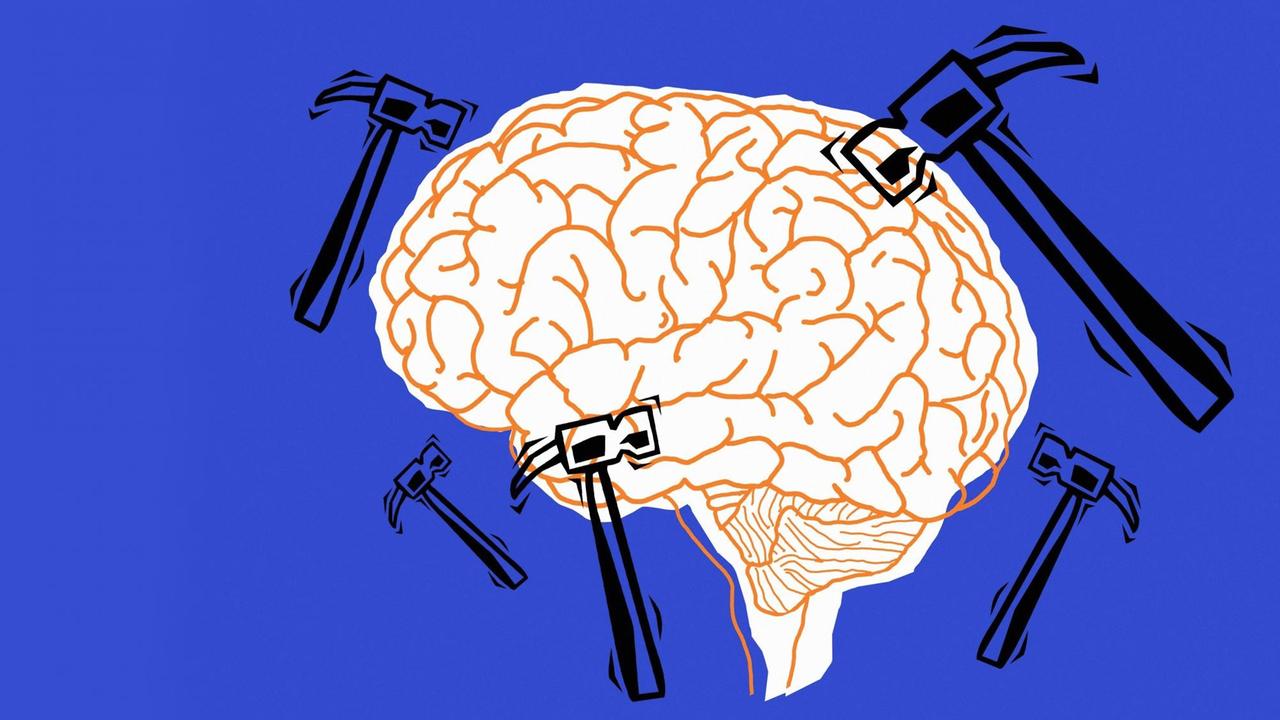
Migräne ist eine komplexe neurologische Erkrankung - und schwer zu behandeln.© imago images / Science Photo Library / Victor Habbick
Kassel: Sie sind ja selber Neurologe, was Sie beim Deutschen Schmerzkongress vorhaben, ist, eine neue mögliche Behandlungsmethode vorzustellen. Im Programm wurde das relativ spektakulär angekündigt. Könnte das wirklich der Durchbruch sein?
Jürgens: Ich glaube, der Weg ist ganz entscheidend. Wir stehen noch ganz am Anfang, aber ich glaube, wir müssen unseren Fokus heute schon auf die Dinge legen, die wir in fünf Jahren oder so im Alltag machen möchten. Insofern war das ein bisschen auch ein impulsgebendes Thema.
Die Daten reichen heute noch nicht dazu aus, dass wir unsere Therapie nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten ausrichten können. Die Migräne ist auch ein klinisch furchtbar komplexes Bild, sie sieht bei jedem etwas anders aus. Weshalb auch die Patienten häufig Schwierigkeiten haben, innerhalb einer Familie bei Mutter, Tochter und Tante eine Migräne selber zu diagnostizieren, weil es bei jedem etwas anders aussieht. Und jeder ist überzeugt: Eine Migräne hat der andere aber nicht.
Das ist sicherlich zum Teil darin auch begründet, dass wir heute wissen, dass wir einen polygenetischen Erbgang haben. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Gene, die in diesen Krankheitsmechanismus mit reinspielen und die zum Teil auch dieses klinisch bunte Bild erklären können. Das ist sicherlich auch ein Ansatz oder eine Erklärung dafür, dass man - bei der Wahl eines Therapeutikums - eben nicht jedem dasselbe Medikament geben kann.
Wir haben bei den vorbeugenden Medikamenten, die wir heute verwenden, Wartezeiten von zwei bis drei Monaten, die nach dem Beginn der Therapie eingehalten werden müssen, bis man sicher sagen kann, ob das Medikament anspricht oder nicht. Wenn dann jemand zwei, drei Medikamente durchprobiert und darauf nicht anspricht, hat man schon ein Dreivierteljahr verloren, bevor der Patient überhaupt eine vernünftige Linderung seiner Kopfschmerzen hat.
Da ist der Ansatz, dass wir einen Impuls geben und sagen wollen, lasst uns die Forschung in diese Richtung lenken. Das wäre für Patienten ein wirklicher Durchbruch, wenn wir es schaffen könnten, Faktoren zu identifizieren, die zu einem Ansprechen eines speziellen Medikamentes bei einem speziellen Patiententyp führen würden. Damit könnten wir den Patienten ganz massiv helfen.
Das ist ein bisschen ein Trend, der auch in anderen Bereichen gilt. Wir sehen das auch in der Krebsmedizin beispielsweise. Da ist es schon fortgeschrittener, wo man immer mehr davon weggeht, dass man sagt, ich behandle einen Tumor. Sondern ich behandle eine spezielle Eigenschaft des Tumors, dass er da irgendeinen Rezeptor zum Beispiel ausdrückt an seiner Oberfläche, und dass man dann eben die Therapie auf diesen Rezeptor abstellt, unabhängig davon, ob es jetzt Darmkrebs oder Magenkrebs ist.
Der Patient im Mittelpunkt der Behandlung
Kassel: Verstehe ich Sie da richtig, dass man quasi in fünf Jahren oder wann auch immer, wenn das wirklich anwendbar ist im Alltag, zuerst gucken würde, was genau für eine Migräne und was für mögliche Ursachen habe ich bei diesem einen Patienten, und dann wird spezifisch eine Art Medikation und Behandlung entwickelt.
Jürgens: Entwickelt vielleicht nicht, sondern man würde dann in sein Repertoire greifen und sagen, für diesen Patient ist sehr wahrscheinlich Medikament A, B oder C sinnvoll und erwartungsgemäß so, dass er auch darauf ansprechen wird, und deswegen fangen wir mit diesem Medikament bei dem Patienten an.
Kassel: Ich stelle jetzt eine Frage aus der beliebten Reihe "Ich wäre darauf alleine gar nicht gekommen". Allerdings glaube ich, Sie haben tatsächlich schon ganz frische, allererste Erkenntnisse dazu. Gibt es eigentlich einen Zusammenhang, irgendeinen Einfluss der Corona-Pandemie auf Migräne?
Jürgens: Am Anfang haben wir das nicht so richtig geglaubt. Das lag aber anscheinend auch mit daran, dass wir in Deutschland wenig Fälle hatten. Das, was uns mit Covid und Kopfschmerz beschäftigt hat, war im Wesentlichen die Gefahr einer Unterversorgung von unseren Patienten. Weil insbesondere auch in den spezialisierten Bereichen an den Unis die Ambulanzen zugemacht wurden, um sich auf die wirklich schwer kranken Covidpatienten zu konzentrieren, die dann anders als beispielsweise in Italien oder Spanien in der Masse gar nicht kamen.
Erste Erkenntnisse über Covid-19 und Migräne
So ist es nicht verwunderlich, dass diese Daten zu Covid und Kopfschmerzen im Wesentlichen aus dem europäischen Ausland und aus Amerika kamen. Eine Kollegin hat das ganz schön zusammengefasst. Sie hat einen Artikel geschrieben, der heißt "Covid-19 is a real headache" (Covid-19 ist ein echter Kopfschmerz). Sie berichtet, dass Kopfschmerz ein relevanter Bestandteil der Covid-Symptomatik sein kann, aber einem dann eben auch Kopfzerbrechen bereiten kann, weil er so schwer zu behandeln ist.
Die Daten deuten darauf hin, dass tatsächlich neben dieser mangelnden Versorgung durch das Schließen von Strukturen diejenigen, die dann Covid haben, tatsächlich auch sehr häufig an Kopfschmerzen leiden. Das ist bis zu ein Drittel der Patienten. Es scheint so zu sein, dass diejenigen, die eine Migräne in der Vorgeschichte haben, dann eher einen migräneartigen Typ haben, während andere eher einen etwas unspezifischeren Kopfschmerz haben, der an Spannungskopfschmerz erinnert, und dann aber auch dieser Kopfschmerz sehr schwer zu behandeln ist mit herkömmlichen Schmerzmitteln.
Andere Kollegen konnten aber dann auch zeigen, dass diejenigen, die eine Migräne haben oder einen migräneartigen Kopfschmerz relativ früh im Krankheitsverlauf, dass die dann tendenziell einen etwas günstigeren Krankheitsverlauf bei Covid-19 haben. Dass der Kopfschmerz zwar nervtötend ist, weil man ihn schwer behandeln kann, dass er aber prognostisch ein günstiger Faktor ist.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.