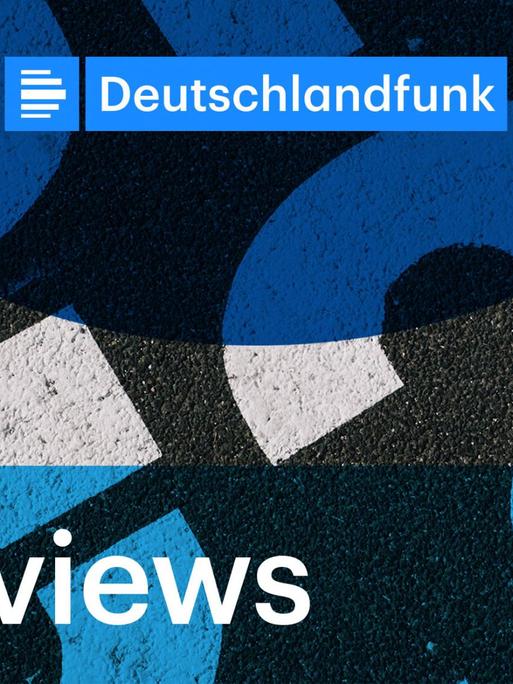Madagaskar hofft auf Tourismus und Demokratie

Von Jan-Philippe Schlüter · 21.09.2015
Landschaftlich hat Madagaskar mit seinen dichten Regenwäldern und weißen Sandstränden Spektakuläres zu bieten. Allerdings gehört es gleichzeitig zu den unterentwickeltsten Ländern der Welt. Die vor einem Jahr gewählte Regierung gilt als Hoffnungsträger - zurecht?
"La Grande Île", "die große Insel", nennen die Madagassen ihre Heimat. Ein bisschen Stolz schwingt da mit; zu Recht. Denn Madagaskar ist die viertgrößte Insel der Welt. So groß wie Deutschland und Großbritannien zusammen.
Besonders in den entlegenen Gebieten leben die Madagassen unter Bedingungen, die man bestenfalls im Mittelalter erwartet hätte – aber nicht im Jahr 2015. Und wenige 100 Meter entfernt liegen Touristen entspannt mit einem Drink am türkisblauen Meer.
"Wenn man sich anschaut, dass die Hälfte davon Kinder sind. Dass die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren jetzt schon chronisch mangelernährt ist, dass nur ein Drittel der Kinder, die zur Schule gehen, die Grundschule auch fertig machen – das sind alles Faktoren, die langfristig für dieses Land ein großes Problem darstellen werden."
"Der Staat ignoriert uns doch. Er hilft uns überhaupt nicht."
"Am Anfang dachte ich: Oh ja, hier kann man etwas machen, wenn man denen das beibringt. Aber inzwischen ist es sehr frustrierend für mich und natürlich für mich selber eine Erfahrung, dass hätte ich nicht gedacht, dass ich das aushalte. Dass ich nicht einen Schreikrampf kriege oder so."
"Ich verstehe die Hoffnung, alles ließe sich mit einem Zauberstab lösen. Ich verstehe, dass wenn die Menschen heute Hunger haben, sie auch heute essen wollen. Aber wir müssen auch deutlich machen: Ein Land lässt sich nicht an einem Tag erbauen."
"Ich bin optimistisch, denn die Zukunft wird kommen. Sie wird modern und globalisiert sein. Wir haben gar keine andere Wahl! Aber ich denke die nächsten fünf Jahre sind eine Übergangsphase. Und sie könnten schmutzig werden."
Viele haben kein fließendes Wasser zu Hause
Antananarivo, die Hauptstadt Madagaskars, die alle nur Tana nennen. Knapp zwei Millionen Menschen leben hier. Die Stadt liegt im zentralen Bergland der Insel, hat sich über sieben Hügel ausgebreitet.
Tana ist ein Schmelztiegel diverser Kulturen und Epochen. Zu Beginn ist man als Besucher verwirrt, weiß gar nicht so richtig, wo man sich befindet. In Afrika? Asien? Oder doch im Frankreich der 70er-Jahre? Für alles gibt es Anhaltspunkte:
Noro steht in der Schlange vor einem kleinen weiß-blau gestrichenen Kiosk aus Beton. Zu Füßen der zierlichen Frau stehen mehrere gelbe Kanister.
"Wir haben kein fließend Wasser zu Hause. Deshalb komme ich hierher und kaufe Wasser für meine Familie. Jeden Tag acht Kanister voll, insgesamt 160 Liter. Meine Wohnung ist fünf Minuten von hier entfernt. Ich muss einen Behälter nach dem anderen nach Hause tragen. Meine Tochter passt dann hier auf die anderen Kanister auf. Das nimmt viel Zeit in Anspruch und ist ziemlich nervig. Ich hätte wirklich gerne einen Wasseranschluss zu Hause, das würde vieles einfacher machen."
Im Kiosk steht Jean-Baptiste. Der Mann mit dem grauen Schlapphut ist der Herr über den Wasserhahn. Erst wenn der Kunde 50 Ariary, etwa 3 Cent bezahlt hat, fließt das Wasser in Plastikeimer und Kanister.
"Ich arbeite für ein privates Unternehmen, das Wasser von der Stadt kauft und an öffentlichen Plätzen weiterverkauft. Wir haben jeden Tag von 5:30 Uhr morgens bis 5:30 Uhr abends geöffnet. Hier ist immer etwas los, wir haben bis zu 500 Kunden am Tag. Oft stehen sie in langen Schlangen vor dem Kiosk und müssen warten."
Hunderttausende von Bewohnern in Tana sind auf die Wasserkioske angewiesen, so schlecht ist die Infrastruktur der öffentlichen Versorger. 50 Ariary, also 3 Cent klingt nicht nach viel. Aber wenn man wie Noro als Zimmermädchen gerade mal knapp 20 Euro im Monat verdient, wird Wasser schnell zum kostbaren Luxusgut. Immerhin: Noro hat einen Job, wohnt in einer richtigen Wohnung. Ein paar Kilometer von hier entfernt wären die Menschen froh, wenn sie so leben könnten.

Viele Kinder in Kenia, so wie in dem Slum Kibera in Nairobi, leiden unter Armut.© picture alliance / dpa / Carola Frentzen
Vor einer der Hütten steht Ademé in einer ausgebeulten gelben Jogging-Hose und blauem T-Shirt. Der hagere 32-Jährige ist von den Bewohnern zu einer Art Slum-Bürgermeister gewählt worden.
"Die Menschen hier leben im absoluten Elend. Eigentlich sind diese Hütten nicht bewohnbar. Wenn Regensaison ist, tritt der Fluss über und setzt alles unter Wasser. Die Stadt hat uns mehrmals hier vertrieben, aber wir haben nichts anderes. Früher hatte ich noch Arbeit. Aber als ich die verloren habe, musste ich zusehen, wie ich meine Familie durchbringe. Wir haben uns im Elend eingerichtet. Dabei wünschen wir uns wirklich ein würdevolleres Leben. Vor allem für unsere Kinder."
Ademé und seine Frau haben acht Kinder – zwischen zwei und zwölf Jahren. Keines geht zur Schule, dafür ist kein Geld da. Die Eltern kochen in ihrer Hütte Reis, Blutwurst und Gemüse und bieten das Essen für ein paar Cent an. Einer der Söhne sitzt auf dem Boden vor der Hütte im Dreck und bastelt aus Holz, alten CDs, Glühbirnen und Stromkabeln kleine Lampen, die er für zehn Cent verkauft. Seine Schwester Hélene ist ein hübsches, aufgewecktes Mädchen, mit wachen, intelligenten Augen. Auch die 12-Jährige muss helfen, damit die Familie den Alltag überlebt.
"Ich würde gerne zur Schule gehen, aber es geht nicht. Dafür ist kein Geld da. Manchmal haben wir nicht einmal genug zu Essen. Gerade habe ich die Wäsche gemacht. Jetzt kümmere ich mich um meine kleinen Geschwister."
Ein normales, würdevolles Leben ohne Elend scheint für Hélene kaum erreichbar. Und so druckst sie kichernd vor sich hin, als sie erzählt, was ihr Traum ist: Sie wäre gerne Nonne, um sich um Waisenkinder zu kümmern:
"Also ich denke, es gibt in Bezug auf Ernährung wirklich zwei Phänomene. Das eine ist mit Armut verbunden, ein Problem von mangelnder Ernährung im Sinne von nicht genügend Ernährung. Es gibt auch regelmäßig Phänomene wie Hungersnöte. Es gibt aber auch ein oft unerkanntes Problem: Fast die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren ist chronisch mangelernährt. Sie essen zwar, aber sie bekommen nicht die richtige nahrreiche Ernährung, um sich richtig entwickeln zu können. Und das hat tatsächlich schwerwiegende Folgen für die Entwicklung, auch für die Lernfähigkeiten in der Schule und hat dementsprechend langfristig eine große Auswirkung."
Nur zwei von drei Kindern gehen überhaupt in die Grundschule. 1,5 Millionen Kinder haben keinen gar keinen Zugang. In weiterführende Schulen schaffen es nur ein Viertel aller Kinder.

Eine Grundschule in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. © picture alliance / dpa / Foto: Mika Schmidt
Auch die hygienischen Verhältnisse sind für Millionen von Madagassen katastrophal.
"Wasser, Abwasserhygiene ist tatsächlich ein riesiges Problem. Statistisch gesehen im Verhältnis zu anderen Ländern in Afrika und auch global gesehen hat Madagaskar wirklich sehr schlechte Indikatoren. Die Tatsache, dass es so ein großes Problem gibt, hat aber dann wieder große Gesundheitsprobleme zur Folge, weil sehr viele Erkrankungen wie Durchfallerkrankungen usw. vermeidbar wären, wenn es diesen Zugang gäbe."
Die Situation vieler Kinder in Madagaskar ist fatal. Wenn man bedenkt, dass die Hälfte der Bevölkerung unter 18 Jahren alt ist, kann man sich in etwa ausmalen, was für ein Problem da heranwächst.
Ein Kaffee in der Hafenstadt Tulear ganz im Südwesten der Insel. Die Gegend ist bei Touristen beliebt, weil es hier wunderschöne Sandstrände am türkisfarbenen indischen Ozean gibt. Aber Dr. Regine Rossmann ist nicht zum Entspannen hier.
"Ich habe hier Sachen gesehen, wo ich nicht wusste, dass der Mensch das aushält. Als Schlimmstes habe ich einen Mann gesehen, der infolge einer Zahninfektion gestorben ist. Vor meinen Augen."
Regine Rossmann aus Berlin ist Ärztin und arbeitet seit mehreren Jahren für verschiedene Hilfsorganisationen in Entwicklungsländern. Mit Cap Anamur ist sie drei Autostunden südlich von hier im abgelegenen Bezaha stationiert. Mitten in der madagassischen Brousse – dem Busch.
"Das ist ein Krankenhaus, was in der Region schon eine zentrale Funktion hat, also mit Operationsmöglichkeit. Das Krankenhaus kriegt Patienten zugewiesen, von den 'CSBs', das sind ganz kleine ambulante Einheiten. Ziemlich weit in Orten drum herum. Der Haken ist meistens, dass die Wege und die mobilen Möglichkeiten viel zu schlecht sind, so dass die Leute viel zu spät kommen. Bei uns gibt es eigentlich einen Krankenwagen, der die Menschen abholen könnte. Der ist kaputt – seit vier Wochen. Darum kümmert sich niemand."
Es fehlt an Infrastruktur, Material und ausgebildetem Personal. Regine Rossmann sieht in ihrem Arbeitsalltag Dinge, die sie nicht für möglich gehalten hätte.
"Die schieben einen Blasenkatheter einfach rein – mit dreckigen Händen. Außerdem sind die Krankenhäuser hier so gebaut, dass man nicht davon ausgeht, dass hier ein Pfleger wie bei uns einen Patienten pflegt. Sondern ein Pfleger hier gibt nur die Medikamente und alles andere macht die Familie. Die Familie kocht vor der Tür und muss sogar die ganze OP-Wäsche waschen. Und wenn eine Frau entbindet, die aus dem Busch kommt und nur dreckige Tücher trägt und ziemlich stark nachblutet – das ist halt hygienisch eine Katastrophe. Am Anfang dachte ich noch: Ja, hier kann man etwas machen, wenn man denen das beibringt und so."
Aber mittlerweile ist sie vor allem frustriert. Denn obwohl die madagassische Regierung die Hilfe von Kap Anamur und anderen Hilfsorganisationen gerne annimmt, hat Regine Rossmann das Gefühl, dass viele der Entscheider in der Region nicht das Wohl der Patienten im Auge haben.
"Ich glaube, dass der Staat so korrupt ist. Ein Korrupter ist hier einfach so einer: 'Hach, ich bin schlau, ich weiß wie es geht. Wie ich zu Geld komme, ohne dass ich arbeiten muss.' Und da die oben eben auch korrupt sind, ist es gar nicht schlimm, wenn man unten auch korrupt ist."
90 Prozent der Wälder inzwischen abgeholzt
Morgengrauen im Mantadia-Nationalpark im madagassischen Hochland. Der schrille Gruß, mit dem die Indri-Lemuren den Tag beginnen, ist kilometerweit zu hören.
Ein paar Autostunden südlich: Touristenführer José wandert mit einer Besuchergruppe durch den immergrünen Regenwald des Ranomafana-Parks.
Zwölf Lemurenarten gibt es hier, von denen nur sieben tagsüber zu sehen sind. Darunter der berühmte goldene Bambuslemur, der erst vor 30 Jahren hier entdeckt worden ist.
Um die Tiere in den dichtbewachsenen Wipfeln zu entdecken, gehen Spurenleser mit auf die Tour. Sie können die Tiere durch ihre Rufe und den auf dem Boden liegenden Kot ziemlich zuverlässig finden.
Am Rand des Parks steht ein moderner Forschungskomplex – das Centre ValBio, mit spektakulärem Blick in die Schlucht des Ranomafana-Parks. Professor Jonah Ratsimbazafy forscht hier regelmäßig.
Vom Mausmaki, dem mit etwa 10 Zentimeter kleinsten Lemur bis zum 80 Zentimeter großen Indri mit dem flauschigen schwarz-weißen Fell und der lauten Stimme – der Lemurenexperte kennt sie alle. Und er macht sich große Sorgen um die seltenen Tiere.
"Wir haben momentan 105 Lemurenarten. Allerdings sind fast alle, nämlich 94 Prozent vom Aussterben bedroht. Die Lemuren leben nur auf Bäumen. So wie die Fische das Wasser zum Leben brauchen, brauchen die Lemuren die Bäume."
Das Problem ist: Inzwischen sind 90 Prozent der Wälder in Madagaskar abgeholzt worden. Sei es, weil Edelholz illegal gefällt und trotz Verbots exportiert wird. Sei es, weil arme Madagassen durch Brandrodung Wälder zerstören, um dort Reis und Gemüse anzupflanzen. Wer heute über die Insel fliegt, sieht überall Rauch von brennenden Bäumen aufsteigen.
"Die Lemuren leben schon seit 50 Millionen Jahren hier. Unsere menschlichen Vorfahren sind vor gerade mal 2000 Jahren auf die Insel gekommen."
Seitdem zerstört der Mensch Stück für Stück den Lebensraum der Lemuren. Dabei könnten die seltenen Tiere den Menschen hier sehr helfen: Mit der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt, so der Professor, könnte man doch viele Touristen anziehen, die Geld ins Land bringen.
Zu seinen Hochzeiten hat Madagaskar fast eine halbe Millionen Touristen im Jahr begrüßt. Jetzt ist es gerade mal ein Drittel davon. Die große politische Krise unter der illegalen Putschregierung hat Madagaskar auch von den Touristen isoliert. Und die neue Regierung hat noch zu wenig getan, um den Trend umzukehren, meint Hotelbesitzerin Hony Radert.
"Wir hatten ein bisschen ein Sicherheitsproblem seit der Krise, durch die weitverbreitete Armut. Aber ich denke das hat sich gebessert. Dann ist die Stromversorgung unzuverlässig. Wie sollen wir als Hotels überleben, wenn die nationale Stromgesellschaft ihre Arbeit nicht macht? Mein Eindruck ist, dass die Regierung momentan keine klaren Prioritäten setzt. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Denn der Tourismus könnte viel Gutes für Madagaskar tun."
Ungeduld gegenüber der Regierung wächst
In der Hauptstadt Tana richtet sich Herilanto Raveloharison in seinem braunen Ledersessel auf. Der mächtige Mann mit dem dichten schwarzen Bart ist seit der demokratischen Wahl vor eineinhalb Jahren Madagaskars Wirtschaftsminister. Er weiß, dass die Menschen langsam ungeduldig werden mit der nicht mehr ganz so neuen Regierung.
"Ich verstehe die Hoffnung, alles ließe sich mit einem Zauberstab lösen. Ich verstehe, dass wenn die Menschen heute Hunger haben, sie auch heute essen wollen. Aber wir müssen auch deutlich machen: Ein Land lässt sich nicht an einem Tag erbauen.
Aber Es ist nicht ganz richtig, dass sich seit dem Ende der großen Krise nichts getan hat. Wir haben Fortschritte bei der Infrastruktur gemacht. Bei unseren Sozialplänen oder im Bildungssystem. Es dauert einfach Zeit, bis wir die Auswirkungen bemerken. Es ist ein Wiederbelebungsplan, den wir hier haben. Nach einer so langen Krise müssen wir vor allem die Institutionen wieder herstellen, um eine gute Regierungsführung zu ermöglichen. Nur dann kommt auch die Wirtschaft wieder ans Laufen."
Nach den demokratischen Wahlen haben die internationalen Geberländer versprochen, das bitterarme Madagaskar wieder mit Geld zu unterstützen. Alleine die EU will in den nächsten fünf Jahren mehr als 500 Millionen Euro auf die Insel schicken. Etwa 20 Prozent davon steuert Deutschland bei. Voraussetzung allerdings ist ein nachvollziehbarer Nationaler Entwicklungsplan.
Und wenn es um den geht, hört man aus Diplomatenkreisen immer wieder eine gewisse Ungeduld mit der madagassischen Regierung. Zwar habe man Verständnis für die riesigen Probleme, die gelöst werden müssen. Aber viele haben den Eindruck, dass die Regierung die wichtigen Grundlagen nicht konsequent genug angeht. Immerhin scheint Präsident Hery Vaovao so langsam aufzuwachen: Ende Januar hat er einen neuen Ministerpräsidenten ernannt und acht Minister ausgetauscht. Die bisherigen hätten die Erwartungen nicht erfüllt, nun werde man einen Gang hochschalten. Was auf der einen Seite für ein Problembewusst sein spricht, zeigt auf der anderen Seite, dass im ersten Jahr nach den Wahlen viel zu wenig passiert ist.
"Die Politiker versprechen uns vieles. Aber bei der konkreten Umsetzung gibt es nichts! Dabei brauchen die Investoren genau dieses Konkrete. Wie genau wollen wir Dinge umsetzen? Welches sind die Prioritäten? Sie versprechen uns X neue Straßen, so und so viele Krankenhäuser, kostenlose Schulen, dieses und jenes. Aber wir können doch nicht alles sofort finanzieren. Leider muss man schwierige Entscheidungen treffen. Und man muss eine politische Philosophie haben. Wenn man versucht, alles zu tun, wird alles nur mittelmäßig oder schlecht umgesetzt."
Keine sehr positiven Aussichten für die geschundene "große Insel", die doch schon genug unter Mittelmaß und schlecht umgesetzten Plänen zu leiden hat. Aber auch Sahondra Rabenarivo ist nicht hoffnungslos. Sie sieht durchaus bessere Zeiten auf Madagskar zukommen.
"Ich bin optimistisch, denn die Zukunft wird kommen. Sie wird modern und globalisiert sein. Wir haben gar keine andere Wahl! Aber ich denke die nächsten fünf Jahre sind eine Übergangsphase. Und sie könnten schmutzig werden."