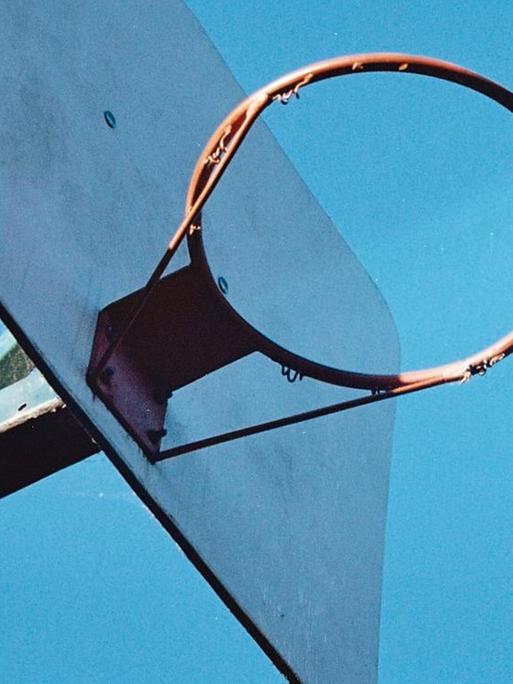Harald Gündel, ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universitäts-Klinik Ulm ist Facharzt für Psychosomatische Medizin, Facharzt für Psychiatrie und Facharzt für Neurologie.
Psychische Leiden im Corona-Lockdown

Die Nachfrage nach Psychotherapie ist im Lockdown gestiegen.(Symbolbild) © Unsplash/ Abigail Zae
„Belastung ist nicht gleich Krankheit“
29:43 Minuten

Moderation: Susanne Führer · 29.05.2021
Die Nachfrage nach Psychotherapie ist im Lockdown gestiegen. „Angst ist die führende Symptomatik“, sagt Harald Gündel von der Uni-Klinik Ulm. Psychotherapie kann nicht die Bedingungen ändern, aber helfen, mehr Kontrolle über sein Leben zu bekommen.
Eine Behandlung an der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uni-Klinik Ulm war schon immer sehr gefragt, in letzter Zeit ist der Behandlungsdruck aber noch gestiegen, sagt der ärztliche Direktor der Klinik, Harald Gündel. "Angst ist die führende Symptomatik". Wer Angst vor einer Infektion hat, zieht sich zurück, isoliert sich selbst und befeuert damit wiederum die seelische Not.
"Diese Kombination aus Angst und Isolation sehen wir besonders häufig. Auch heute habe ich Patienten gesehen, die in diesem Teufelskreis seelisch und dann auch ein Stück körperlich krank geworden sind im Laufe der Monate."
"Begrenzter Stress kann stärken"
Bei seelischen Erkrankungen gebe es kein Schwarz oder Weiß. Stress gehöre zum Leben dazu, begrenzter Stress könne sogar stärken. "Belastung ist nicht gleich Krankheit", sagt der Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychiatrie. Viele Menschen erleben Ängste, sind mal traurig oder haben körperliche Beschwerden.
"Eine wichtige Unterscheidung ist: Wie hoch ist mein persönlicher Leidensdruck? Zweitens: Habe ich das Gefühl, ich verändere mich allmählich in meiner Persönlichkeit, werde ich ein anderer Mensch? Sagt meine Frau, mein Partner: ‚Du bist anders als vorher‘ –, dann geht es in Richtung Krankheit. Und natürlich auch: Habe ich Krankheitssymptome, die ich vorher nicht hatte?"
Soziale Verhältnisse sind wichtig
Das soziale Umfeld sei ein wesentlicher Faktor für die Gesundheit des Menschen. Lange Arbeitslosigkeit oder auch ungünstige Arbeitsbedingungen beispielsweise erhöhen das Risiko zu erkranken, sei es seelisch, körperlich oder psychosomatisch. "Für alle Säugetiere gilt, dass Kontrollverlust oft krank macht." Eine Psychotherapie könne nicht die sozialen Bedingungen ändern – das gilt auch für die Coronamaßnahmen –, aber sie könne den Einzelnen trotzdem helfen.
"Was kann ich selber verändern, um in einer bestimmten Situation noch besser klarzukommen? Das ist die Domäne der Psychotherapie."
Seelische Erkrankungen rasch behandeln
Ob tatsächlich eine Erkrankung vorliegt, sollte von Fachleuten diagnostiziert werden. Und das lieber früh als spät. Wer Krankheitszeichen an sich wahrnehme, sollte möglichst schnell eine Beratung wahrnehmen.
"Denn mit unserer Seele – die ja sehr komplex ist –, ist es letztlich so wie mit einer Sehne. Wenn ich eine Sehnenentzündung habe, also einen Tennisellenbogen, und ich schone und pflege den, dann ist es schnell wieder vorbei. Wenn ich das aber chronifizieren lasse und spiele weiter Tennis und beiße nur die Zähne zusammen, dann kann es chronifizieren. So ist es auch mit seelischen Erkrankungen."
(sf)
Das vollständige Interview:
Deutschlandfunk Kultur: Die Nachfrage nach psychotherapeutischer Hilfe soll noch nie so groß gewesen sein wie jetzt, weil die Menschen unter den Kontaktbeschränkungen leiden. Gibt es in Ihrer Klinik auch mehr Anfragen wegen einer Psychotherapie im Vergleich zu vor anderthalb Jahren?
Gündel: Es gibt auf jeden Fall viele Anfragen. Wir haben eigentlich in den ganzen letzten Jahren häufig viele Anfragen gehabt, aber jetzt ist eine gewisse Verdichtung eingetreten. Was ich sehe, ist, dass nicht so wenige Patienten dabei sind, die scheinbar aufgrund der Corona-Bedingungen krank werden, also seelisch krank werden oder noch kränker werden, seelische Beschwerden entwickeln.
Da ist plötzlich so schrittweise eine Untergruppe von Menschen aufgetaucht, wo Corona eine wichtige Rolle in der Entstehung der seelischen oder auch der körperlichen, der psychosomatischen Beschwerden spielt. Das kannten wir früher natürlich nicht, das ist jetzt neu.
Deutschlandfunk Kultur: Bei den niedergelassenen Psychotherapeuten, also denen mit eigener Praxis, sollen die Anfragen nach Psychotherapie seit Beginn der Pandemie um vierzig Prozent zugenommen haben. Das besagt zumindest eine Blitzumfrage der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Solche Zahlen können Sie so nicht bestätigen?
Gündel: Das ist schwer zu sagen. Wir haben unsere Klinikkapazität, also die stationären, die tagesklinischen Behandlungsplätze, die ambulanten Behandlungsplätze. Die sind mit deutlichem Vorlauf und Wartezeit ausgebucht. Dann kann es natürlich schon auch sein, dass Menschen bei uns in der Ambulanz anrufen, die dann nicht schnell genug einen Termin bekommen und woanders hingehen. Der Druck von belasteten Menschen ist sicherlich noch ein Stück höher geworden. Das kann ich schon sagen.
Der Behandlungsdruck ist gestiegen
Deutschlandfunk Kultur: "Ausgebucht", das heißt, Sie schicken Leute dann auch erst mal wieder weg?
Gündel: Letztlich nein. Wir wollen tatsächlich alle, die bei uns anrufen, auch versorgen, mit einer Wartezeit von drei bis vier Wochen. Aber es kann natürlich sein, dass, wenn jemand drei oder vier Wochen auf den ersten Termin warten muss oder längere Zeit auf einen tagesklinischen Behandlungsplatz, er vielleicht woanders hingeht, wo ein Platz, eine Behandlungsmöglichkeit frei wird.
Grundsätzlich: Der Behandlungsdruck ist gestiegen. Aber da wir auch vor der Krise sehr nachgefragt waren, kann ich jetzt nicht sagen, dass wir plötzlich komplett überlaufen sind, sondern es ist einfach ein hoher Bedarf da, viele Menschen, bei denen Corona jetzt plötzlich eine Rolle spielt.
Deutschlandfunk Kultur: Sie behandeln nur Erwachsene. Können Sie trotzdem etwas zu der Situation in der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie sagen?
Gündel: Nur von der Oberfläche, weil ich kein Kinder- und Jugendpsychiater bin. Was ich mitbekomme, sei es durch unsere Patienten, die oft auch Eltern sind, sei es durch Mitarbeiter, sei es durch meinen Freundes- und Bekanntenkreis, ist, dass viele Kinder und Jugendliche belastet sind durch den Wegfall der sozialen Kontakte, durch die Einschränkung des Schulunterrichtes auf einen Bildschirm, an dem sie mehrere Stunden am Tag sitzen, teilweise nur den Bildschirm und nur Folien und überhaupt keine Lehrer, keine Mitschüler mehr sehen. Ich höre von vielen Kindern und Jugendlichen, die belastet sind, die unter der Isolation leiden.
Wobei mein Eindruck in den allerletzten Wochen ist, wenn die Schule wieder ein bisschen stärker losgeht, atmen manche schon wieder auf und der Druck wird ein bisschen geringer. Aber ganz klar: Es gibt sicherlich eine große Zahl von Kindern und Jugendlichen, die aus vielen Gründen leiden: Isolation, Belastung der Eltern. Und je schwieriger die sozialen Verhältnisse, je kleiner die Wohnung, je mehr Personen im gleichen Wohnraum den ganzen Tag im Homeoffice und im Homeschooling usw. sind, desto mehr an Verdichtung und auch an Stress, den die Kinder und Jugendlichen vorher in dieser Form nicht kannten.
Angst ist die häufigste Symptomatik
Deutschlandfunk Kultur: Kommen wir zu Ihrer Klinik und den Erwachsenen, die Sie behandeln. – Mit welchen Beschwerden melden sich die Menschen bei Ihnen zurzeit vor allem?
Gündel: Viele Ängste. Prof. Teufel von der Psychosomatischen Klinik in Essen hat gezielt zu den psychischen Belastungen unter Covid geforscht. Und unterm Strich steht: Angst ist die führende Symptomatik, die häufigste Symptomatik. Ich kann das sehr bestätigen in meiner klinischen Erfahrung. Viele ältere Menschen haben in dieser Zeit des Lockdowns große Ängste gehabt, sich sehr zurückgezogen, um bloß nicht angesteckt zu werden. Wir alle wissen, eine Verminderung von Kontakten zu Menschen, die uns wichtig sind, die wir lieben, eine Verminderung von Hobbys, Dingen, die uns Kraft geben - das schwächt den Menschen.
Es gibt also die Angst vor der Infektion. Und weil ich Angst habe und mich zurückziehe und vieles nicht mehr mache - menschliche Kontakte pflegen, Dinge unternehmen, die ich gerne tue -, schwäche ich zusätzlich noch die Person, weil wir alle Inseln brauchen, auf denen wir Kraft tanken und wir auch regenerieren können. Diese Inseln sind oft weniger geworden.
Diese Kombination aus Angst und Isolation, Rückzug sehen wir besonders häufig. Auch heute habe ich Patienten gesehen, die in diesem Teufelskreis seelisch und dann auch ein Stück körperlich krank geworden sind im Laufe der Monate.
Belastung ist nicht gleich Krankheit
Deutschlandfunk Kultur: Es sind ja fast alle genervt von diesen Maßnahmen. Aber es werden zum Glück nicht alle seelisch krank. Wo liegt die Trennlinie zwischen denen, die Hilfe brauchen, und denen, die alleine klarkommen? Worin unterscheiden sie sich?
Gündel: Da haben Sie völlig recht. Belastung ist nicht gleich Krankheit. Wir wissen mittlerweile auch, dass es kein schwarz oder weiß gibt bei seelischen Erkrankungen. Also beispielsweise einer Angsterkrankung, einer depressiven Erkrankung, einer sogenannten somatoformen Erkrankung, sprich Rückenschmerzen, die keinen fassbaren Bandscheibenvorfall als Ursache haben, sondern wo körperlicher Schmerz anstelle eines seelischen Schmerzes auftritt, also bei solchen Erkrankungen. Viele Menschen erleben Ängste, Zeiten, in denen sie weniger Antrieb haben, weniger Energie, sie sich nicht wohlfühlen, mal traurig sind, mal körperliche Beschwerden haben.
Irgendwann ist eine gewisse Schwelle überschritten, wo wir sagen, "das ist jetzt Krankheit". Experten haben sich viele Gedanken darüber gemacht, an welchem Punkt in diesem Kontinuum diese Schwelle überschritten ist. Das heißt, es ist nicht immer ganz scharf, aber es gibt schon klare Trennlinien. Ich denke, eine wichtige Unterscheidung ist: Wie hoch ist mein persönlicher Leidensdruck? Also: Leide ich persönlich? Zweitens: Habe ich das Gefühl, ich verändere mich allmählich in meiner Persönlichkeit, werde ich ein anderer Mensch? Sagt meine Frau, mein Partner: "Du bist anders als vorher" –, dann geht es in Richtung Krankheit. Und natürlich auch: Habe ich Krankheitssymptome, die ich vorher nicht hatte?
Unser Körper – in der Perspektive der Psychosomatik – ist im Prinzip ein sich selbst regulierendes System von Regelkreisen. Und wenn wir gesund sind, sind diese Regelkreise in einer Homöostase, also im Gleichgewicht. Gleichzeitig ist der Mensch ein halb offenes System. Das heißt, wir sind nicht wie eine Maschine, die einfach vor sich hin funktioniert, sondern wenn sich im Außen was ändert, dann wirkt das auf unseren Organismus ein. Zum Beispiel: Ich bin nicht mehr mit meinem Team zusammen, ich bin nicht mehr am Arbeitsplatz, sondern isoliert zu Hause oder mein Partner, mein Ehemann kann mich nicht mehr besuchen, weil er in einem anderen Land lebt und jetzt nicht mehr kommen darf.
Seelische Erkrankungen rasch behandeln
Jede Form von Stress, und den gibt es in Corona in vielfältiger Form sehr häufig – auch finanzielle Ängste, soziale Ängste etc. –, wirkt auf den Organismus. Ich stelle es mir ganz banal so vor: Das ist wie ein Kessel, da ist ein gewisser Dampf drin, da gibt’s Ventile, die bei einem gewissen Druck aufgehen können. Und wenn der Stress zu groß wird für den einzelnen Organismus und die Belastungen zu groß werden, dann geht halt irgendwo in diesem eigentlich sich selbst regulierenden Organismus ein Ventil auf. Es pfeift Dampf heraus und das ist dann sehr häufig ein körperliches Symptom. Oder es ist vielleicht eine Depression. Oder ich merke, ich bin erschöpft. Ich schlafe nicht mehr richtig, habe keine Energie mehr. Ich habe Ängste.
Und das sind dann Zeichen, die in Richtung Krankheit gehen. Also, wenn Leidensdruck da ist, wenn Symptome auftreten, die vorher nicht da waren und die eine gewisse Intensität überschreiten, dann ist eine Krankheit da. Es braucht natürlich einen Arzt oder Experten im Bereich psychosomatische Medizin, Psychotherapie, Psychiatrie, um festzustellen, wann genau die Grenze überschritten ist.
Das Wesentliche ist: Menschen, die so etwas spüren, sollten relativ früh eine Beratung wahrnehmen, weil es mit unserer Seele – die ja sehr komplex ist – letztlich so ist wie mit einer Sehne. Wenn ich eine Sehnenentzündung habe, also einen Tennisellenbogen, und ich schone den zwei bis drei Wochen, ich mache Krankengymnastik, ich pflege den, dann ist das schnell wieder vorbei. Wenn ich das aber chronifizieren lasse und spiele weiter Tennis und beiße nur die Zähne zusammen, dann kann es chronifizieren. So ist es auch mit seelischen Erkrankungen.
Begrenzter Stress macht stärker
Deutschlandfunk Kultur: Sie sagen, es geht um ein System von Regelkreisen, das im Gleichgewicht ist, wenn das alles im Gleichgewicht ist, dann sind wir gesund. Das ist aber ein sehr hoher Anspruch, oder?
Gündel: Absolut.
Deutschlandfunk Kultur: Man kann doch gar nicht immer alles im Gleichgewicht haben.
Gündel: Nein. Das ist ja auch ein Idealbild. Es ist völlig klar, dass es zum gesunden Leben gehört, dass auch immer wieder Dinge nicht im Gleichgewicht sind, dass Bedrohung auftritt, dass Stress auftritt. Wie lange gibt es den Menschen? Viele zigtausend Jahre. Da gab es immer wieder Dinge, die den Menschen, unsere Vorfahren, aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Das ist klar. Ich glaube, wir sind auch evolutionär dazu angelegt, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Also, ein Stress, der begrenzt ist, macht eher stärker. Wir brauchen immer diese Regenerationsphasen. Wenn wir die nicht haben, dann kann ein Organismus nicht nur kurz, sondern dauerhaft aus dem Gleichgewicht kommen.
Zwischenzeitliche Symptome, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Energieverlust, Schlafstörung, körperliche Symptome, die mal ein paar Wochen anhalten oder ein paar Tage, das gibt’s natürlich allemal. Das ist nicht krankhaft. Da haben Sie komplett recht. Immer im Gleichgewicht zu sein ist natürlich nicht der Normalzustand. Aber es ist ein schönes Bild, eine gute Metapher, um zu sagen: Wenn ich im Großen und Ganzen das Gefühl habe, ich bin eigentlich im Gleichgewicht, es geht mir schlechter und dann geht’s auch wieder gut, dann ist es okay. Aber wenn ich das Gefühl habe, die Richtung meines Befindens verändert sich dauerhaft, dann ist es ein Warnsignal.
Soziale Not kann krank machen
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben gesagt, der Behandlungsdruck in Ihrer Klinik ist gestiegen. Auf der anderen Seite haben Sie eingangs einmal das Wörtchen "scheinbar" benutzt, dass das scheinbar von Corona kommt. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den Corona-Präventionsmaßnahmen und dem gestiegenen Behandlungsdruck?
Gündel: Ich sehe auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen Corona und dem Behandlungsdruck, der gerade im ambulanten Bereich sehr früh ankommt. Wir haben jetzt nur über Ängste gesprochen, die durch Angst vor einer Infektion zustande kommen. Aber es gibt ja noch die ganzen finanziellen, sozialen Schwierigkeiten, die vielen Berufe, die gefährdet sind. Also: Soziale Not trägt wesentlich zu psychischer Erkrankung bei. In dieser gewaltigen Umwälzung, in der wir jetzt stecken, gibt es viele Gründe, die ganz klar dazu beitragen, dass die Belastung auf den einzelnen Menschen im Schnitt steigt.
Hilft Psychotherapie bei gesellschaftlichen Ursachen?
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben gerade von sozialer Not gesprochen. Ist denn dann tatsächlich eine Psychotherapie das Mittel der Wahl, wenn die Erkrankung durch gesellschaftliche Ereignisse hervorgerufen wird?
Gündel: Das ist ein enorm spannendes, wichtiges Feld und eine ganz, ganz wichtige Frage. Bei sogenannten Aufnahmekonferenzen, wo Patienten vorgestellt werden mit der Frage, ist das ein Patient, den wir klinisch behandeln können, stationär, psychosomatisch, psychotherapeutisch, hat mein alter Chef in München, Michael von Rad, manchmal sinngemäß gesagt: "Das soziale Problem ist klar, aber wir können ja nicht das soziale Problem behandeln, wir müssen den Menschen behandeln."
Insofern eine sehr berechtigte Frage. Gleichzeitig würde ich heute sagen: Wir sehen, dass die sozialen Verhältnisse, in denen ein Mensch lebt, einen wesentlichen Einfluss auf seine psychische und psychosomatische Gesundheit haben. Das ist ganz ohne Frage so. Wenn zum Beispiel ein Mensch, der seine Arbeit verloren hat, zu uns in die Behandlung kommt, an persönlichen Konflikten und persönlichen Themen im Rahmen einer intensiven Psychotherapie arbeitet, wieder Tagesstruktur hat, einen Sinn hat, ein Ziel, auf das er hinarbeiten möchte, und dieser Mensch geht dann aus der intensiven Behandlung raus, zurück in den Alltag und er hat weiterhin keine Arbeit, dann ist die Prognose oft sehr viel schlechter als mit Arbeit.
Wir sind unser Körper
Da ist also die seelische Gesundheit und nicht nur die seelische betroffen. Wir sind ja unser Körper. Eigentlich ist das eine völlig künstliche Trennung. Der eine Mensch reagiert bei Belastung mehr seelisch, der andere mehr körperlich, aber wir sind unser Körper. Wo dann die Belastungssymptome auftreten, ist unterschiedlich. Aber es ist völlig klar, dass, wenn die sozialen Verhältnisse schwierig sind und zum Beispiel ein Mensch keine Arbeit hat, seelische Erkrankungen häufiger auftreten. Bei Langzeitarbeitslosigkeit zum Beispiel, da gibt es viele, viele Beispiele, ist die Häufigkeit seelischer Erkrankung zwei- bis dreifach erhöht gegenüber Menschen, die in Arbeit sind.
Schlechte Arbeitsbedingungen machen krank
Deutschlandfunk Kultur: Also müsste man eigentlich die Arbeitslosigkeit behandeln und nicht die Seele. Das ist ja eine bekannte Kritik an der Psychotherapie, dass sie alle Probleme individualisiert, also immer die Ursache im Patienten, in der Patientin sucht und nicht in den Gegebenheiten. Das wird gerade bei der Arbeit, beim Arbeitsumfeld besonders deutlich, wenn es objektiv belastende Arbeitsbedingungen gibt. Wir haben von Langzeitarbeitslosigkeit gesprochen, aber es gibt ja auch Probleme, wenn die Menschen arbeiten. Und die spielen in einer Psychotherapie so gut wie keine Rolle. Das hat die Soziologin Sabine Flick in einer qualitativen Studie gezeigt, sie hat allerdings nur zwanzig Therapien untersucht.
Wenn wir das jetzt übertragen auf die Leiden am Lockdown, Sie haben vorhin von der unguten Kombination von Angst und Isolation gesprochen, dann lautet die Frage: Was können Sie Ihren Patienten mit den Mitteln der Psychotherapie – Sie können ja die Corona-Maßnahmen nicht ändern – bieten?
Gündel: Genau. Ich möchte zunächst dazu sagen: Ich kenne natürlich Frau Flick und schätze ihre Arbeit sehr. Das ist ein wichtiger Befund, den sie da erhoben hat. Ich glaube aber auch, dass unter Psychotherapeuten, Psychiatern, Psychosomatikern diese Wichtigkeit des Themas Arbeits- und Lebensbedingungen auch in den Psychotherapien eher zugenommen hat. Es ist uns schon sehr klar, wie wichtig das ist. Ich glaube, da gibt es eine Bewegung, wo unsere Fachgesellschaften und die Kollegen auch sehen: Ja, das Thema Arbeit ist wichtig beim Thema psychische Gesundheit, was grundsätzlich immer klar war, aber jetzt explizit noch häufiger erwähnt wird.
Jetzt zu Corona: Für jeden Patienten, der zu uns in Behandlung kommt, stellt sich genau wie bei mir selber auch erst mal die Frage: Was kann ich denn selber machen? Was kann ich selber verändern, um in einer bestimmten Situation noch besser klarzukommen? Das ist die Domäne der Psychotherapie. Das heißt, natürlich kann ich die sozialen Bedingungen nicht verändern. Aber ich denke, dieses "was kann ich machen, wie kann ich wieder mehr Kontrolle über mein Leben bekommen, habe ich vielleicht etwas nicht gesehen, kann ich irgendwas neu lernen, sodass ich mehr Kontrolle habe, dass ich was anders mache, etwas Neues ausprobiere", das ist die Domäne der Psychotherapie.
Kontrollverlust macht krank
Für alle Säugetiere gilt, dass Kontrollverlust oft krank macht. Das ist in der Zelle messbar, dass es da Auswirkungen gibt. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe wieder mehr Kontrolle über mein Leben, auch wenn das in kleinen Schritten geht, dann geht das in Richtung Gesundheit. Das ist unser primäres Behandlungsziel. Wir arbeiten mit der Agentur für Arbeit zusammen. Wir haben eine Sozialarbeiterin, die eine total wichtige Rolle hat. Also, wir versuchen schon auch, soweit es geht, zu unterstützen. Wenn wir sehen, unter diesen Bedingungen kann das eigentlich nicht gelingen, können wir auch dem betreffenden Menschen helfen, an den Bedingungen etwas zu verändern.
Deutschlandfunk Kultur: Sie arbeiten ja auch in der Psychotherapieforschung. Inwieweit geht es da auch um das Zusammenwirken von gesellschaftlichen Bedingungen und seelischer Gesundheit?
Gündel: Das ist ein Riesenthema. Wenn ich das ein bisschen herunter breche auf das Thema Arbeit und Gesundheit - das ist ein Schwerpunkt unserer Forschung -, dann können wir sagen: Die Arbeitsbedingungen haben auch einen Einflussfaktor zwei bis drei auf die seelische und die psychosomatische und die körperliche Gesundheit.
Deutschlandfunk Kultur: Was heißt "zwei bis drei"?
Gündel: Da gibt es eine ganze Wissenschaft. Das ist überwiegend Arbeits- und Organisationspsychologie, Arbeitsmedizin. Wir haben in unserem Fachgebiet sehr viel gelernt. Es gibt theoretische Konstrukte, mit denen man erfassen kann: Sind die Bedingungen von Arbeit günstig oder ungünstig für den Erhalt von seelischer Gesundheit, von Kreativität, von Produktivität?
Das kann man mit Fragebögen messen, indem man die Menschen am Arbeitsplatz befragt. Am Ende kommt bei manchen Modellen eine Punktzahl raus. Dann kann ich sagen, das sind günstige Arbeitsbedingungen oder das sind ungünstige Arbeitsbedingungen, zumindest in der Wahrnehmung der Befragten. Wenn dann eine Punktzahl rauskommt, die sagt, das ist eine ungünstige Arbeitsbedingung, dann ist das Risiko nach großen epidemiologischen Untersuchungen, dass ein durchschnittlicher Mensch in so einem Umfeld auch eine seelische oder körperliche Erkrankung entwickelt, zwei- bis dreifach erhöht.
Sind wir alle Weicheier?
Deutschlandfunk Kultur: Es kommt auch darauf an, Frage, welche Perspektive man einnimmt. Sie haben vorhin von der langen Zeit gesprochen, die es den Menschen schon gibt. Ich glaube, man kann unbestritten sagen, dass wir in einer Therapiegesellschaft leben. Wer Probleme hat, hört inzwischen häufig, "geh mal zum Therapeuten, zur Therapeutin". Wenn ich an meine Großeltern denke, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, also aktiv mitgemacht haben, der Großvater, die Großmutter, die ihre Heimat verloren, ihren Hof verloren, ihren Mann verloren, ihren Sohn verloren – die würden wahrscheinlich spotten über uns Weicheier und sagen: "Ihr dürft jetzt mal ein Jahr lang nicht ausgehen! Was habt ihr denn für ein Problem?"
Trotzdem sprechen Sie von diesem gestiegenen Behandlungsdruck. Was würden Sie meinen Großeltern antworten?
Gündel: Ich habe auch solche Großeltern und kenne das gut. Das gilt ja nicht nur für unsere Großeltern. Es gibt ja auch Gesellschaften, Länder, Völker, die das, was unsere Großeltern vor mehreren Generationen erlebt haben, erst vor Kurzem erlebt haben. In vielen Ländern herrscht Krieg oder hat über lange Zeit geherrscht, zum Beispiel in Vietnam mit vielen, vielen Jahren der Kriegsführung. Die Erfahrung ist, der Mensch adaptiert sich. Und wenn etwas zu schrecklich ist, dass es eine Seele verarbeiten kann, also Tod, Sterben, schlimme Sachen, nicht kontrollierbare Bedrohungen, dann gibt es einen Mechanismus im Menschen, dass der die Zähne zusammenbeißt, sofern er das kann, und schwierige Gefühle, die er nicht kontrollieren kann, zur Seite schiebt.
Nach den furchtbaren Erlebnissen des Zweiten Weltkrieges hieß es: "Wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und wir machen und wir schauen nicht so viel auf all das Furchtbare, das wir erlebt haben. Wir reden auch nicht drüber, sondern wir gucken jetzt nach vorne." Das hat was ganz Starkes gehabt, aber …
Deutschlandfunk Kultur: … unsere Gesellschaft ist ja das genaue Gegenteil. Wir sind sehr nabelschaufixiert. Immerzu geht es um unser kostbares Selbst, das wir hegen und pflegen oder vielleicht auch optimieren sollen. Alle Probleme sollen wir aussprechen, Traumata bearbeiten. – Ist das besser?
Gündel: Ich persönlich glaube, dass ein Mittelweg das Beste ist. Da wir von Opa und Oma reden, mein Opa sprach immer vom "goldenen Mittelweg". Und ich weiß und habe viele Patienten kennengelernt, viele Menschen, deren Eltern aus dieser Opa-Generation nicht über das gesprochen haben, was sie erlebt haben, was aber da war und was dann auch Auswirkungen auf sie selber gehabt hat, auf ihre Kinder, auf die Kindeskinder.
Es ist überhaupt keine Frage, dass es für viele Menschen etwas wirklich Gesunderhaltendes oder -Machendes hat, über schwierige Erfahrungen zu sprechen und sie in ihr bewusstes Erleben zu integrieren.
Und es ist überhaupt keine Frage, dass man das auch übertreiben kann. Insofern denke ich, es braucht einen Mittelweg. Aber es ist meines Erachtens keine Frage, dass wir unserer Bevölkerung in einer schweren Zeit auch helfen, soziale Abstürze zu verhindern oder zu vermindern, also die Schwachen stützen in einer Zeit, in der sie Unterstützung brauchen.
Hilfe und Selbsthilfe
Ich habe Kollegen in den USA, die erzählen mir von einer Krankenschwester, die aufgrund von ähnlich schwierigen Bedingungen Rückenschmerzen bekommt und eine Zeit lang nicht arbeiten kann oder von jemandem, der in einer Firma arbeitet und aufgrund von seelischen Schwierigkeiten Schmerzen bekommt, eine Zeit lang arbeitsunfähig ist. Die verlieren dann schnell ihre Arbeit, können die Wohnung nicht mehr bezahlen, sind auf der Straße.
Da haben wir ein System, das demjenigen, der eine Schwäche hat, hilft, wieder hochzukommen. Aber, da gebe ich Ihnen völlig recht, es muss auch Hilfe zur Selbsthilfe geben. Ich glaube, Unterstützung ist wichtig, aber der andere sollte auch, sofern er das kann und nicht eine echte schwere Erkrankung dauerhaft dagegen spricht, dann auch wieder seine Eigenverantwortung übernehmen und das Seinige dazu tun.
Öffentlichen Gesundheitsdienst stärken
Deutschlandfunk Kultur: Wir haben ein System der sozialen Sicherung. Wir haben auch einen öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Coronapandemie hat ziemliche Lücken offengelegt in diesem öffentlichen Gesundheitsdienst. Deswegen wurde im September 2020 ein "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst" geschlossen, wonach die Gesundheitsämter "personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt werden" sollen.
Welche Wünsche hat denn der Facharzt für Psychotherapie an den öffentlichen Gesundheitsdienst?
Gündel: Das kann ich nur aus meiner wirklich persönlichen Wahrnehmung sagen, weil ich kein Experte für den öffentlichen Gesundheitsdienst bin. Soweit ich weiß, ist der öffentliche Gesundheitsdienst auch für die Schuluntersuchung zuständig. Ich finde es wichtig, dass diese Schuluntersuchungen auch durchgeführt werden können, weil sie auch eine Möglichkeit sind, belastete Kinder und Jugendliche relativ früh zu erkennen.
Wie gesagt, unsere Seele ist das komplexestes Organ, das wir haben, eine Frühbehandlung ist schneller wirksam, als wenn man das Leiden lange chronifizieren lässt. Diese Schuluntersuchung halte ich für eine wichtige Aufgabe. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt möglich gewesen ist im letzten Jahr bei dieser enormen Belastung, die der öffentliche Gesundheitsdienst durch die Coronaepidemie gehabt hat.
Das Zweite ist: Zu den Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes zählt auch, zumindest in manchen Landkreisen und Kommunen, die sozialpsychiatrische Unterstützung, die sozialpsychiatrischen Dienste. Soweit ich weiß, wird von den Landkreisen sehr unterschiedlich ausgelegt, was ihre Aufgabe ist. Bei allem, was die Coronapandemie mit sich bringt, denke ich, dass das Thema psychische Gesundheit bei der personellen Knappheit, die im öffentlichen Gesundheitswesen herrscht, nicht im Vordergrund stehen konnte und vielleicht eher an manchen Stellen zu kurz gekommen ist. Das würde ich mir natürlich wünschen, dass sich das in Zukunft besser entwickeln kann.
Die Lehre aus der Coronaepidemie ist ja auch, dass der öffentliche Gesundheitsdienst sehr wichtig ist. Es ist wichtig, ein funktionierendes System zu haben, in dem Ärzte in ihren Bereichen die Leitung haben und präventiv schon etliches machen können. Das würde ich mir wünschen.
Ein weiteres Thema ist der sogenannte Amtsarzt. Der hat auch Begutachtungsaufgaben, wenn es darum geht zu entscheiden: Wer kann nicht mehr arbeiten? Wer braucht welche Unterstützung? – Auch hier weiß ich nicht, wie weit diese Tätigkeit jetzt unter Corona-Bedingungen ausgeführt werden konnte.
Deutschlandfunk Kultur: Also eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes auch im Hinblick auf die psychische Gesundheit, so fasse ich das zusammen.
Gündel: Ja.
Die Bedeutung eines guten Teams
Deutschlandfunk Kultur: Zum Schluss: Wenn Sie zurückblicken auf dieses gute Jahr Corona-Pandemie, hat Sie etwas überrascht? Haben Sie etwas Neues gelernt in Ihrem Beruf als Psychotherapeut?
Gündel: Ich glaube, es gibt nicht wenige Familien, die auch erlebt haben, dass durch den zwischenzeitlichen Lockdown eine andere Intensität möglich war – bei allem, was ganz negativ ist. Ich habe ich oft gehört, dass es auch eine positive Erfahrung sein kann - natürlich nur bei denen, die das Glück haben, in entsprechenden Beziehungen zu leben.
Die Bedeutung des Teams, der Gruppe, das hat mich jetzt nicht komplett überrascht, aber mir ist sehr deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass in dieser hohen Drucksituation auch mit vielen Veränderungen, die auch im Klinikbereich natürlich gekommen sind, wie wichtig ein funktionierendes Team ist, also Menschen, die gut miteinander können, die sich gegenseitig vertrauen. Das ist ein wichtiger Punkt.
Wenn ein System unter Druck gerät, an welchem Arbeitsplatz, in welchem Bezug auch immer, wenn der Druck wächst, wächst an manchen Stellen die Neigung zur Entsolidarisierung. Das heißt, dass ich erst mal gucke, wie komme ich da jetzt durch, und mich eher abgrenze und versuche, selbst die Füße auf dem Boden zu behalten. Dann ist Kommunikation zwischen verschiedenen Menschen, verschiedenen Bereichen nicht einfach, weil der Druck so hoch ist und jeder erst mal ein bisschen "die Schotten dichtmacht".
Das aufzugreifen, das zu verändern und auch zu sehen, dass wir dazu kommen, dass einer den anderen unterstützt, wenn es eng wird und es gleichermaßen auch fair zugeht, das, finde ich, ist eine richtig gute Erfahrung, auch unter Druck im Netz von guten, vertrauensvollen Beziehungen echt viel hinkriegen zu können. Man muss aber auch sehen, wie der Druck Teams stören kann und Arbeitsbereiche stören kann und dass es dann Unterstützung braucht, um dieses Teamgefühl wieder hinzukriegen.