Preuße, Provokateur, Selbstmörder
Moderation: Maike Albath · 12.06.2011
Am 21. November 1811 nahm sich der Dramatiker Heinrich von Kleist am Berliner Wannsee das Leben. Wie ungebrochen seine Faszination ist, zeigt eine Fülle von neuen Büchern. Ein Gespräch mit dem Kleist-Biografen Jens Bisky.
Maike Albath: Am Mikrofon begrüßt Sie Maike Albath, herzlich willkommen.
Tiefblaue Augen, ein weicher Mund, fast mädchenhafte Züge und ein etwas herablassender Gesichtsausdruck, so sieht Heinrich von Kleist auf einer berühmten Miniatur aus, dem einzigen authentischen Gemälde, das es von ihm gibt. Aus dem Drang, sich zu bilden, quittierte Kleist 1799 seine Dienst beim preußischen Militär, schrieb provozierende Dramen und Erzählungen voller Zweifel an den Weltverhältnissen bis er am 21. November 1811 am Berliner Wannsee Selbstmord beging – mit nur 34 Jahren.
Zu Lebzeiten häufig verkannt, gilt er heute als aufregendster Kopf seiner Zeit. Wie ungebrochen seine Faszination ist, zeigt eine Fülle von Büchern, die zu seinem 200. Todestag in diesen Monaten erscheinen. Wir wollen Ihnen vor allem zwei neue Biografien von Günter Blamberger und Peter Michalzik vorstellen und den Fall Kleist ein bisschen näher beleuchten.
Dazu ist Jens Bisky ins Studio gekommen, Feuilletonredakteur der Süddeutschen Zeitung und selbst Verfasser einer großen Kleist-Biografie, die schon 2007 im Rowohlt Verlag erschienen ist. Guten Tag, Herr Bisky.
Jens Bisky: Guten Tag.
Albath: Peter Michalzik und Günter Blamberger haben jeder ein neues Kleist-Buch geschrieben. Eigentlich ist das Leben von Kleist ja schon längst erschöpfend behandelt. Was inspiriert Germanisten und Theaterkritiker dazu, Kleist immer wieder zu porträtieren?
Bisky: Da ist zum einen das Gefühl, dass da noch sehr viel zu entdecken, zu holen und zu verstehen ist. Kleist ist in seinem Lebenslauf ja immer mal wieder rätselhaft. Er verschwindet für ein halbes Jahr, er begibt sich auf Reisen, deren genauen Zweck man nicht kennt, um den er aber ein ungeheures Brimbamborium veranstaltet. Es gibt immer wieder neue Materialien und immer wieder neue Gesichtspunkte, die entdeckt werden. Und es gibt natürlich auch eine inzwischen 200-jährige Kleistrezeption, die sich anfangs sehr auf den pathologischen Fall, auf den Selbstmörder konzentriert hat.
Dann wurde Kleist mit der Reichseinigung so eine Art preußischer Klassiker, also, der Goethe für Berliner. Und man hat gedacht, hier hat man einen patriotischen vaterländischen Dichter. Und auf der anderen Seite entdeckten die Widersacher dieser Vertreter der wilhelminischen Kultur, die jungen Expressionisten, Kleist als einen mit dem zerrissenen Herzen, als sozusagen ihren älteren Bruder, ihren verkannten Vorläufer, in dem sie sich spiegeln konnten.
Beides ist natürlich eine Verzerrung, aber eine ungeheuer folgenreiche und produktive. Die versucht man nun regelmäßig zu korrigieren. Wenn Sie sich die beiden Biografien angeschaut haben, es gibt da doch einiges an neuen Akzenten, an neuen Überlegungen in den beiden.
Albath: Ich hatte den Eindruck, dass Peter Michalzik sich sehr stark auf die Zeit bezieht und auch versucht, aus den Dokumenten heraus uns ein lebendiges Porträt zu vermitteln. Zum Beispiel sagt er, wie schwer so ein preußisches Gewehr war. Das ist eine interessante Information, wenn man sich Kleist vorstellt als jungen 14-, 15-jährigen Soldaten. Und Blamberger scheint sehr stark auch die germanistische Forschung im Blick zu haben und er hat sehr – für mich jedenfalls – überraschende Thesen auch zu einzelnen Werken von Kleist.
Also, er versucht da auch so ein bisschen einen neuen Ansatz zu verfolgen. Und ich hatte den Eindruck, dass er dieses sehr Geheimnisvolle von Kleist so ein bisschen versucht zurückzuführen auf einzelne Autoren, also ihn einzubetten. Zum Beispiel Machiavelli nennt er oder den Cortegiano von Castiglione. Ist ihm das gelungen zu erklären, worin jetzt das Geheimnis liegt von Kleist, dem Günter Blamberger, dem Germanisten?
Bisky: Ganz erklären kann man das nicht. Es gibt keine Zauberformel, die Kleist sofort ins helle Tageslicht stellen würde. Was ihm wirklich gelungen ist, ist an nahezu jeder Biegung dieser Biografie und beinah zu jedem Werk einen neuen Aspekt zu entdecken.
Es gibt etwa eine berühmte Szene. Da ist Kleist bei Christoph Martin Wieland in Oßmannstedt, der ihn beherbergt. Kleist deklamiert vor sich hin, Wieland fragt, was ist denn das? Kleist sagt, na, das ist ein Trauerspiel, eine Tragödie, an der ich arbeite. Und Wieland lässt sich dann vortragen, was Kleist fertig hat, und ist begeistert und schreibt ihm einen ungeheuer begeisterten Brief, auch später, "er müsse, koste es, was es wolle, und wenn der ganze Atlas auf ihn drücke, diese Tragödie, dieses Trauerspiel vollenden".
Jeder Biograf ist begeistert von Wieland, für seinen Blick, für das junge Talent, für die poetische Kraft. Günter Blamberger sagt: Moment mal! Erstens verfolgt Wieland literaturpolitische Ziele. Er ist damals ja nicht unumstritten. Und zweitens hat Kleist überhaupt nichts davon, im Gegenteil, das Lob Wielands verstärkt den Alp, der ihm auf den Schultern liegt. Und praktische Förderung durch Wieland erfährt er, nachdem er Oßmannstedt wieder verlassen hat, kaum noch.
Das finde ich sehr interessant, würde dann aber sagen: Lieber Herr Blamberger, aber als Kleist dann in einer der schwersten Stunden seines Lebens bei dem Adjutanten des preußischen Königs um Wiederanstellung bittet und der Adjutant ihn sehr herablassend behandelt und sagt, na ja, Vers'che gemacht, da geht Kleist nach Hause und nimmt Wielands Brief zur Hand und tröstet sich daran. Da könnte man dann auch die Diskussion weiterspinnen und Blamberger widersprechen. Aber interessant, aufregend ist das in jedem Punkt.
Albath: Ja, weil er einfach etwas Neues in die Diskussion einwirft und da auch Wieland einbettet wiederum in die literaturpolitische Situation der Zeit, weil der natürlich auch Angst hatte, an Bedeutung zu verlieren und Kleist instrumentalisieren wollte.
Etwas, das Blamberger noch sagt und das für Michalzik, den Theaterkritiker sehr wichtig ist, ist dieses kriegerische Element. "Dichter, Krieger, Seelensucher" lautet ja der Untertitel der Kleist-Biografie von Peter Michalzik. Und bei Blamberger heißt es sogar, dass Kleist aus diesem Aggressionspotenzial seine Kreativität speise. Was fangen wir denn mit so einer Äußerung an? Können Sie das bejahen?
Bisky: Es ist sehr viel Aggressionspotenzial in Kleist, obwohl er auf der anderen Seite ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist und man diesem Gesicht, diesem unschuldigen, etwas fülligen Kindergesicht eigentlich die Penthesilea nicht zutraut und auch nicht die zum Hass aufrufenden patriotischen Gedichte.
Was Blamberger macht, ist, er bettet Kleist in die aristokratische Kultur der Zeit ein. Und das hat man lange vergessen. Man hat ihn behandelt, als wäre er ein gleichsam bürgerlicher Dichter – weit gefehlt. Sein Vater war Offizier bei Friedrich dem Großen. Er selbst ist sehr geprägt von friderizianischen Kultur, dem Willen sich auszuzeichnen, die eigene Ehre zu behaupten, Ruhm zu erlangen. Und Ruhm, das ist der Ruhm der Schlachten. Und der Schlachtruhm ist auch für Kleist immer noch ganz zentral. Das mischt sich aber mit den Verhältnissen der Zeit, wo man auch als preußischer Junker, als preußischer Offizier nach der Französischen Revolution nicht so weitermachen kann, wie die Generation der Väter.
Da ist eine ganze Welt im Umsturz. Was Kleist zunächst versucht zu kompensieren, indem er sagt, na gut, ich verlass mich ganz auf meine Vernunft und nicht auf die Zufälle der Welt um mich herum. Und siehe da, die Vernunft führt ihn nur immer tiefer in Widersprüche und Dilemmata hinein. Darauf reagiert er, indem er sozusagen so eine Art Unternehmer, Projektemacher wird, der ständig neue Ideen ausprobiert. Die Tragödie aller Tragödien hatte ich schon erwähnt. Es gibt Zeitschriftenprojekte von ihm. Es gibt die Ideen, am Umsturz gegen Napoleon teilzunehmen, dazu aufzurufen. Er baut auch an Unterwasserbooten und ähnlichem. Und einmal sagt er zu seinem besten Freund von Pfuel, jetzt lass uns nach Australien fahren. Du steuerst und ich komme mit.
Albath: Also, voller Ideen und Pläne hat er immer gesteckt. Und das wurde ja in Ihrer Biografie, Jens Bisky, damals auch schon deutlich, dass er jemand war, der sich alle 10 Jahre mindestens oder eigentlich noch öfter dann, der Rhythmus wird ja immer schneller gegen Lebensende, versucht neu zu definieren und auch neu zu positionieren.
Wie ist es denn mit diesem Preußentum? Er ist ja zunächst eigentlich schon von den Iden der Französischen Revolution affiziert, aber dann von Napoleon entsetzt. Wie verhält er sich als Preuße dazu?
Bisky: Kleist kommt aus dieser friderizianischen Kultur, die er nie ganz los wird. Alle seine Freunde machen im Grunde in Preußen Karriere und werden wichtige Männer. Der Mann, dem er einen Liebesbrief geschrieben hat, Ernst von Pfuel, wird 1848 kurze Zeit Ministerpräsident, einer der führenden preußischen Generäle und Militärs der Zeit. Der organisiert dann am Schluss noch einiges für den Eisenbahnbau. Das ist ungefähr die Linie, in die man Kleists Leben auch stellen muss.
Was mir bei Peter Michalzik ungeheuer gefällt, ist, wie genau er es wissen will, wie es damals beim preußischen Militär zugegangen ist. Man erfährt etwas von Schlafgewohnheiten, von Gefechtsgewohnheiten, das ist ja doch eine sehr andere Kultur, als wir sie kennen. Es sind auch völlig andere Kriege, als wir sie kennen.
Was Kleist dann aber versucht, ist, von der Französischen Revolution zu lernen, um etwas ganz anderes zu machen. Er entwickelt dann, vor allem in der Hermannsschlacht und auch wieder nicht ohne Kontakte zu anderen - er arbeitet ja eine zeitlang im Think Tank der preußischen Reformer, versucht da zu verbinden die Jacobinische Idee, dass alle Bürger geborene Verteidiger ihres Vaterlandes seien, also, alle Bürger müssen zu den Waffen, und auf der anderen Seite die Brutalität des Widerstandes gegen die Jacobiner, nämlich das Gemetzel, dass die Vendée-Bauern in ihrer Ohnmacht gegen die Revolutionäre veranstaltet haben. Das versucht er zusammenzubringen. So richtig ist das mit dem realen Preußen nie zu vereinbaren.
Kleist fehlt es auch einfach an politischer Klugheit, an Geduld und er kann einfach nicht warten. Ganz am Schluss rennt er ja sich die Stirn blutig an dem dann letztendlich doch sehr erfolgreichen Staatskanzler von Hardenberg, der Preußen irgendwie aus den napoleonischen Bedrückungen herausführt und das geschafft hat, indem er eben nicht auf die putschistischen Lösungen von Kleist gesetzt hat.
Albath: Es gibt noch ein weiteres Buch über Kleist von Hans Joachim Kreutzer, auch "Heinrich von Kleist" heißt es im Titel. Und dort fällt ein Zitat von Jacob Grimm, dass Kleist so eine teuflische Bosheit besessen habe. Also, für die Zeitgenossen müssen seine Stücke und auch die Erzählungen ungeheuer beunruhigend gewesen sein.
Bisky: Bosheit haben die Figuren Kleists und Bosheit haben die Konstellationen, in die er sie schickt. Er lässt ja keine Figur in der Welt, die sie kennt. Er lässt keine Figur sich allmählich entwickeln, sondern jede steht eigentlich zu Beginn der Handlungen – nehmen Sie die Dramen, nehmen sie die Erzählungen – vor einem Trümmerhaufen. Die gewohnte Welt fällt in sich zusammen, zerbricht in nichts. Und dann muss jeder Einzelne eine Lösung finden. Kreutzer zeigt das auf 123 Seiten ganz wunderbar, sodass man wirklich ein Kleistbild bekommt.
Das ist das, was ich als kritischen Einwand gegen Michalzik hätte, da fehlen mir die Werke, da fehlt mir eine Deutung. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, das wäre als ob man eine Reportage über eine Weinbaugegend liest, ungeheuer plastisch, ungeheuer anschaulich, ungeheuer informativ, nur wird nie ein Schluck Wein getrunken. Das ist dann auf die Dauer ein bisschen enttäuschend.
Blamberger versucht vor allem die Widersprüche herauszuarbeiten zwischen Kleist und den Preußischen Reformern und legt immer großen Wert darauf, dass halt die ästhetischen Lösungen, die Kleist findet, keine politischen Programmschriften sind, wie man das – auch ich - eine zeitlang ja immer versucht hat zu sehen. Da hat man Gneisenaus Pläne für die Landwehr und Kleists Hermannsschlacht und den Prinzen Friedrich von Homburg nebeneinander gelegt und gesagt, na im Grunde wollen die sehr Ähnliches.
Und da sagt Blamberger: Moment mal - und da hat er Recht. Kleist hat ein ästhetisches Gewissen und ist ein solcher Virtuose in der Konfliktgestaltung, dass das so schlicht 1:1 nicht aufgeht.
Albath: Was ich auch von Günter Blamberger gelernt habe in seiner Biografie, ist, dass es ihm offenkundig immer auf so etwas Entstabilisierendes ankommt, so interpretiert er zumindest einen Großteil der Stücke und auch der Erzählungen, wenn wir an die Marquise von O. denken oder an das Erdbeben von Chile, das also immer ein drittes Element eingeführt wird. Es gibt weder Gut noch Böse, es gibt immer so ein Schwanken und so etwas Unsicheres. Und stattdessen muss man, je nach Situation, neu entscheiden. Das ist ein ganz faszinierender Gedanke. Können Sie das teilen?
Bisky: Ich kann den unbedingt teilen. Da verbinden sich zwei Dinge. Auf der einen Seite ist natürlich die Kleistzeit wirklich eine Zeit des Umsturzes, nicht nur der König und die Königin werden in Paris hingerichtet, sondern danach beginnt ein Krieg der etwa bis 1815 dauert. Und dann ändern sich in Europa ständig die Grenzen. Und in diesem Krieg werden auch ständig neue Techniken, neue Grausamkeiten erprobt. Zur gleichen Zeit gibt es hier eine ähnliche Radikalität in Berlin im Denken, wie es die Franzosen nach Heines schöner Idee im Handeln hatten.
Hinzu kommt Kleists Einsicht, dass wir auf Aufklärung nicht verzichten können, dass sie uns aber am Ende nichts hilft. Er formuliert das in so einem Dilemma, man müsse ein Leben lang lernen, um dann zu begreifen, dass man mit all dem nicht viel anfangen könne. – Ich glaube, da ist etwas von der Existenz des modernen, des aufgeklärten Menschen wirklich gesehen, der ja nicht ohne Vernunft kann, dem die Vernunft dann doch aber den Halt nicht mehr zu geben vermag.
Albath: Etwas, das bei Kreutzer auch eine Rolle spielt, das mir sehr gefallen hat, wie er das aufschlüsselt, ist natürlich die Form und die Sprache. Da zitiert er einmal Kleist: "Uns, was wahr ist, zu verbergen", das sei ein Ansatz. Es kommt in den Notizen zur Sprache vor. Verlieren denn Michalzik und Blamberger auch darüber einige Worte? Sie haben schon angedeutet, dass Michalzik sich sehr auf die Lebensgeschichte konzentriert und uns eigentlich so ein bisschen "weinlos" zurücklässt, ohne vielleicht Deutungen zu dem Werk. Wie ist das bei Blamberger? Hat er einige Ideen, was die Form angeht?
Bisky: Er versucht immer das Gesetz, die Entwicklung der Form nachzuvollziehen. Das sind sehr ausgreifende, komplizierte Bewegungen. Er vergleicht es dann immer mit ähnlichen Werken, auch sehr viel später geschriebenen Werken. Also, auch die späteren Selbstmörder werden zu Kleist in Beziehung gesetzt. Und er versucht immer wieder zeitgenössische Dokumente heranzuziehen, um Konfliktkonstellationen zu erhellen.
So konzentriert wie bei Kreutzer, der sich ganz auf die Form wirft, ist das selten. Und Kreutzer gelingen dann so wirklich in zwei, drei Sätzen interessante Einsichten. Jeder von uns kennt den Schluss des "Prinzen von Homburg", wo er sagt, "es ist ein Traum, ein Traum, was soll es?". Das zitiert man gerne. Und das zitiert man immer wieder so wie, na ja, wir haben uns also wieder mal getäuscht, wir sind jetzt desillusioniert.
Da sagt Kreutzer: Moment mal! Das spielt auf einen Psalmvers an. Und wenn man den einbezieht, dann kommt man zu der Einsicht, dass es im Grunde darum geht: Wenn unsere Wünsche erfüllt worden sind, dann werden wir völlig außer uns sein, wie die Träumer. – Das ist natürlich eine wirklich ganz andere Lesart des Homburg, die sich daraus ergibt. Und ich glaube, dass dieses Außer-sich-Geraten auch ein Ziel ist oder etwas, was man bei Kleist immer wieder beobachten kann. Und da sieht man, wie so durch Kleinigkeiten neue Lichter auf die Werke fallen.
Albath: Das hat mich auch ungeheuer beeindruckt, einfach die Rückbindung an das, was natürlich gelesen wurde und welches der Schatz war auch der Schriftsteller, auf denen sie ihre Werke aufgebaut haben. Und dass die Bibel omnipräsent war, ist ja ganz klar. Und das zeigt Kreutzer sehr schön.
Wie ist es denn mit diesem Gedanken, den Kleist ganz am Anfang verfolgt hat, der Bildung? Da gibt es ja die Verlobung mit Wilhelmine von Zenge und eigentlich versucht er dann sie zu erziehen. Da wird bei Blamberger auch sehr schön deutlich, während sich Michalzik eher darüber aufregt, dass das ein ganz klassisches Bild der Frau und der Ehe war, das damals bestand. War das für Sie eine Überraschung, das so zu lesen, oder hatten Sie diese Einschätzung auch schon, als Sie an Ihrer Biografie gearbeitet haben, Jens Bisky?
Bisky: So genau hab ich nicht gesehen, wie das in der aristokratischen Kultur verwurzelt ist. Das zeichnet Blamberger furios nach. Das muss man eigentlich lesen.
Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen. Kleist will eigentlich diese Wilhelmine erziehen. Und sie will auch erzogen werden. Selbst die trockenen Denkübungen und die Aufsatzthemen, die er ihr schickt, nennt sie ja später "die leidenschaftlichen Liebesbriefe", die sie bekommen habe. Aber es passiert Kleist etwas anderes: Indem er sie sozusagen nur als Empfängerin seiner Botschaften behandelt, beredet er doch alles, was ihr wichtig ist, mit ihr und richtet eine zeitlang seinen ganzen Lebensentwurf auf das Zweigespräch mit dieser Wilhelmine von Zenge aus, die sich natürlich dadurch überfordert gefühlt haben muss. Aber sie bekommt dadurch, während er die Briefe schreibt, eine viel höhere Position als Kleist ihr eigentlich theoretisch zugestehen würde. Man muss dazu auch sagen, dass mir völlig unklar ist, warum er sich verlobt hat. So eine Liebe auf den ersten Blick ist das nicht. Wilhelmine besetzt da eher eine Planstelle. Also, zu einem aufgeklärten Menschen gehört halt eine Frau und gehören Kinder und da muss ich jetzt eine Frau haben und dann muss ich die für ihre Planstelle auch erziehen. Und sobald er merkt, dass ihn die Vernunft nicht mehr leitet, dass dieses Lebensmodell so viel Sicherheit nicht bietet, wie er es erhofft hat, in dem Moment versucht er ja auch auszubüchsen und begibt sich auf Reisen, bis er dann in der Schweiz Bauer werden will und sie sagt, ihre Haut sei sonnenempfindlich. Da sagt er, das ist nun wirklich ein Trennungsgrund, und trennt sich ziemlich grob von ihr.
Albath: Das war dann wieder so ein Selbstentwurf von Kleist, der abwich von allem, was er vorher getan hat. Und Günter Blamberger identifiziert sich an dieser Stelle sehr stark mit Kleist und fordert eigentlich ein von Wilhelmine von Zenge, dass sie sich doch deutlicher zu ihm habe bekennen müssen. Das ist auch unterhaltsam.
Bisky: Das ist unterhaltsam. Ich halte es für völlig übertrieben. Man kann von Wilhelmine von Zenge nicht erwarten, dass sie einem preußischen Offizier ohne abgeschlossenes Hochschulstudium, ohne Pläne für ein Amt in die Schweiz, in der damals eine Art Bürgerkrieg unter französischer Beteiligung herrscht, hinterher fährt, weil er sagt, na ich habe ein paar Bücher über Landwirtschaft gelesen und will jetzt mich hier ankaufen und ein Gut machen, zumal damals gerade ihr Bruder gestorben ist, den Kleist auch kannte, und sie darüber in Trauer war. So einfach wie er konnte halt eine Frau und konnte Wilhelmine von Zenge nicht aus den ständischen Bindungen und aus ihrem Umkreis heraus. Ich halte es auch für eine übertriebene Forderung, das von ihr zu verlangen.
Ist es nicht großartig? Als sie sich nach diesem schlimmen Bruch wiedertreffen in Königsberg, ist sie ihm überhaupt nicht böse. Es gibt eigentlich kein böses Wort von ihr über ihn, und das, obwohl er sie doch – wenigstens am Ende – ziemlich rüde behandelt hat.
Albath: Daran merkt man aber, wie sehr sich auch die Biografen mit der Figur, über die sie schreiben, identifizieren.
Eine große Rolle bei beiden, bei Blamberger und bei Michalzik spielen natürlich dann die Freundschaften Kleists. Sie haben selbst schon einige erwähnt. Pfuel war besonders bedeutsam. Rühle ist ein anderer, viele, die dann preußische Offiziere geworden sind oder eine wichtige Rolle in Preußen gespielt haben.
Wie steht es mit den Freunden? Ist denen auch ein wesentlicher Teil gewidmet in diesen Biografien? Und bewerten die Biografen das so, wie Sie es auch einschätzen würden, Jens Bisky?
Bisky: Die Freunde spielen, und das geht gar nicht anders, in beiden Büchern die ihnen gebührende Rolle. Das sind vor allem Rühle von Lilienstern, ein rasend universal begabter und wirklich noch zu entdeckender Reiseschriftsteller, der Schlachten beschrieben hat. Eines der intelligentesten Bücher über die Schlacht bei Jena und Auerstedt ist der Bericht eines Augenzeugen von Rühle von Lilienstern. Er war nämlich ein Maler. Er hat übersetzt aus dem Griechischen. Er hat sich mit Kartographie sehr intensiv befasst, hat wahnwitzige, mir unverständliche leider, mathematische Pläne und Projekte entwickelt. – Das kommt alles vor.
Interessant ist die Frage, wie man etwa das Verhältnis zwischen Pfuel und Kleist bewertet. Schließlich schreibt Kleist den Anfang 1805, "sei du die Frau mir und die Kinder und die Enkel". Das ist nur eine Anspielung auf die Ilias von Homer. Und es ist, ich habe damals leicht übertrieben gesagt, "ein Heiratsantrag". Aber im Grunde steckt schon der Plan dahinter, zusammenzuleben in einer der Reformprovinzen Preußens, in Ansbach damals oder Bayreuth, wo Kleist gute Chancen hatte, hin versetzt zu werden.
Jetzt ist die Frage: Folgt daraus, dass er schwul war? Das ist eine Frage, die hätte Kleist nicht so richtig verstanden. Die hatten dieses Wort nicht dafür. Und als eine Lebensform eigenen Rechts war das auch nicht ausgeprägt. In der friderizianischen Kultur spielt es aber nicht die Rolle eines Tabus. Man hat sehr gerne darüber geredet. Sie wissen, es gibt auch eine endlose Diskussion über: war Friedrich der Große schwul? Und da sagt Christopher Clark in seinem tollen Preußenbuch zu Recht, das wissen wir nicht, aber er hat sehr gern darüber geredet.
Und jetzt hat Michalzik sozusagen eine Pointe und sagt, auch Kleist redet darüber und steigert sich sozusagen im Schreiben in etwas hinein, was nicht das Seine ist. Ich kann das nicht entscheiden. Er betreibt das – zumindest in diesem Brief – mit einem solchen ungeheuren Ernst und alle Möglichkeiten zum Ausdruck – ja, wie wollen wir es nennen – der Liebe zu einem Mann nutzend. Er nutzt alle Ausdrucksmöglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, sodass mir da doch etwas zu sein scheint.
Aber am Ende, und das müssen, glaub ich, beide Biografen auch zugestehen, ist es das merkwürdige Leben, das ständig in der Dichtung von der Liebe handelt und von unbedingtem Vertrauen in einer wirklich oft sehr erotischen sexualisierten Sprache. Und in Kleists Leben finden wir kaum eine geglückte Liebesbeziehung oder eigentlich gar keine. Das ist schon sehr merkwürdig. Das gehört für mich zu den Rätseln. Die beiden würden, wenn ich sie richtig verstehe, nur sagen, das ist alles in die Sprache, in die Dichtung gewandert.
Albath: Und die ist ja ungeheuer ausdrucksstark. Es gibt dieses große Zitat aus Penthesilea mit den Bissen und den Küssen, die eigentlich ein und dasselbe sind. Und das war auch etwas, was vollkommen neu war und was uns auch bis heute immer noch in Atem hält und verblüfft, dass damals diese Texte entstehen konnten.
Wie war es denn Ende des Lebens? 1811 war der Selbstmord. Kleist war plötzlich isoliert Anfang des Jahres. Erfährt man da Neues von Peter Michalzik oder Günter Blamberger?
Bisky: Man erfährt bei Michalzik einiges Neue über den Selbstmord selber, sie haben da ein Gemälde, das Kleist gesehen hat, nachgestellt. Und Günter Blamberger versucht ebenso wie Michalzik das als eine letzte Inszenierung darzustellen, in der Kleist noch einmal sich als Autor seines Lebens durchsetzt.
Eine Frage, die mir völlig offen geblieben ist, erst Recht in meinem eigenen Buch, ist die Frage: Warum braucht er zwei zum Sterben? Das ist für mich noch immer eine ungeklärte Frage. Er hat immer wieder mal mit Selbstmordgedanken gespielt. Es gibt einen sehr frühen wunderbaren Briefsatz an seinen Schwager, Verwandten, da schreibt er: "Ich bitte Gott um den Tod und dich um Geld" – in dieser Reihenfolge und so auf dieser Ebene bewegen sich die Selbstmordwünsche.
Wann immer es aber ernst wird, sucht er eine zweite Person, die mit ihm geht. Und dummerweise, muss ich sagen, findet er dann Henriette Vogel, die schwer krank ist. Die beiden sitzen und musizieren gemeinsam. Das kann man sehr schön bei Michalzik nachlesen, wie sie sozusagen in Todesbereitschaft singen. Und dann erschießt er sie und dann sich. Unklar bleibt mir immer noch: Warum hat er diese zweite Person gebraucht? Das wäre vielleicht mal Stoff für ein weiteres kleines Kleist-Buch.
Albath: Aber es ist ja auch schön, dass diese Geheimnisse immer bleiben. Und das zeichnet Kleist aus. Auch das inspiriert die vielen Biografen zu neuen Arbeiten.
Es gibt nicht nur viele Bücher zu Kleist und zu Kleists Leben, sondern auch eine neue Ausgabe der Kleist-Werke. Das ist die sogenannte Münchner Ausgabe, die im Carl Hanser Verlag erschienen ist und nur drei Bände umfasst. Was ist das für eine Ausgabe, Jens Bisky?
Bisky: Das ist die Ausgabe, nach der wir in Zukunft wahrscheinlich zitieren werden. Es ist ja so, ein großer Unstern waltet über Kleistausgaben und über Kleist-Manuskripten sowieso, von denen ein Großteil verloren gegangen ist. Einen Teil hat er selber noch vernichtet, also nahezu alles, was er bekommen konnte.
Was diese Münchner Ausgabe auszeichnet, ist, dass sie uns zum ersten Mal den Kleist so gibt, wie er geschrieben hat. Sie aktualisiert nicht die Rechtschreibung, die Zeichensetzung. Sie lässt auch irritierende Unregelmäßigkeiten stehen und überlässt es dem Leser, sich davon ein Bild zu nehmen, statt ihm vorlaut Interpreten an die Seite zu stellen, der sagt, so ist das gemeint, vollzieh das mal nach.
Da kann man sehr viel entdecken. Und das beruht auf der großen Brandenburger Kleist-Ausgabe, die Reuß und Staengle über Jahre hinweg veranstaltet haben. Man findet in dieser Münchner Kleist-Ausgabe, was wunderbar ist, sehr viele Dokumente zum Leben und zum Sterben Kleists, die man jetzt wirklich praktisch und schnell bei der Hand hat. Das ist wunderbar.
Was mich ein bisschen enttäuscht hat bei der Münchner Ausgabe, ist der Kommentar, der konzentriert sich vor allem auf den Text. Inhaltliche Verständnishilfen werden kaum gegeben. Nun muss man das nicht übertreiben. Es gibt beim Deutschen Klassikerverlag eine vierbändige Kleistausgabe, da können Sie manchmal Seiten über einzelne Stichworte lesen. Das ist vielleicht des Guten zu viel. Aber hier ist es mir doch entschieden zu wenig. Und ich hoffe, dass in der zweiten oder dritten Auflage der Münchner Ausgabe es da Nacharbeiten und Ergänzungen gibt.
Bisher haben wir ja im Regelfall die Ausgabe von Helmut Sendner zu Hause im Regal gehabt und haben die gelesen. Es war die gute Idee von Hanser, Sendner und den Radikalphilologen aus Heidelberg, also Reuß und Staengle, zu kombinieren, um sozusagen eine radikalphilologische Volksausgabe zu machen. Die wird jetzt die Standardausgabe von Kleists Werken, glaube ich, werden. Wie gesagt, ich wünsche mir sehr, dass man da den Kommentar wirklich hilfreicher macht.
Albath: Also, da werden dann diese radikalen Tendenzen von Kleist verbunden mit philologischem Handwerk. Diese Ausgabe liegt im Carl Hanser Verlag vor. Wir sprachen über verschiedene Biografien. "Heinrich von Kleist" von Günter Blamberger heißt eine. Sie ist im Fischer Verlag erschienen. Und "Kleist. Dichter, Krieger, Seelensucher" von Peter Michalzik liegt bei Propyläen vor. Diskutiert haben wir außerdem über Hans Joachim Kreutzer, "Heinrich von Kleist", erschienen bei C.H. Beck.
Jetzt haben wir noch etwas Zeit für einen Buchtipp. Was möchten Sie empfehlen, Jens Bisky?
Bisky: Ich möchte ein Buch empfehlen, das ich vor wenigen Tagen gelesen habe und das mich ungeheuer gefesselt und gepackt hat. Es ist das Englische Tagebuch, das Bärbel Bohley, die große, verstorbene Bürgerrechtlerin aus der DDR, im Grunde die Mutter der Herbstrevolution, wenn man es pathetisch sagen will, geschrieben hat als sie nach Verhaftung durch die Staatssicherheit in den Westen abgeschoben worden ist. Und sie beschreibt den Westen und ihren unbedingten Willen, wieder in die DDR zurückzukommen, um dort Veränderungen durchzusetzen. Die Stimmung und die Intelligenz, aus der heraus die Revolution im Herbst 89 entstanden ist, die lernt man hier wirklich auf eindrucksvolle Weise kennen.
Albath: Eine Empfehlung von Bisky: Bärbel Bohley, "Englisches Tagebuch 1988" heißt der Band. Der Verlag ist Basisdruck. Und mit diesem Buchtipp geht unsere Ausgabe der Lesart heute zu Ende. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Gast Jens Bisky für seinen Besuch und für das inflammierte Gespräch, wie es Kleist genannt hätte.
Am Mikrofon verabschiedet sich Maike Albath.
Mehr zum Thema bei dradio.de:
Ein übervolles und rastloses Leben: Ausstellung zum Kleist-Jahr
Theaterkritiker Peter Michalzik über Heinrich von Kleist
Kleist kickt immer noch - Berliner Intendant sieht viele Parallelen zum heutigen Lebensgefühl
Tiefblaue Augen, ein weicher Mund, fast mädchenhafte Züge und ein etwas herablassender Gesichtsausdruck, so sieht Heinrich von Kleist auf einer berühmten Miniatur aus, dem einzigen authentischen Gemälde, das es von ihm gibt. Aus dem Drang, sich zu bilden, quittierte Kleist 1799 seine Dienst beim preußischen Militär, schrieb provozierende Dramen und Erzählungen voller Zweifel an den Weltverhältnissen bis er am 21. November 1811 am Berliner Wannsee Selbstmord beging – mit nur 34 Jahren.
Zu Lebzeiten häufig verkannt, gilt er heute als aufregendster Kopf seiner Zeit. Wie ungebrochen seine Faszination ist, zeigt eine Fülle von Büchern, die zu seinem 200. Todestag in diesen Monaten erscheinen. Wir wollen Ihnen vor allem zwei neue Biografien von Günter Blamberger und Peter Michalzik vorstellen und den Fall Kleist ein bisschen näher beleuchten.
Dazu ist Jens Bisky ins Studio gekommen, Feuilletonredakteur der Süddeutschen Zeitung und selbst Verfasser einer großen Kleist-Biografie, die schon 2007 im Rowohlt Verlag erschienen ist. Guten Tag, Herr Bisky.
Jens Bisky: Guten Tag.
Albath: Peter Michalzik und Günter Blamberger haben jeder ein neues Kleist-Buch geschrieben. Eigentlich ist das Leben von Kleist ja schon längst erschöpfend behandelt. Was inspiriert Germanisten und Theaterkritiker dazu, Kleist immer wieder zu porträtieren?
Bisky: Da ist zum einen das Gefühl, dass da noch sehr viel zu entdecken, zu holen und zu verstehen ist. Kleist ist in seinem Lebenslauf ja immer mal wieder rätselhaft. Er verschwindet für ein halbes Jahr, er begibt sich auf Reisen, deren genauen Zweck man nicht kennt, um den er aber ein ungeheures Brimbamborium veranstaltet. Es gibt immer wieder neue Materialien und immer wieder neue Gesichtspunkte, die entdeckt werden. Und es gibt natürlich auch eine inzwischen 200-jährige Kleistrezeption, die sich anfangs sehr auf den pathologischen Fall, auf den Selbstmörder konzentriert hat.
Dann wurde Kleist mit der Reichseinigung so eine Art preußischer Klassiker, also, der Goethe für Berliner. Und man hat gedacht, hier hat man einen patriotischen vaterländischen Dichter. Und auf der anderen Seite entdeckten die Widersacher dieser Vertreter der wilhelminischen Kultur, die jungen Expressionisten, Kleist als einen mit dem zerrissenen Herzen, als sozusagen ihren älteren Bruder, ihren verkannten Vorläufer, in dem sie sich spiegeln konnten.
Beides ist natürlich eine Verzerrung, aber eine ungeheuer folgenreiche und produktive. Die versucht man nun regelmäßig zu korrigieren. Wenn Sie sich die beiden Biografien angeschaut haben, es gibt da doch einiges an neuen Akzenten, an neuen Überlegungen in den beiden.
Albath: Ich hatte den Eindruck, dass Peter Michalzik sich sehr stark auf die Zeit bezieht und auch versucht, aus den Dokumenten heraus uns ein lebendiges Porträt zu vermitteln. Zum Beispiel sagt er, wie schwer so ein preußisches Gewehr war. Das ist eine interessante Information, wenn man sich Kleist vorstellt als jungen 14-, 15-jährigen Soldaten. Und Blamberger scheint sehr stark auch die germanistische Forschung im Blick zu haben und er hat sehr – für mich jedenfalls – überraschende Thesen auch zu einzelnen Werken von Kleist.
Also, er versucht da auch so ein bisschen einen neuen Ansatz zu verfolgen. Und ich hatte den Eindruck, dass er dieses sehr Geheimnisvolle von Kleist so ein bisschen versucht zurückzuführen auf einzelne Autoren, also ihn einzubetten. Zum Beispiel Machiavelli nennt er oder den Cortegiano von Castiglione. Ist ihm das gelungen zu erklären, worin jetzt das Geheimnis liegt von Kleist, dem Günter Blamberger, dem Germanisten?
Bisky: Ganz erklären kann man das nicht. Es gibt keine Zauberformel, die Kleist sofort ins helle Tageslicht stellen würde. Was ihm wirklich gelungen ist, ist an nahezu jeder Biegung dieser Biografie und beinah zu jedem Werk einen neuen Aspekt zu entdecken.
Es gibt etwa eine berühmte Szene. Da ist Kleist bei Christoph Martin Wieland in Oßmannstedt, der ihn beherbergt. Kleist deklamiert vor sich hin, Wieland fragt, was ist denn das? Kleist sagt, na, das ist ein Trauerspiel, eine Tragödie, an der ich arbeite. Und Wieland lässt sich dann vortragen, was Kleist fertig hat, und ist begeistert und schreibt ihm einen ungeheuer begeisterten Brief, auch später, "er müsse, koste es, was es wolle, und wenn der ganze Atlas auf ihn drücke, diese Tragödie, dieses Trauerspiel vollenden".
Jeder Biograf ist begeistert von Wieland, für seinen Blick, für das junge Talent, für die poetische Kraft. Günter Blamberger sagt: Moment mal! Erstens verfolgt Wieland literaturpolitische Ziele. Er ist damals ja nicht unumstritten. Und zweitens hat Kleist überhaupt nichts davon, im Gegenteil, das Lob Wielands verstärkt den Alp, der ihm auf den Schultern liegt. Und praktische Förderung durch Wieland erfährt er, nachdem er Oßmannstedt wieder verlassen hat, kaum noch.
Das finde ich sehr interessant, würde dann aber sagen: Lieber Herr Blamberger, aber als Kleist dann in einer der schwersten Stunden seines Lebens bei dem Adjutanten des preußischen Königs um Wiederanstellung bittet und der Adjutant ihn sehr herablassend behandelt und sagt, na ja, Vers'che gemacht, da geht Kleist nach Hause und nimmt Wielands Brief zur Hand und tröstet sich daran. Da könnte man dann auch die Diskussion weiterspinnen und Blamberger widersprechen. Aber interessant, aufregend ist das in jedem Punkt.
Albath: Ja, weil er einfach etwas Neues in die Diskussion einwirft und da auch Wieland einbettet wiederum in die literaturpolitische Situation der Zeit, weil der natürlich auch Angst hatte, an Bedeutung zu verlieren und Kleist instrumentalisieren wollte.
Etwas, das Blamberger noch sagt und das für Michalzik, den Theaterkritiker sehr wichtig ist, ist dieses kriegerische Element. "Dichter, Krieger, Seelensucher" lautet ja der Untertitel der Kleist-Biografie von Peter Michalzik. Und bei Blamberger heißt es sogar, dass Kleist aus diesem Aggressionspotenzial seine Kreativität speise. Was fangen wir denn mit so einer Äußerung an? Können Sie das bejahen?
Bisky: Es ist sehr viel Aggressionspotenzial in Kleist, obwohl er auf der anderen Seite ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist und man diesem Gesicht, diesem unschuldigen, etwas fülligen Kindergesicht eigentlich die Penthesilea nicht zutraut und auch nicht die zum Hass aufrufenden patriotischen Gedichte.
Was Blamberger macht, ist, er bettet Kleist in die aristokratische Kultur der Zeit ein. Und das hat man lange vergessen. Man hat ihn behandelt, als wäre er ein gleichsam bürgerlicher Dichter – weit gefehlt. Sein Vater war Offizier bei Friedrich dem Großen. Er selbst ist sehr geprägt von friderizianischen Kultur, dem Willen sich auszuzeichnen, die eigene Ehre zu behaupten, Ruhm zu erlangen. Und Ruhm, das ist der Ruhm der Schlachten. Und der Schlachtruhm ist auch für Kleist immer noch ganz zentral. Das mischt sich aber mit den Verhältnissen der Zeit, wo man auch als preußischer Junker, als preußischer Offizier nach der Französischen Revolution nicht so weitermachen kann, wie die Generation der Väter.
Da ist eine ganze Welt im Umsturz. Was Kleist zunächst versucht zu kompensieren, indem er sagt, na gut, ich verlass mich ganz auf meine Vernunft und nicht auf die Zufälle der Welt um mich herum. Und siehe da, die Vernunft führt ihn nur immer tiefer in Widersprüche und Dilemmata hinein. Darauf reagiert er, indem er sozusagen so eine Art Unternehmer, Projektemacher wird, der ständig neue Ideen ausprobiert. Die Tragödie aller Tragödien hatte ich schon erwähnt. Es gibt Zeitschriftenprojekte von ihm. Es gibt die Ideen, am Umsturz gegen Napoleon teilzunehmen, dazu aufzurufen. Er baut auch an Unterwasserbooten und ähnlichem. Und einmal sagt er zu seinem besten Freund von Pfuel, jetzt lass uns nach Australien fahren. Du steuerst und ich komme mit.
Albath: Also, voller Ideen und Pläne hat er immer gesteckt. Und das wurde ja in Ihrer Biografie, Jens Bisky, damals auch schon deutlich, dass er jemand war, der sich alle 10 Jahre mindestens oder eigentlich noch öfter dann, der Rhythmus wird ja immer schneller gegen Lebensende, versucht neu zu definieren und auch neu zu positionieren.
Wie ist es denn mit diesem Preußentum? Er ist ja zunächst eigentlich schon von den Iden der Französischen Revolution affiziert, aber dann von Napoleon entsetzt. Wie verhält er sich als Preuße dazu?
Bisky: Kleist kommt aus dieser friderizianischen Kultur, die er nie ganz los wird. Alle seine Freunde machen im Grunde in Preußen Karriere und werden wichtige Männer. Der Mann, dem er einen Liebesbrief geschrieben hat, Ernst von Pfuel, wird 1848 kurze Zeit Ministerpräsident, einer der führenden preußischen Generäle und Militärs der Zeit. Der organisiert dann am Schluss noch einiges für den Eisenbahnbau. Das ist ungefähr die Linie, in die man Kleists Leben auch stellen muss.
Was mir bei Peter Michalzik ungeheuer gefällt, ist, wie genau er es wissen will, wie es damals beim preußischen Militär zugegangen ist. Man erfährt etwas von Schlafgewohnheiten, von Gefechtsgewohnheiten, das ist ja doch eine sehr andere Kultur, als wir sie kennen. Es sind auch völlig andere Kriege, als wir sie kennen.
Was Kleist dann aber versucht, ist, von der Französischen Revolution zu lernen, um etwas ganz anderes zu machen. Er entwickelt dann, vor allem in der Hermannsschlacht und auch wieder nicht ohne Kontakte zu anderen - er arbeitet ja eine zeitlang im Think Tank der preußischen Reformer, versucht da zu verbinden die Jacobinische Idee, dass alle Bürger geborene Verteidiger ihres Vaterlandes seien, also, alle Bürger müssen zu den Waffen, und auf der anderen Seite die Brutalität des Widerstandes gegen die Jacobiner, nämlich das Gemetzel, dass die Vendée-Bauern in ihrer Ohnmacht gegen die Revolutionäre veranstaltet haben. Das versucht er zusammenzubringen. So richtig ist das mit dem realen Preußen nie zu vereinbaren.
Kleist fehlt es auch einfach an politischer Klugheit, an Geduld und er kann einfach nicht warten. Ganz am Schluss rennt er ja sich die Stirn blutig an dem dann letztendlich doch sehr erfolgreichen Staatskanzler von Hardenberg, der Preußen irgendwie aus den napoleonischen Bedrückungen herausführt und das geschafft hat, indem er eben nicht auf die putschistischen Lösungen von Kleist gesetzt hat.
Albath: Es gibt noch ein weiteres Buch über Kleist von Hans Joachim Kreutzer, auch "Heinrich von Kleist" heißt es im Titel. Und dort fällt ein Zitat von Jacob Grimm, dass Kleist so eine teuflische Bosheit besessen habe. Also, für die Zeitgenossen müssen seine Stücke und auch die Erzählungen ungeheuer beunruhigend gewesen sein.
Bisky: Bosheit haben die Figuren Kleists und Bosheit haben die Konstellationen, in die er sie schickt. Er lässt ja keine Figur in der Welt, die sie kennt. Er lässt keine Figur sich allmählich entwickeln, sondern jede steht eigentlich zu Beginn der Handlungen – nehmen Sie die Dramen, nehmen sie die Erzählungen – vor einem Trümmerhaufen. Die gewohnte Welt fällt in sich zusammen, zerbricht in nichts. Und dann muss jeder Einzelne eine Lösung finden. Kreutzer zeigt das auf 123 Seiten ganz wunderbar, sodass man wirklich ein Kleistbild bekommt.
Das ist das, was ich als kritischen Einwand gegen Michalzik hätte, da fehlen mir die Werke, da fehlt mir eine Deutung. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, das wäre als ob man eine Reportage über eine Weinbaugegend liest, ungeheuer plastisch, ungeheuer anschaulich, ungeheuer informativ, nur wird nie ein Schluck Wein getrunken. Das ist dann auf die Dauer ein bisschen enttäuschend.
Blamberger versucht vor allem die Widersprüche herauszuarbeiten zwischen Kleist und den Preußischen Reformern und legt immer großen Wert darauf, dass halt die ästhetischen Lösungen, die Kleist findet, keine politischen Programmschriften sind, wie man das – auch ich - eine zeitlang ja immer versucht hat zu sehen. Da hat man Gneisenaus Pläne für die Landwehr und Kleists Hermannsschlacht und den Prinzen Friedrich von Homburg nebeneinander gelegt und gesagt, na im Grunde wollen die sehr Ähnliches.
Und da sagt Blamberger: Moment mal - und da hat er Recht. Kleist hat ein ästhetisches Gewissen und ist ein solcher Virtuose in der Konfliktgestaltung, dass das so schlicht 1:1 nicht aufgeht.
Albath: Was ich auch von Günter Blamberger gelernt habe in seiner Biografie, ist, dass es ihm offenkundig immer auf so etwas Entstabilisierendes ankommt, so interpretiert er zumindest einen Großteil der Stücke und auch der Erzählungen, wenn wir an die Marquise von O. denken oder an das Erdbeben von Chile, das also immer ein drittes Element eingeführt wird. Es gibt weder Gut noch Böse, es gibt immer so ein Schwanken und so etwas Unsicheres. Und stattdessen muss man, je nach Situation, neu entscheiden. Das ist ein ganz faszinierender Gedanke. Können Sie das teilen?
Bisky: Ich kann den unbedingt teilen. Da verbinden sich zwei Dinge. Auf der einen Seite ist natürlich die Kleistzeit wirklich eine Zeit des Umsturzes, nicht nur der König und die Königin werden in Paris hingerichtet, sondern danach beginnt ein Krieg der etwa bis 1815 dauert. Und dann ändern sich in Europa ständig die Grenzen. Und in diesem Krieg werden auch ständig neue Techniken, neue Grausamkeiten erprobt. Zur gleichen Zeit gibt es hier eine ähnliche Radikalität in Berlin im Denken, wie es die Franzosen nach Heines schöner Idee im Handeln hatten.
Hinzu kommt Kleists Einsicht, dass wir auf Aufklärung nicht verzichten können, dass sie uns aber am Ende nichts hilft. Er formuliert das in so einem Dilemma, man müsse ein Leben lang lernen, um dann zu begreifen, dass man mit all dem nicht viel anfangen könne. – Ich glaube, da ist etwas von der Existenz des modernen, des aufgeklärten Menschen wirklich gesehen, der ja nicht ohne Vernunft kann, dem die Vernunft dann doch aber den Halt nicht mehr zu geben vermag.
Albath: Etwas, das bei Kreutzer auch eine Rolle spielt, das mir sehr gefallen hat, wie er das aufschlüsselt, ist natürlich die Form und die Sprache. Da zitiert er einmal Kleist: "Uns, was wahr ist, zu verbergen", das sei ein Ansatz. Es kommt in den Notizen zur Sprache vor. Verlieren denn Michalzik und Blamberger auch darüber einige Worte? Sie haben schon angedeutet, dass Michalzik sich sehr auf die Lebensgeschichte konzentriert und uns eigentlich so ein bisschen "weinlos" zurücklässt, ohne vielleicht Deutungen zu dem Werk. Wie ist das bei Blamberger? Hat er einige Ideen, was die Form angeht?
Bisky: Er versucht immer das Gesetz, die Entwicklung der Form nachzuvollziehen. Das sind sehr ausgreifende, komplizierte Bewegungen. Er vergleicht es dann immer mit ähnlichen Werken, auch sehr viel später geschriebenen Werken. Also, auch die späteren Selbstmörder werden zu Kleist in Beziehung gesetzt. Und er versucht immer wieder zeitgenössische Dokumente heranzuziehen, um Konfliktkonstellationen zu erhellen.
So konzentriert wie bei Kreutzer, der sich ganz auf die Form wirft, ist das selten. Und Kreutzer gelingen dann so wirklich in zwei, drei Sätzen interessante Einsichten. Jeder von uns kennt den Schluss des "Prinzen von Homburg", wo er sagt, "es ist ein Traum, ein Traum, was soll es?". Das zitiert man gerne. Und das zitiert man immer wieder so wie, na ja, wir haben uns also wieder mal getäuscht, wir sind jetzt desillusioniert.
Da sagt Kreutzer: Moment mal! Das spielt auf einen Psalmvers an. Und wenn man den einbezieht, dann kommt man zu der Einsicht, dass es im Grunde darum geht: Wenn unsere Wünsche erfüllt worden sind, dann werden wir völlig außer uns sein, wie die Träumer. – Das ist natürlich eine wirklich ganz andere Lesart des Homburg, die sich daraus ergibt. Und ich glaube, dass dieses Außer-sich-Geraten auch ein Ziel ist oder etwas, was man bei Kleist immer wieder beobachten kann. Und da sieht man, wie so durch Kleinigkeiten neue Lichter auf die Werke fallen.
Albath: Das hat mich auch ungeheuer beeindruckt, einfach die Rückbindung an das, was natürlich gelesen wurde und welches der Schatz war auch der Schriftsteller, auf denen sie ihre Werke aufgebaut haben. Und dass die Bibel omnipräsent war, ist ja ganz klar. Und das zeigt Kreutzer sehr schön.
Wie ist es denn mit diesem Gedanken, den Kleist ganz am Anfang verfolgt hat, der Bildung? Da gibt es ja die Verlobung mit Wilhelmine von Zenge und eigentlich versucht er dann sie zu erziehen. Da wird bei Blamberger auch sehr schön deutlich, während sich Michalzik eher darüber aufregt, dass das ein ganz klassisches Bild der Frau und der Ehe war, das damals bestand. War das für Sie eine Überraschung, das so zu lesen, oder hatten Sie diese Einschätzung auch schon, als Sie an Ihrer Biografie gearbeitet haben, Jens Bisky?
Bisky: So genau hab ich nicht gesehen, wie das in der aristokratischen Kultur verwurzelt ist. Das zeichnet Blamberger furios nach. Das muss man eigentlich lesen.
Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen. Kleist will eigentlich diese Wilhelmine erziehen. Und sie will auch erzogen werden. Selbst die trockenen Denkübungen und die Aufsatzthemen, die er ihr schickt, nennt sie ja später "die leidenschaftlichen Liebesbriefe", die sie bekommen habe. Aber es passiert Kleist etwas anderes: Indem er sie sozusagen nur als Empfängerin seiner Botschaften behandelt, beredet er doch alles, was ihr wichtig ist, mit ihr und richtet eine zeitlang seinen ganzen Lebensentwurf auf das Zweigespräch mit dieser Wilhelmine von Zenge aus, die sich natürlich dadurch überfordert gefühlt haben muss. Aber sie bekommt dadurch, während er die Briefe schreibt, eine viel höhere Position als Kleist ihr eigentlich theoretisch zugestehen würde. Man muss dazu auch sagen, dass mir völlig unklar ist, warum er sich verlobt hat. So eine Liebe auf den ersten Blick ist das nicht. Wilhelmine besetzt da eher eine Planstelle. Also, zu einem aufgeklärten Menschen gehört halt eine Frau und gehören Kinder und da muss ich jetzt eine Frau haben und dann muss ich die für ihre Planstelle auch erziehen. Und sobald er merkt, dass ihn die Vernunft nicht mehr leitet, dass dieses Lebensmodell so viel Sicherheit nicht bietet, wie er es erhofft hat, in dem Moment versucht er ja auch auszubüchsen und begibt sich auf Reisen, bis er dann in der Schweiz Bauer werden will und sie sagt, ihre Haut sei sonnenempfindlich. Da sagt er, das ist nun wirklich ein Trennungsgrund, und trennt sich ziemlich grob von ihr.
Albath: Das war dann wieder so ein Selbstentwurf von Kleist, der abwich von allem, was er vorher getan hat. Und Günter Blamberger identifiziert sich an dieser Stelle sehr stark mit Kleist und fordert eigentlich ein von Wilhelmine von Zenge, dass sie sich doch deutlicher zu ihm habe bekennen müssen. Das ist auch unterhaltsam.
Bisky: Das ist unterhaltsam. Ich halte es für völlig übertrieben. Man kann von Wilhelmine von Zenge nicht erwarten, dass sie einem preußischen Offizier ohne abgeschlossenes Hochschulstudium, ohne Pläne für ein Amt in die Schweiz, in der damals eine Art Bürgerkrieg unter französischer Beteiligung herrscht, hinterher fährt, weil er sagt, na ich habe ein paar Bücher über Landwirtschaft gelesen und will jetzt mich hier ankaufen und ein Gut machen, zumal damals gerade ihr Bruder gestorben ist, den Kleist auch kannte, und sie darüber in Trauer war. So einfach wie er konnte halt eine Frau und konnte Wilhelmine von Zenge nicht aus den ständischen Bindungen und aus ihrem Umkreis heraus. Ich halte es auch für eine übertriebene Forderung, das von ihr zu verlangen.
Ist es nicht großartig? Als sie sich nach diesem schlimmen Bruch wiedertreffen in Königsberg, ist sie ihm überhaupt nicht böse. Es gibt eigentlich kein böses Wort von ihr über ihn, und das, obwohl er sie doch – wenigstens am Ende – ziemlich rüde behandelt hat.
Albath: Daran merkt man aber, wie sehr sich auch die Biografen mit der Figur, über die sie schreiben, identifizieren.
Eine große Rolle bei beiden, bei Blamberger und bei Michalzik spielen natürlich dann die Freundschaften Kleists. Sie haben selbst schon einige erwähnt. Pfuel war besonders bedeutsam. Rühle ist ein anderer, viele, die dann preußische Offiziere geworden sind oder eine wichtige Rolle in Preußen gespielt haben.
Wie steht es mit den Freunden? Ist denen auch ein wesentlicher Teil gewidmet in diesen Biografien? Und bewerten die Biografen das so, wie Sie es auch einschätzen würden, Jens Bisky?
Bisky: Die Freunde spielen, und das geht gar nicht anders, in beiden Büchern die ihnen gebührende Rolle. Das sind vor allem Rühle von Lilienstern, ein rasend universal begabter und wirklich noch zu entdeckender Reiseschriftsteller, der Schlachten beschrieben hat. Eines der intelligentesten Bücher über die Schlacht bei Jena und Auerstedt ist der Bericht eines Augenzeugen von Rühle von Lilienstern. Er war nämlich ein Maler. Er hat übersetzt aus dem Griechischen. Er hat sich mit Kartographie sehr intensiv befasst, hat wahnwitzige, mir unverständliche leider, mathematische Pläne und Projekte entwickelt. – Das kommt alles vor.
Interessant ist die Frage, wie man etwa das Verhältnis zwischen Pfuel und Kleist bewertet. Schließlich schreibt Kleist den Anfang 1805, "sei du die Frau mir und die Kinder und die Enkel". Das ist nur eine Anspielung auf die Ilias von Homer. Und es ist, ich habe damals leicht übertrieben gesagt, "ein Heiratsantrag". Aber im Grunde steckt schon der Plan dahinter, zusammenzuleben in einer der Reformprovinzen Preußens, in Ansbach damals oder Bayreuth, wo Kleist gute Chancen hatte, hin versetzt zu werden.
Jetzt ist die Frage: Folgt daraus, dass er schwul war? Das ist eine Frage, die hätte Kleist nicht so richtig verstanden. Die hatten dieses Wort nicht dafür. Und als eine Lebensform eigenen Rechts war das auch nicht ausgeprägt. In der friderizianischen Kultur spielt es aber nicht die Rolle eines Tabus. Man hat sehr gerne darüber geredet. Sie wissen, es gibt auch eine endlose Diskussion über: war Friedrich der Große schwul? Und da sagt Christopher Clark in seinem tollen Preußenbuch zu Recht, das wissen wir nicht, aber er hat sehr gern darüber geredet.
Und jetzt hat Michalzik sozusagen eine Pointe und sagt, auch Kleist redet darüber und steigert sich sozusagen im Schreiben in etwas hinein, was nicht das Seine ist. Ich kann das nicht entscheiden. Er betreibt das – zumindest in diesem Brief – mit einem solchen ungeheuren Ernst und alle Möglichkeiten zum Ausdruck – ja, wie wollen wir es nennen – der Liebe zu einem Mann nutzend. Er nutzt alle Ausdrucksmöglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, sodass mir da doch etwas zu sein scheint.
Aber am Ende, und das müssen, glaub ich, beide Biografen auch zugestehen, ist es das merkwürdige Leben, das ständig in der Dichtung von der Liebe handelt und von unbedingtem Vertrauen in einer wirklich oft sehr erotischen sexualisierten Sprache. Und in Kleists Leben finden wir kaum eine geglückte Liebesbeziehung oder eigentlich gar keine. Das ist schon sehr merkwürdig. Das gehört für mich zu den Rätseln. Die beiden würden, wenn ich sie richtig verstehe, nur sagen, das ist alles in die Sprache, in die Dichtung gewandert.
Albath: Und die ist ja ungeheuer ausdrucksstark. Es gibt dieses große Zitat aus Penthesilea mit den Bissen und den Küssen, die eigentlich ein und dasselbe sind. Und das war auch etwas, was vollkommen neu war und was uns auch bis heute immer noch in Atem hält und verblüfft, dass damals diese Texte entstehen konnten.
Wie war es denn Ende des Lebens? 1811 war der Selbstmord. Kleist war plötzlich isoliert Anfang des Jahres. Erfährt man da Neues von Peter Michalzik oder Günter Blamberger?
Bisky: Man erfährt bei Michalzik einiges Neue über den Selbstmord selber, sie haben da ein Gemälde, das Kleist gesehen hat, nachgestellt. Und Günter Blamberger versucht ebenso wie Michalzik das als eine letzte Inszenierung darzustellen, in der Kleist noch einmal sich als Autor seines Lebens durchsetzt.
Eine Frage, die mir völlig offen geblieben ist, erst Recht in meinem eigenen Buch, ist die Frage: Warum braucht er zwei zum Sterben? Das ist für mich noch immer eine ungeklärte Frage. Er hat immer wieder mal mit Selbstmordgedanken gespielt. Es gibt einen sehr frühen wunderbaren Briefsatz an seinen Schwager, Verwandten, da schreibt er: "Ich bitte Gott um den Tod und dich um Geld" – in dieser Reihenfolge und so auf dieser Ebene bewegen sich die Selbstmordwünsche.
Wann immer es aber ernst wird, sucht er eine zweite Person, die mit ihm geht. Und dummerweise, muss ich sagen, findet er dann Henriette Vogel, die schwer krank ist. Die beiden sitzen und musizieren gemeinsam. Das kann man sehr schön bei Michalzik nachlesen, wie sie sozusagen in Todesbereitschaft singen. Und dann erschießt er sie und dann sich. Unklar bleibt mir immer noch: Warum hat er diese zweite Person gebraucht? Das wäre vielleicht mal Stoff für ein weiteres kleines Kleist-Buch.
Albath: Aber es ist ja auch schön, dass diese Geheimnisse immer bleiben. Und das zeichnet Kleist aus. Auch das inspiriert die vielen Biografen zu neuen Arbeiten.
Es gibt nicht nur viele Bücher zu Kleist und zu Kleists Leben, sondern auch eine neue Ausgabe der Kleist-Werke. Das ist die sogenannte Münchner Ausgabe, die im Carl Hanser Verlag erschienen ist und nur drei Bände umfasst. Was ist das für eine Ausgabe, Jens Bisky?
Bisky: Das ist die Ausgabe, nach der wir in Zukunft wahrscheinlich zitieren werden. Es ist ja so, ein großer Unstern waltet über Kleistausgaben und über Kleist-Manuskripten sowieso, von denen ein Großteil verloren gegangen ist. Einen Teil hat er selber noch vernichtet, also nahezu alles, was er bekommen konnte.
Was diese Münchner Ausgabe auszeichnet, ist, dass sie uns zum ersten Mal den Kleist so gibt, wie er geschrieben hat. Sie aktualisiert nicht die Rechtschreibung, die Zeichensetzung. Sie lässt auch irritierende Unregelmäßigkeiten stehen und überlässt es dem Leser, sich davon ein Bild zu nehmen, statt ihm vorlaut Interpreten an die Seite zu stellen, der sagt, so ist das gemeint, vollzieh das mal nach.
Da kann man sehr viel entdecken. Und das beruht auf der großen Brandenburger Kleist-Ausgabe, die Reuß und Staengle über Jahre hinweg veranstaltet haben. Man findet in dieser Münchner Kleist-Ausgabe, was wunderbar ist, sehr viele Dokumente zum Leben und zum Sterben Kleists, die man jetzt wirklich praktisch und schnell bei der Hand hat. Das ist wunderbar.
Was mich ein bisschen enttäuscht hat bei der Münchner Ausgabe, ist der Kommentar, der konzentriert sich vor allem auf den Text. Inhaltliche Verständnishilfen werden kaum gegeben. Nun muss man das nicht übertreiben. Es gibt beim Deutschen Klassikerverlag eine vierbändige Kleistausgabe, da können Sie manchmal Seiten über einzelne Stichworte lesen. Das ist vielleicht des Guten zu viel. Aber hier ist es mir doch entschieden zu wenig. Und ich hoffe, dass in der zweiten oder dritten Auflage der Münchner Ausgabe es da Nacharbeiten und Ergänzungen gibt.
Bisher haben wir ja im Regelfall die Ausgabe von Helmut Sendner zu Hause im Regal gehabt und haben die gelesen. Es war die gute Idee von Hanser, Sendner und den Radikalphilologen aus Heidelberg, also Reuß und Staengle, zu kombinieren, um sozusagen eine radikalphilologische Volksausgabe zu machen. Die wird jetzt die Standardausgabe von Kleists Werken, glaube ich, werden. Wie gesagt, ich wünsche mir sehr, dass man da den Kommentar wirklich hilfreicher macht.
Albath: Also, da werden dann diese radikalen Tendenzen von Kleist verbunden mit philologischem Handwerk. Diese Ausgabe liegt im Carl Hanser Verlag vor. Wir sprachen über verschiedene Biografien. "Heinrich von Kleist" von Günter Blamberger heißt eine. Sie ist im Fischer Verlag erschienen. Und "Kleist. Dichter, Krieger, Seelensucher" von Peter Michalzik liegt bei Propyläen vor. Diskutiert haben wir außerdem über Hans Joachim Kreutzer, "Heinrich von Kleist", erschienen bei C.H. Beck.
Jetzt haben wir noch etwas Zeit für einen Buchtipp. Was möchten Sie empfehlen, Jens Bisky?
Bisky: Ich möchte ein Buch empfehlen, das ich vor wenigen Tagen gelesen habe und das mich ungeheuer gefesselt und gepackt hat. Es ist das Englische Tagebuch, das Bärbel Bohley, die große, verstorbene Bürgerrechtlerin aus der DDR, im Grunde die Mutter der Herbstrevolution, wenn man es pathetisch sagen will, geschrieben hat als sie nach Verhaftung durch die Staatssicherheit in den Westen abgeschoben worden ist. Und sie beschreibt den Westen und ihren unbedingten Willen, wieder in die DDR zurückzukommen, um dort Veränderungen durchzusetzen. Die Stimmung und die Intelligenz, aus der heraus die Revolution im Herbst 89 entstanden ist, die lernt man hier wirklich auf eindrucksvolle Weise kennen.
Albath: Eine Empfehlung von Bisky: Bärbel Bohley, "Englisches Tagebuch 1988" heißt der Band. Der Verlag ist Basisdruck. Und mit diesem Buchtipp geht unsere Ausgabe der Lesart heute zu Ende. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Gast Jens Bisky für seinen Besuch und für das inflammierte Gespräch, wie es Kleist genannt hätte.
Am Mikrofon verabschiedet sich Maike Albath.
Mehr zum Thema bei dradio.de:
Ein übervolles und rastloses Leben: Ausstellung zum Kleist-Jahr
Theaterkritiker Peter Michalzik über Heinrich von Kleist
Kleist kickt immer noch - Berliner Intendant sieht viele Parallelen zum heutigen Lebensgefühl

Buchcover: "Heinrich von Kleist" von Günter Blamberger© Fischer
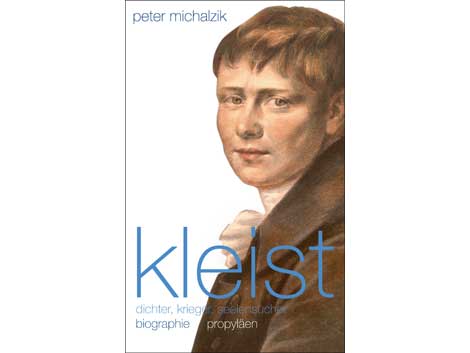
Buchcover: "Kleist" von Peter Michalzik© Propyläen Verlag
