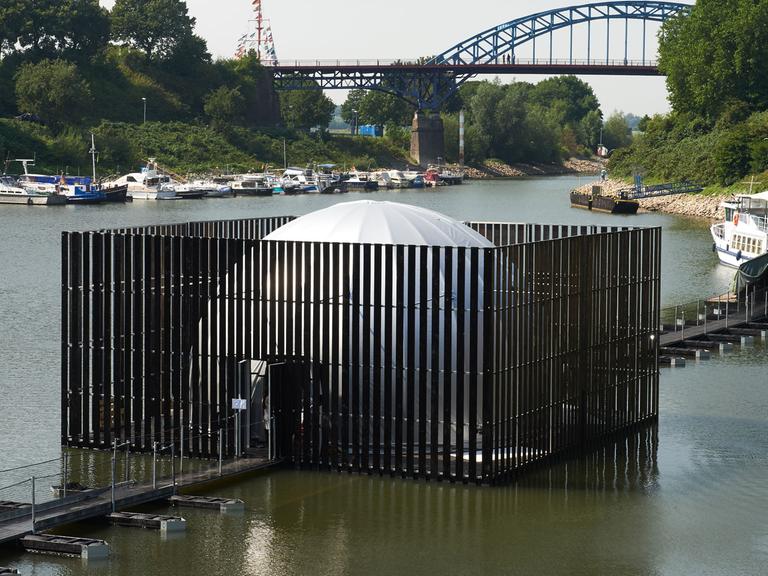Banalitäten bei Orpheus und Eurydike

Von Ulrike Gondorf · 20.08.2015
Eine Standseilbahn am Anfang und ein Bariton am Ende - mehr sei von Monteverdis Oper "Orfeo" auf der Ruhrtriennale nicht zu erwarten. Regisseurin Susanne Kennedy hat ein anstrengendes Gedankenexperiment angerichtet mit akustischen Schnipseln hier und da.
Es gibt zwei bezwingend starke Momente an diesem Abend. Der eine ist der Anfang. Über die Standseilbahn, auf der früher die Kohlen nach oben transportiert wurden, werden die Besucher in kleinen Gruppen in umgebauten Loren auf die oberste Plattform der Mischanlage in der Zeche Zollverein gezogen. Viele Meter unter ihren Füßen, durch einen Schacht zu sehen, sitzen die Mitglieder des Ensembles Kaleidoskop; Musik aus Monteverdis "Orfeo" klingt herauf. Von dort beginnt man den Abstieg durch die rußgeschwärzten Trichter im Inneren dieses turmartigen Gebäudes. Eisentreppen und Gänge erschließen diese labyrinthischen Räume. Dann warten die Besucher, jeweils höchsten acht Personen in einer Gruppe, vor einer weißen Tür auf Einlass. Über ihnen verlieren sich die Betonwände der Schächte im Dunkeln, über Kopfhörer hören sie Texte aus dem tibetanischen Totenbuch. Vom Übergang in eine andere Welt handeln sie, vom Loslassen, vom Abschiednehmen. Da ist man einen Moment ganz nah dran zu spüren, was der Weg in die Unterwelt sein könnte.
Aber das will Susanne Kennedy nicht mit ihrem "Orfeo". Von Orpheus will sie auch nichts, von der Musik fast nichts, mehr als ein akustischer Schnipsel hier und da ist an diesem Abend nicht zu hören. Das Interesse der Regisseurin und ihres Teams, zu dem auch die Performerinnen Suzan Boogaerdt und Bianca van der Schoot gehören, gilt nur Eurydike. Der Frau, die in diesem Zwischenreich angekommen ist, einem Reich der Untoten. In vielfacher Multiplikation tritt sie einem entgegen, lauter barbiepuppenhafte Blondinen mit Masken, die das ganze Gesicht mit einem Duplikat aus Plastik überziehen und nur die Augen frei lassen. Ebenso steril ihre Umgebung. Alles kulissenhaft billig und bunt, nachgebaute Zimmerchen mit Plastikblumen, Plastikstuck und Plastikstühlchen, oben offen wie für den Dreh einer ultrabilligen Daily Soap.
Eurydike in der Endlosschleife eines Alltags
Im ersten Zimmer sitzt eine Eurydike auf dem Sofa, im zweiten sitzen zwei an einem Küchentisch, im dritten steht eine unter der Dusche. Eurydike in der Endlosschleife eines besonders trost- und leblosen Alltags. Außer ihre jeweils acht Besucher unverwandt zu fixieren tun diese Untoten eigentlich nichts, manchmal kommt unvermittelt ein zweites Double herein und durchquert den Raum. Einmal steht man einem Streichquartett von Eurydiken gegenüber, das tatsächlich irgendwann in unendlich trägem Tempo die Instrumente stimmt. Hier und da hört man Fetzen aus Monteverdis "Orfeo"-Musik, das Ensemble Kaleidoskop sitzt unsichtbar in einem Zwischenraum dieser Höllenwohnung.
Dann ertönt ein Summgeräusch und eine Signallampe springt von Rot auf Grün, die Besuchergrüppchen machen sich durch einen engen dunklen Korridor auf zur nächsten Station. Ja, man versteht, dass Totsein bedeutet, aus der Zeit herauszufallen, und dass sich nichts mehr ereignen kann, dass es keine Identität und keine Veränderung mehr gibt. Dass der Limbus eine endlose Warteschleife sein muss. Aber das hat man schnell verstanden; wenn man das Programmheft liest, kann man noch ein paar kluge Gedanken dazu finden.
Das Problem ist: man erlebt nichts in diesem Theater. Nichts außer der Unbehaglichkeit, angestarrt zu werden, und der Verlegenheit der übrigen sieben Unterweltgäste in einer Besuchergruppe, und das, worüber man nachdenkt, sind absurde Banalitäten: wie kriegen die Performerinnen diese Masken übers Gesicht, können sie ihre wulstigen Lippen öffnen und die Kirschkerne, auf der sie in einer Sequenz herumbeißen, auch wieder ausspucken? Je mehr Zimmer man durchquert, umso distanzierter wird man.
Packend zum Schluss
Und dann kommt doch zum Schluss noch einmal ein Moment, der einen packt. Einzeln werden da die Besucher in einen Raum hineingelassen. Dort steht der Bariton Hubert Wild und singt einfach aus Monteverdis "Orfeo" – sehnsüchtig, verzehrend. Mit der Musik ist die Zeit zurück und das Leben. Aber dort wird man schnell wieder verscheucht.
Susanne Kennedy hat ein anstrengendes Gedankenexperiment angerichtet, das gar nichts bringt. Vor der emotionalen Wucht des Raums und vor den Dimensionen von Monteverdis Musik hat sie sich kleinmütig gedrückt und nichts dabei gewonnen. Wie es ist, tot zu sein, dazu kann auch sie verständlicherweise keine Phantasie entwickeln. Langweilig, mehr ist dazu offensichtlich nicht zu sagen. Monteverdi muss es auch schon gewusst haben. Deshalb ist der "Orfeo" nämlich die Geschichte eines Überlebenden.