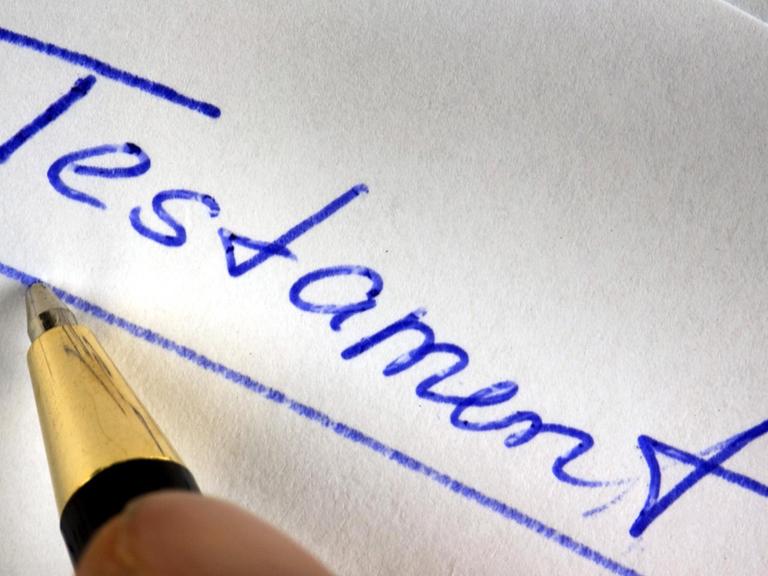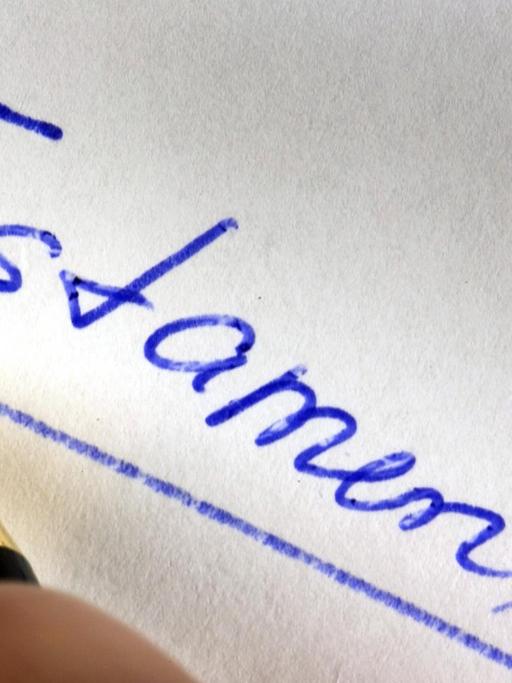Miek Zwamborn: Wir sehen uns am Ende der Welt
Aus dem Niederländischen von Bettina Bach
Nagel & Kimche, Zürich 2015
271 Seiten, 22,90 Euro
Das Gebirge als Suchbild

Von Peter Urban-Halle · 23.01.2016
Miek Zwamborn erzählt in ihrem neuen Buch die Geschichte einer Suche nach einem Verschollenen. Auf packende und wunderbar poetische Weise behandelt der Text das Verschwinden und Finden von etwas gänzlich Unerwartetem.
Die namenlose Ich-Erzählerin macht sich mit ihrem Freund Jens auf den Weg. Sie wollen in die Glarner Alpen, um den Tödi zu erklimmen, ein alter Traum. Die beiden verbindet eine tiefe, existentielle Beziehung. Ob es Liebe ist, wird nicht gesagt, aber sie sehnt sich danach, "mit ihm zusammen in die Berge und ins Nichts zu gehen". Das schaffen sie, aber anders als gedacht. Kaum sind sie zurück in Zürich, ist Jens verschwunden. Sie steht tatsächlich vor dem Nichts.
Schon in diesem Anfangskapitel gibt es einige Anzeichen für das Verschwinden. "Wie oft würden wir uns noch so wiedersehen?", fragt sie sich schon bei der Begrüßung. Auf dem Weg fühlt sie sich, als gäbe es zwischen ihrem Körper und dem Fels keinen Unterschied mehr, sie löst sich quasi auf. Beim Aufstieg gesteht Jens eine Krise: "In meinem Kopf ist kein Platz mehr für mich." Und einmal sagt er: "Jeder Berg wird einmal flach sein." Der sonderbare Satz ist ein Zitat des Schweizer Geologen Albert Heim. Aber das wissen wir an dieser Stelle noch nicht – auch nicht, dass dieser Heim im Laufe der Lektüre immer wichtiger wird und Jens irgendwann vergessen lässt.
Geologische Erforschung der persönlichen Schichten eines Menschen
Die Erzählerin fahndet nach Jens, indem sie die Orte und Museen aufsucht, an denen er selbst früher gewesen ist, zum Beispiel Oxford oder das Museum für Naturkunde in Berlin. Wie eine Geologin nach Erdzeitaltern forscht sie nach den persönlichen Schichten dieses Menschen, und legt sie nach und nach frei: "Ich schwebte von einem Ort zum andern." Und in den verschiedenen Museen halluziniert sie einen älteren Herrn mit weißem Bart und Gehstock, immer denselben. Es ist Albert Heim, der aber seit Langem tot ist.
Dieser Heim, der exakte Modelle verschiedener Alpmassive baut und die "Geheimnisse der Bergformationen enträtseln" will, ist ein sehr praktischer Mensch. In seinem Leben dreht sich alles um Anschauung und Wahrnehmung, ein wichtiges Instrument der Erkenntnis ist das Zeichnen, es ist für ihn "gleichbedeutend mit echtem Sehen". Heim fasziniert die Erzählerin immer mehr und mehr, und man hat auch den Eindruck, dass im selben Maße, in dem Heim den vermissten Jens ablöst, auch die namenlose Erzählerin in der Autorin Zwamborn aufgeht. Denn was für Heim das Zeichnen, ist für Miek Zwamborn das Schreiben: "gleichbedeutend mit echtem Sehen".
Eine Mischung aus Roman, Reisebericht, Essay und Biografie
Miek Zwamborn, 1974 bei Rotterdam geboren, hat lange Jahre im Engadin gelebt. Vorher hatte sie in Amsterdam Bildende Kunst studiert. Auch wohl deshalb hat ihr Buch (das Roman, Reisebericht, Essay, Biografie in einem ist) zahlreiche Abbildungen, die illustrieren und uns orientieren: Dokumente, Porträts oder Fotos von Blitzröhren, Windkantern und ähnlichen geologischen Seltsamkeiten. Andere besitzen aber auch eine eigene künstlerische Dimension. Man sieht auf ihnen bildlich, was wir im Text sprachlich gesehen haben: das Labyrinthische und Rätselhafte der Natur, die zahllosen Möglichkeiten zum Verschwinden und Verschluckt-Werden, das Gebirge als Suchbild. Ein wunderbares Buch, packend und innig, traurig und tröstlich, unprätentiös und poetisch.