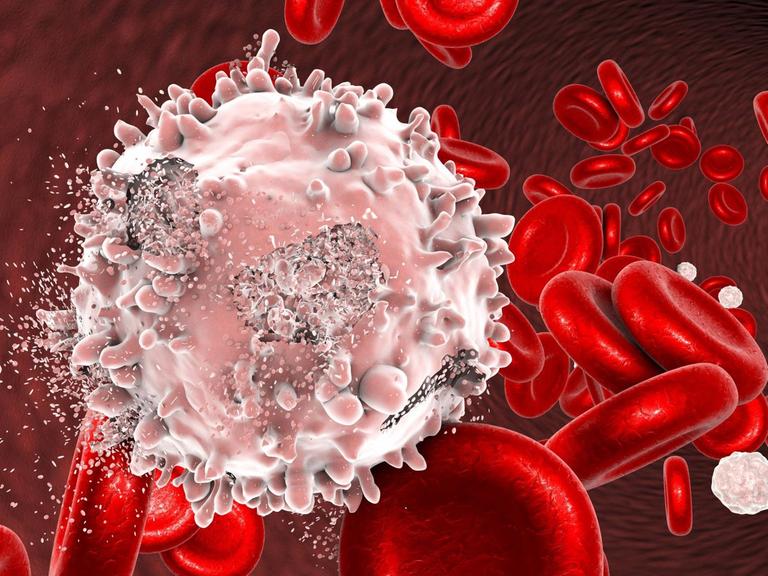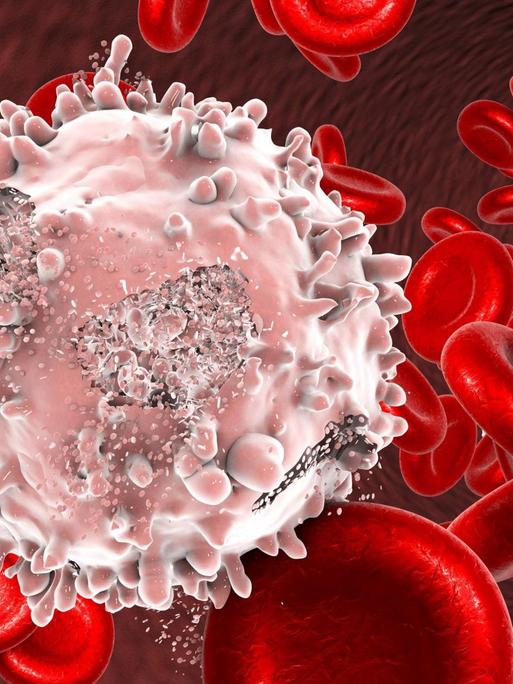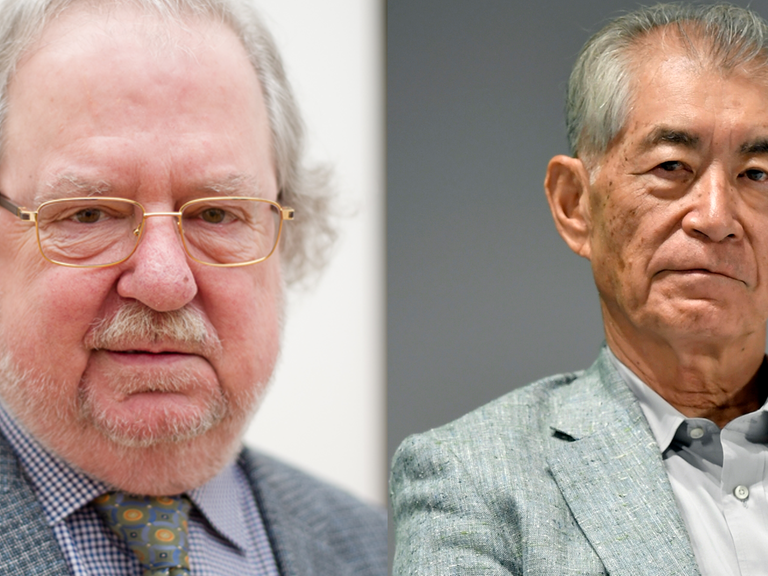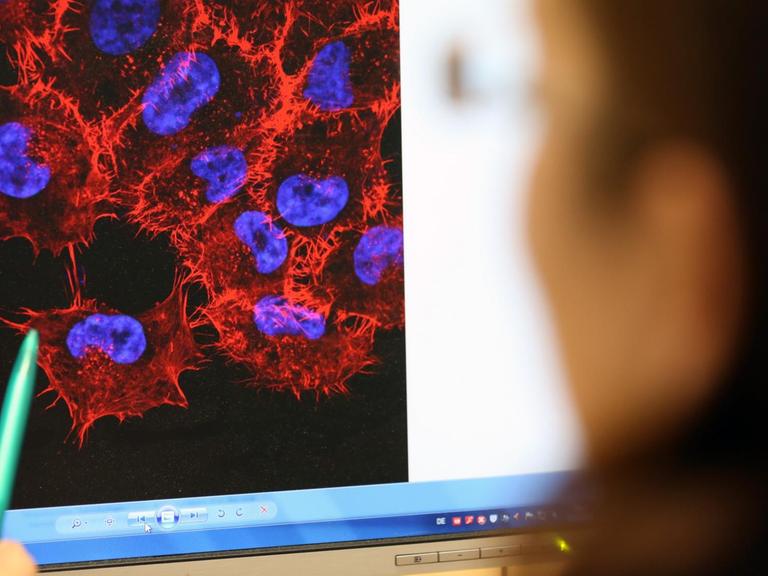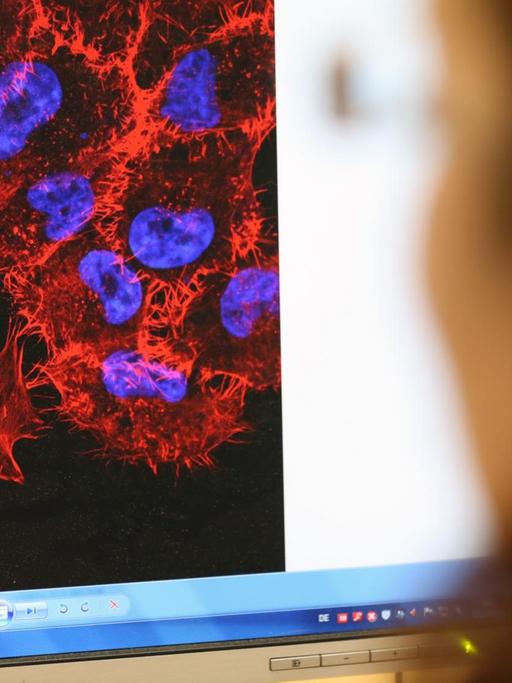Patienten nicht nur behandeln, sondern auch begleiten

Giovanni Maio im Gespräch mit Ute Welty · 04.02.2019
Der Medizinethiker Giovanni Maio fordert, die psychosoziale Betreuung von Patienten müsse eine größere Rolle in der Krebstherapie spielen. Ärzte dürften Therapie nicht nur technisch-medikamentös begreifen: "Zuwendung bringt mehr als Heilsversprechen".
Wenn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verkündet, in zehn bis zwanzig Jahren könne der Krebs besiegt sein, ist das für den Medizinethiker Giovanni Maio (Universität Freiburg) ein unseriöses Heilsversprechen.
"Krebs ist ganz unterschiedlich, in der Entstehungsform und überhaupt", sagte Maio im Deutschlandfunk Kultur. Insofern könne man nicht sagen, der Krebs würde besiegt. "Da hätte sich Herr Spahn ein bisschen besser informieren sollen."
Der Medizinethiker warnt Ärzte davor, Krebspatienten zu viel zu versprechen: "Sonst flüchten sich die Patienten in diese Erfolgserwartung und sind am Boden zerstört, wenn diese nicht eintritt."
Oft flüchten sich Ärzte in Aktion
Zudem fordert Maio, Krebstherapie nicht nur technisch-medikamentös zu begreifen: Zur Kunst der Medizin gehöre auch, eine Beziehung zum Patienten aufzubauen: "Deswegen gibt es nirgendwo den Punkt, wo man sagen kann, hier ist meine Kunst zu Ende. Nein! Ich kann sehr viel machen, bis zu letzten Stunde", betont er. "Diesen Blick auf das, was man machen kann bezogen auf die Zuwendung, die man schenken kann, bezogen darauf, dass man Patienten auch begleiten kann und nicht nur behandeln – das muss man noch mal stärken. Und auch in dem neuen Plan, jetzt gegen Krebs vorzugehen, finde ich, muss das viel stärker gemacht werden, dass wir auch eine psychosoziale Betreuung der Patienten brauchen."

Der Philosoph, Mediziner und Medizinethiker Giovanni Maio© dpa / picture alliance / Horst Galuschka
Statt auf die Interaktion mit den Patienten zu setzen, flüchteten Ärzte derzeit manchmal lieber in die Aktion, kritisiert der Medizinethiker. "Der Patient erhofft sich natürlich, dass man etwas macht, dass man etwas machen kann. Und die Ärzte haben es leichter, wenn sie sagen können: hier haben wir noch etwas, und wenn das gescheitert ist, haben wir noch etwas und noch etwas. Denn wenn man nichts mehr hat, was man medikamentös oder sonst durch Bestrahlungen oder Operationen machen kann, dann muss man sprechen, und das Sprechen kostet Zeit."
Die man in einer "fabrikartigen Durchschleusungsmedizin" jedoch oft nicht habe. Manchmal jedoch bringe Zuwendung mehr als Heilsversprechen: "Es geht nicht darum, Hoffnung nur dann spenden zu können, wenn man sagt, ich heile dich und es wird alles gut", so Maio.
"Sondern Hoffnung bedeutet ja, dem anderen das Gefühl zu geben: Selbst wenn die Therapie nicht greift, werde ich dennoch nicht fallengelassen. Dann wird nicht alles sinnlos, dann bin ich dennoch der Krankheit nicht ausgeliefert, weil, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auch mich selbst dazu zu verhalten und mein eigenes Leben zu leben, auch im Kranksein. Hoffnung bedeutet eben, aufzuzeigen, dass eben auch im Kranksein ein erfülltes Leben möglich ist. Und da gibt es viele Wege dahin. Man muss sich eben nur mit dem Patienten beschäftigen."
(uko)
Das Interview im Wortlaut:
Ute Welty: Mehr Prävention und mehr Früherkennung ist das Ziel des heutigen Weltkrebstages. Krebs zu behandeln, das kostet häufig viel Geld, hat oft starke Nebenwirkungen, und manchmal macht es den Eindruck, dass diese Therapien eher das Leiden denn das Leben verlängern. Muss immer alles gemacht werden, was gemacht werden kann? Mit dieser Frage setzt sich auch Giovanni Maio auseinander. Er leitet in Freiburg an der Albert-Ludwigs-Universität das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin. Guten Morgen, Herr Maio!
Giovanni Maio: Guten Morgen, Frau Welty!
Welty: Sie sagen, das erfüllte Leben ist nur möglich, wenn der Mensch einen guten Umgang mit der Grenze erlernt. Haben wir also verlernt zu sterben?
Maio: Nun, wir haben nicht verlernt zu sterben, aber es ist eben wichtig, dass man lernt, auch mit Krankheit zu leben. Darum geht es.
Welty: Lässt sich denn generell bestimmen, wann eine teure und aufwendige Krebstherapie sinnvoll ist und wann nicht? Lässt sich so was wie eine Leitlinie ausmachen?
Maio: Generell lässt sich das nicht bestimmen, es kommt immer auf den Einzelfall an. Es kommt darauf an, in welcher Situation sich ein Patient befindet. Grundsätzlich können wir ja froh sein, dass wir neue therapeutische Möglichkeiten haben, und diese auszuschöpfen, zu versuchen, auch den Krebs eben soweit vielleicht in Schach zu halten oder gar zu heilen, das ist ja sehr sinnvoll und sehr nützlich. Nur irgendwann kommt die Grenze, ab der man sagen muss, hier ist eben die Therapie selber, die medikamentöse Therapie eher eine Belastung, als das etwas brächte. Und das kann man nur im Einzelfall entscheiden. Da kann man nicht einfach nur nach großen Algorithmen vorgehen, das wäre nicht richtig.
Eine durchrationalisierte Medizin tut nicht gut
Welty: Wer blockiert denn eher, dass es eben auch die Möglichkeit des Verzichtes auf Therapie gibt und dass die in Erwägung gezogen werden kann? Sind das mehr die Ärzte oder mehr die Patienten?
Maio: Das ist eine Symbiose, denn der Patient erhofft sich natürlich, dass man etwas macht, dass man etwas machen kann. Und die Ärzte haben es leichter, wenn sie sagen können, hier haben wir noch etwas, und wenn das gescheitert ist, haben wir noch etwas und noch etwas, denn wenn man nichts mehr hat, was man medikamentös oder sonst durch Bestrahlung oder Operationen machen kann, dann muss man sprechen. Und das Sprechen kostet Zeit, das Sprechen ist schwieriger, und insofern flüchtet man manchmal, lieber in die Aktion als in die Interaktion zu investieren. Das ist das große Problem. Je mehr Zeit Sie den Ärzten geben, desto schneller wird man auch über die Grenze sprechen. Aber eine durchrationalisierte Medizin, bei der wenig Zeit übrig bleibt, in einer solchen Medizin flüchtet man in den Aktionismus und macht ganz viel, weil das Gespräch fehlt. Das ist das große Problem.
Welty: Wie schwer fällt es Ärztinnen und Ärzten auch einzugestehen, dass sie mit ihrer Kunst irgendwann am Ende sind?
Maio: Die Kunst in der Medizin im Sinne dessen, dass man etwas können muss, besteht ja darin, sowohl technisch und medikamentös interventionell vorzugehen als auch eine Beziehung aufzubauen – auch das gehört zur Kunst der Medizin. Deswegen gibt es nirgendwo den Punkt, wo man sagen kann, hier ist meine Kunst zu Ende. Nein, ich kann sehr viel machen, bis zur letzten Stunde. Diesen Blick auf das, was man machen kann, bezogen auf die Zuwendung, die man schenken kann, bezogen darauf, dass man Patienten auch begleiten kann und nicht nur behandeln, das muss man noch mal stärken. Und auch in dem neuen Plan jetzt, gegen Krebs vorzugehen, finde ich, muss das viel stärker gemacht werden, dass wir auch eine psychosoziale Betreuung der Patienten brauchen und nicht nur eine technisch-medikamentöse.
Welty: Was können denn Ärzte tun, um ihre Patienten darauf aufmerksam zu machen, dass weniger manchmal mehr ist?
Maio: Man muss frühzeitig darüber sprechen, was eben die medikamentöse Therapie, also die Chemotherapie, die Antikörper und so weiter, was sie denn bewirken können und was sie eben nicht können. Man spricht immer über die Potenziale, aber ich finde, es ist eben wichtig, von Anfang an darüber zu sprechen, dass die Erfolgsaussichten relativ gering sind, ohne deswegen die Hoffnung zu rauben. Aber oft wird eben doch zuweilen den Patienten zu viel versprochen, weil es eben einfach ist, etwas zu versprechen. Man müsste gleich aufzeigen, die Statistik ist so, dass man eigentlich nur in einem geringen Prozentsatz mit einer Besserung rechnen kann. Darüber muss man am Anfang sprechen, sonst flüchten die Patienten sich in diese Erfolgserwartung und sind am Boden zerstört, wenn diese nicht eintritt.
Auch im Kranksein ist erfülltes Leben möglich
Welty: Wo können Ärzte das denn lernen, auf der einen Seite ja realistisch zu sein und eben die Hoffnung nicht zu nehmen?
Maio: Ja, das ist eben sehr wichtig, den Begriff der Hoffnung genau zu fassen. Es geht ja nicht darum, Hoffnung nur dann spenden zu können, wenn man sagt, ich heile dich und es wird alles gut, sondern Hoffnung bedeutet ja, dem anderen das Gefühl zu geben, selbst wenn die Therapie nicht greift, werde ich dennoch nicht fallen gelassen. Dann wird nicht alles sinnlos, dann bin ich dennoch der Krankheit nicht ausgeliefert, weil dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auch mich selbst dazu zu verhalten und mein eigenes Leben zu leben, auch im Kranksein. Hoffnung bedeutet aufzuzeigen, dass eben auch im Kranksein ein erfülltes Leben möglich ist. Und da gibt es viele Wege dahin, man muss eben sich nur mit dem Patienten beschäftigen.
Welty: Immer wieder wird ja vom mündigen Patienten gesprochen, aber wie mündig kann man sein angesichts der Diagnose einer lebensbedrohlichen oder gar tödlichen Krankheit?
Maio: Ja, am Anfang, in der Tat natürlich fällt man da in ein tiefes Loch. Man ist absolut schockiert und der Boden wird einem weggezogen. Am Anfang kann man wirklich nicht von Mündigkeit in dem Sinne sprechen. Am Anfang ist man sehr hilfsbedürftig, aber dann fängt man sich, und dann fängt man an zu überlegen, was kann man alles tun. Und da ist es eben wichtig, dass man die Patienten stützt und sie langfristig begleitet. Patienten brauchen am Anfang im Schockzustand Menschen, die mit ihnen sprechen. Sie müssen eben von Menschen begleitet werden, die davon überzeugt sind, dass die Zuwendung manchmal viel mehr bringt als Heilsversprechen.
Welty: Kommt es denn häufig vor, dass Ärzte Maßnahmen ergreifen, von denen sie selbst gar nicht so überzeugt sind?
Maio: Es kommt drauf an, wie viel Zeit sich die Ärzte nehmen können, wie viel das System ihnen auch an Zeit gibt und was für eine Beziehung entfaltet worden ist. In einer Vertrauensbeziehung werden die Ärzte eben auch über die Grenzen sprechen können, aber wenn sie eine fabrikartige Durchschleusungsmedizin haben, dann wird man oft auch Unnötiges machen, allein weil die Zeit zum Sprechen fehlt. Wenn Sie eben sagen wollen, hier müssten wir eigentlich aufhören, dann können Sie das nicht einfach in fünf Minuten sagen, Sie müssten eine Stunde investieren. Und wenn diese Stunde fehlt, dann werden Sie lieber sagen, ach, wir machen lieber weiter, als dass wir jetzt sprechen. Das ist das Problem.

"Herr Spahn hätte sich ein bisschen besser informieren sollen", meint Giovanni Maio.© picture alliance / Fabian Sommer
Welty: Und gesprochen hat der Bundesgesundheitsminister. Jens Spahn sagte, dass die Chancen gut stünden, in zehn oder 20 Jahren den Krebs zu besiegen. Damit haben sich etliche Mediziner nicht einverstanden erklärt. Werden mit solchen Versprechungen falsche Hoffnungen geweckt?
Maio: Aber unbedingt, so was ist ja unseriös, und solche Heilsversprechen zu verkünden, finde ich nun wirklich nicht gut. Also da hätte sich Herr Spahn ein bisschen besser informieren sollen, denn es ist ja so, dass wir nicht den Krebs haben, Krebs ist ganz unterschiedlich in der Entstehungsform und überhaupt. Wir können nicht sagen, wir werden den Krebs einfach besiegen. Es geht eben darum, dass wir ihn besser verstehen sollten, und das, was wir leisten können, sind nur kleine Schritte. Die personalisierte Medizin, sie wird wirklich Fortschritte bringen, in der Tat, dass aus dem Krebs eben nicht einfach eine heilbare Krankheit wird, aber zumindest eine chronische Krankheit, das wird man sicher erreichen, Zug um Zug. Aber den Krebs besiegen, das ist nun wirklich unseriös, so was zu behaupten.
Welty: Medizinethiker Giovanni Maio am Weltkrebstag im "Studio 9"-Gespräch. Ich danke Ihnen!
Maio: Ich danke Ihnen, Frau Welty!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.