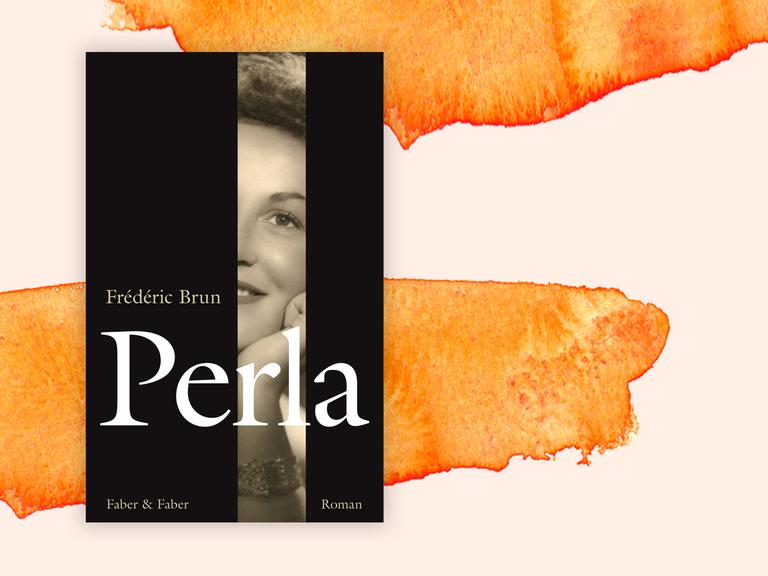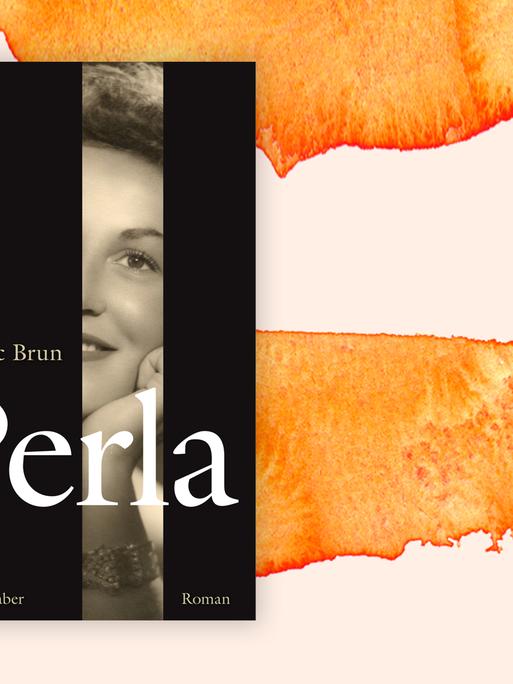Maya Lasker-Wallfisch: "Briefe nach Breslau. Meine Geschichte über drei Generationen"
Aus dem Englischen von Marieke Heimburger
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020
254 Seiten, 24 Euro
Die grausame Wucht des Traumas
04:51 Minuten

Von Gabriele von Arnim · 11.06.2020
Maya Lasker-Wallfischs Mutter ist der Ermordung in Auschwitz nur knapp entkommen. Sprechen wollte sie über das Erlebte nicht. Die Tochter hat nun eine ebenso klare wie berührende Sprache gefunden, um aus dem verheerenden Schweigen auszubrechen.
In ihrer Familie sei sie unsichtbar, hat Maya Lasker-Wallfisch vor einigen Jahren in einem Interview gesagt. Im Hause ihrer Eltern wurde musiziert, war Musik die gemeinsame Sprache. Aber es war nicht ihre.
Ihr Bruder wurde Cellist und gedieh. Sie stand abseits und ging zugrunde. Denn sie spürte Wunden, die die anderen zu verbergen suchten. Wurde heimgesucht von einem Grauen, das sie nicht entziffern konnte.
Jetzt erzählt sie in ihrem Buch, wie sie, die Tochter der Auschwitz-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch, litt unter dem, was wir heute als transgenerationale Übertragung von Traumata kennen.
Drogensüchtig, kriminell, unglücklich
"Normal" sei eines der Lieblingswörter ihrer Mutter gewesen, schreibt sie. Die Frau, die als Cellistin im Mädchenorchester von Auschwitz der Ermordung nur knapp entkommen ist und selber einmal gesagt hat, dass Auschwitz sie nie verlassen habe, diese Frau wollte Normalität. Ein normales Leben führen nach dem Überleben. Wollte ihre Kinder nicht belasten und schwieg über das, was sie als Erinnerung in sich trug.
Doch das Trauma war im Schweigen lebendig und übertrug sich auf Maya. Mit einer grausamen Wucht, die sie in ihrem so radikalen wie zarten Buch nun zu entschlüsseln sucht.
Aufgewachsen "in der Landschaft eines unsichtbaren Todes", hat sie den Schrecken ausgelebt, den ihre Mutter in den Panzer der angeblichen Normalität eingeschlossen hatte. "Stell dich nicht so an", sagt die, wenn es dem Kind nicht gut geht und es nicht erklären kann, was ihm fehlt. Natürlich sagt sie das – was sind die Kümmernisse des Kindes nichtig im Vergleich zu ihren Erlebnissen im Holocaust.
Das Kind fühlt sich unverstanden, schuldig, fremd, anders. Wird drogensüchtig, kriminell, unglücklich. Und das über Jahrzehnte. Mit großer Offenheit und Sensibilität beschreibt Maya Lasker-Wallfisch ihren Weg in den Schlund der Selbstzerstörung.
Kein Buch der Abrechnung
Über Jahrzehnte scheint ihr Schicksal fast ausweglos. Bis Anita anfängt zu reden und Maya anfängt zu verstehen. Sie wird erst Sucht-, dann Psychotherapeutin, hilft anderen und sich selbst.
Als sie einmal in Hamburg spazieren geht, fängt sie an im Geiste mit ihren Großeltern zu sprechen, die 1942 ermordet wurden und von denen sie kaum etwas weiß. Und in dem Moment entsteht die Idee, den Toten Briefe zu schreiben, sie kennenzulernen, ihnen zu erzählen, über das Leben ihrer Töchter, was sie erlitten, was sie überlebt haben, wie sie weiterlebten. Und zu schreiben über sich. Eine Verbindung herzustellen zwischen den Toten und den versehrt Lebenden, eine Verbindung zwischen den drei Generationen.
Die Autorin findet eine ebenso klare wie berührende Sprache, um auszubrechen aus dem verheerenden Schweigen. Um all das den Großeltern zu erzählen, was sie so viele Jahrzehnte von ihrer Mutter nicht hörte.
Sie schildert unumwunden die brüske Art ihrer Mutter und klagt dennoch nicht an. Es ist kein Buch der Wut, der Abrechnung, des Zorns, sondern eine Erzählung der Verzweiflung, der nachgetragenen Trauer, der Zärtlichkeit. Erst durch das Schreiben, sagt die 62-jährige Maya Lasker-Wallfisch, wisse sie, wer sie sei, erst jetzt könne sie sich sehen und werde gesehen.