Lockruf des neuen Körpergefühls
Viele britische Intellektuelle waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Deutschland fasziniert. Während in England eine rigide Moral herrschte, galten die deutschen Sitten als liberal und freier. Der Kunsthistoriker Wolfgang Kemp wartet mit interessanten Details auf.
Ende der 1920er-Jahre, in Evelyn Waughs Roman "Vile Bodies", geht ein frisch getrautes Paar auf Hochzeitsreise. Vom Flugzeug aus fällt ein letzter Blick auf die Heimat. Er, Ginger, erinnert sich undeutlich an Verse zum Ruhme Englands, die er in der Schule auswendig lernen musste. Von einem "edlen Stamm von Menschen" ist da die Rede und von einem "in die Silbersee eingefassten Edelstein", Verse aus Shakespeares Drama "Richard II." Ginger hat schulmäßige Gedanken, seine Frau den freieren Blick:
"Nina schaute nach unten und blickte aus schräger Sicht auf einen weitläufigen roten Vorort, auf Hauptstraßen mit kleinen Autos, auf Fabriken, einige davon in Betrieb, andere leerstehend und verfallend, auf einen nicht mehr benutzten Kanal. In der Ferne Hügel mit Bungalows übersät, Radiosendemasten und Überlandkabel, Männer und Frauen, die nur noch als winzige Punkte erkennbar waren, sie heirateten und gingen einkaufen und machten Geld und hatten Kinder. Die Szenerie taumelte und kippte vor ihren Augen, als das Flugzeug auf eine Luftströmung traf.
‚Ich glaube, mir wird schlecht’, sagte Nina."
Immer schon war Going native, das Abstreifen der zivilisatorischen Zwänge, ein Motiv englischen Lebens. Man ging in die Kolonien, trieb sich in der Welt herum, zog vielleicht dauerhaft nach Frankreich oder Italien. Nach dem Ersten Weltkrieg verstärkt sich das. Die alte Ordnung scheint bestätigt, aber das erfüllt das Land nicht mit Stolz und Tatkraft. Im Gegenteil, England ist teuer, die Moral rigide, eine "schwere Decke aus Mutlosigkeit und Frustration" liegt über dem Land, "where nobody is well", wie W. H. Auden schreibt. Ausland bedeutet Befreiung und Deutschland, ausgerechnet Deutschland, bedeutet höchste Freiheit. So brechen viele Engländer, gerade auch Schriftsteller, dorthin auf.
Es ist eine sehr merkwürdige Beziehung, mit der Wolfgang Kemp seine Leser bekannt macht. Sein Buch will nicht eine neue Studie zur Vorurteils- oder Fremdheitsforschung sein, es nimmt - eher thesenarm - durch eine Menge interessanter Details für sich ein. Hören wir D. H. Lawrence, den Autor von "Lady Chatterleys Liebhaber", der 1924 den Rhein ostwärts überquert, nach Deutschland:
"In der Nacht spürt man merkwürdige Dinge, die sich in der Dunkelheit rühren, seltsame Gefühle, die sich aus diesem noch unbezwungenen Schwarzwald heraus regen. Der Rücken wird einem steif und man lauscht hinaus in die Nacht … Aus der Luft selbst kommt ein Gefühl der Gefahr, ein sonderbares, stachliges Gefühl einer unheimlichen Gefahr. Etwas ist geschehen, das noch nicht endgültige Gestalt angenommen hat. Der alte Zauber der alten Welt ist gebrochen, und der alte widerborstige, wilde Geist regt sich wieder."
Zwei Klassiker des Deutschland-Bildes steigen hier auf: Da ist das Deutschland der dichten, unheimlichen Wälder, die schon die Römer geängstigt hatten. Aber es ist auch das Land der Freiheit, die aus den Wäldern des Nordens kommt, wie es bei Montesquieu heißt. Freiheit ist das große Motiv der englischen Deutschland-Fahrer. Und Freiheit meint: persönliche Freiheit. Lawrence erlebt hier und mit seiner deutschen Frau Frida von Richthofen seine sexuelle Erweckung. Ford Madox Ford, Autor des wunderbaren Romans "Die allertraurigste Geschichte", sucht schon vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland Lösung aus seiner Ehe; das deutsche Scheidungsrecht ist weit einfacher, schneller, liberaler als das britische. Und darüber hinaus sind die berühmten Heilbäder, in denen die ganze Welt zusammenkommt, für den ständig sich neu zerrüttenden Ford wichtig.
Dass Deutschlands so viele Thermalquellen hat, das ist eine bloß geologische Tatsache. Aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts passt diese Tatsache zu dem Eindruck, Deutschland sei das Land eines neuen Körpergefühls, der Gesundheit, der Lebensreform. Vieles scheint freier, frischer als in den Nachbarländern mit ihren unangetasteten Traditionen. Besonders für Homosexuelle ist das attraktiv. "Berlin hieß Jungs" schreibt Christopher Isherwood. Die Jungs sind nicht immer die vornehmsten, Stricher gehören dazu, einige versuchen nach Kräften, ihre englischen Freunde auszunehmen. In einem auf deutsch verfassten Gedicht W. H. Audens heißt es:
"Denn jede Liebe hat ihr eigene Lage
Und jeder Art von Liebe denkt an sich;
Weil ich kein Geld hab’ komm ich nicht in Frage,
Du liebst dein Leben und ich liebe Dich."
Aber selbst solcher Egoismus scheint den Engländern noch besser, gerader, ehrlicher als ihr eigenes bürgerliches Vorteilsstreben.
Ums Leben in seiner körperlichen Form geht es; Deutschlands künstlerisches, theoretisches, wissenschaftliches Leben interessiert nicht. Die Männer der Auden-Group, zu der Isherwood und Stephen Spender zählen, werden nach Jahren in Deutschland gerade zwei intellektuell bestimmende Köpfe kennengelernt haben, den Sexualforscher Magnus Hirschfeld und den Philologen Ernst Robert Curtius.
Thomas Mann, Brecht, Musil, Benn, die Musik, das neue Bauen, das alles gewinnt keinerlei Bedeutung für sie. Es ging ihnen um eine schöne Zeit in Deutschland, schreibt Kemp, am geistigen Leben ihres Gastlandes nahmen sie nicht Anteil. Woran das lag? Eine Rolle spielt die englische Neigung, in kleinen Kolonien unter sich zu bleiben. Und vielleicht waren die vitalen Reize Deutschlands einfach übermächtig. Merkwürdig bleibt der Befund; französische Beobachter wie der Bildhauer Aristide Maillol haben ganz anders reagiert. Eine schlüssige Erklärung für die englische Besonderheit hat zuletzt auch Wolfgang Kemp nicht.
Wolfgang Kemp: "Foreign Affairs. Die Abenteuer einiger Engländer in Deutschland 1900-1947"
C. Hanser Verlag, München 2010
384 Seiten, 24,90 Euro
"Nina schaute nach unten und blickte aus schräger Sicht auf einen weitläufigen roten Vorort, auf Hauptstraßen mit kleinen Autos, auf Fabriken, einige davon in Betrieb, andere leerstehend und verfallend, auf einen nicht mehr benutzten Kanal. In der Ferne Hügel mit Bungalows übersät, Radiosendemasten und Überlandkabel, Männer und Frauen, die nur noch als winzige Punkte erkennbar waren, sie heirateten und gingen einkaufen und machten Geld und hatten Kinder. Die Szenerie taumelte und kippte vor ihren Augen, als das Flugzeug auf eine Luftströmung traf.
‚Ich glaube, mir wird schlecht’, sagte Nina."
Immer schon war Going native, das Abstreifen der zivilisatorischen Zwänge, ein Motiv englischen Lebens. Man ging in die Kolonien, trieb sich in der Welt herum, zog vielleicht dauerhaft nach Frankreich oder Italien. Nach dem Ersten Weltkrieg verstärkt sich das. Die alte Ordnung scheint bestätigt, aber das erfüllt das Land nicht mit Stolz und Tatkraft. Im Gegenteil, England ist teuer, die Moral rigide, eine "schwere Decke aus Mutlosigkeit und Frustration" liegt über dem Land, "where nobody is well", wie W. H. Auden schreibt. Ausland bedeutet Befreiung und Deutschland, ausgerechnet Deutschland, bedeutet höchste Freiheit. So brechen viele Engländer, gerade auch Schriftsteller, dorthin auf.
Es ist eine sehr merkwürdige Beziehung, mit der Wolfgang Kemp seine Leser bekannt macht. Sein Buch will nicht eine neue Studie zur Vorurteils- oder Fremdheitsforschung sein, es nimmt - eher thesenarm - durch eine Menge interessanter Details für sich ein. Hören wir D. H. Lawrence, den Autor von "Lady Chatterleys Liebhaber", der 1924 den Rhein ostwärts überquert, nach Deutschland:
"In der Nacht spürt man merkwürdige Dinge, die sich in der Dunkelheit rühren, seltsame Gefühle, die sich aus diesem noch unbezwungenen Schwarzwald heraus regen. Der Rücken wird einem steif und man lauscht hinaus in die Nacht … Aus der Luft selbst kommt ein Gefühl der Gefahr, ein sonderbares, stachliges Gefühl einer unheimlichen Gefahr. Etwas ist geschehen, das noch nicht endgültige Gestalt angenommen hat. Der alte Zauber der alten Welt ist gebrochen, und der alte widerborstige, wilde Geist regt sich wieder."
Zwei Klassiker des Deutschland-Bildes steigen hier auf: Da ist das Deutschland der dichten, unheimlichen Wälder, die schon die Römer geängstigt hatten. Aber es ist auch das Land der Freiheit, die aus den Wäldern des Nordens kommt, wie es bei Montesquieu heißt. Freiheit ist das große Motiv der englischen Deutschland-Fahrer. Und Freiheit meint: persönliche Freiheit. Lawrence erlebt hier und mit seiner deutschen Frau Frida von Richthofen seine sexuelle Erweckung. Ford Madox Ford, Autor des wunderbaren Romans "Die allertraurigste Geschichte", sucht schon vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland Lösung aus seiner Ehe; das deutsche Scheidungsrecht ist weit einfacher, schneller, liberaler als das britische. Und darüber hinaus sind die berühmten Heilbäder, in denen die ganze Welt zusammenkommt, für den ständig sich neu zerrüttenden Ford wichtig.
Dass Deutschlands so viele Thermalquellen hat, das ist eine bloß geologische Tatsache. Aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts passt diese Tatsache zu dem Eindruck, Deutschland sei das Land eines neuen Körpergefühls, der Gesundheit, der Lebensreform. Vieles scheint freier, frischer als in den Nachbarländern mit ihren unangetasteten Traditionen. Besonders für Homosexuelle ist das attraktiv. "Berlin hieß Jungs" schreibt Christopher Isherwood. Die Jungs sind nicht immer die vornehmsten, Stricher gehören dazu, einige versuchen nach Kräften, ihre englischen Freunde auszunehmen. In einem auf deutsch verfassten Gedicht W. H. Audens heißt es:
"Denn jede Liebe hat ihr eigene Lage
Und jeder Art von Liebe denkt an sich;
Weil ich kein Geld hab’ komm ich nicht in Frage,
Du liebst dein Leben und ich liebe Dich."
Aber selbst solcher Egoismus scheint den Engländern noch besser, gerader, ehrlicher als ihr eigenes bürgerliches Vorteilsstreben.
Ums Leben in seiner körperlichen Form geht es; Deutschlands künstlerisches, theoretisches, wissenschaftliches Leben interessiert nicht. Die Männer der Auden-Group, zu der Isherwood und Stephen Spender zählen, werden nach Jahren in Deutschland gerade zwei intellektuell bestimmende Köpfe kennengelernt haben, den Sexualforscher Magnus Hirschfeld und den Philologen Ernst Robert Curtius.
Thomas Mann, Brecht, Musil, Benn, die Musik, das neue Bauen, das alles gewinnt keinerlei Bedeutung für sie. Es ging ihnen um eine schöne Zeit in Deutschland, schreibt Kemp, am geistigen Leben ihres Gastlandes nahmen sie nicht Anteil. Woran das lag? Eine Rolle spielt die englische Neigung, in kleinen Kolonien unter sich zu bleiben. Und vielleicht waren die vitalen Reize Deutschlands einfach übermächtig. Merkwürdig bleibt der Befund; französische Beobachter wie der Bildhauer Aristide Maillol haben ganz anders reagiert. Eine schlüssige Erklärung für die englische Besonderheit hat zuletzt auch Wolfgang Kemp nicht.
Wolfgang Kemp: "Foreign Affairs. Die Abenteuer einiger Engländer in Deutschland 1900-1947"
C. Hanser Verlag, München 2010
384 Seiten, 24,90 Euro
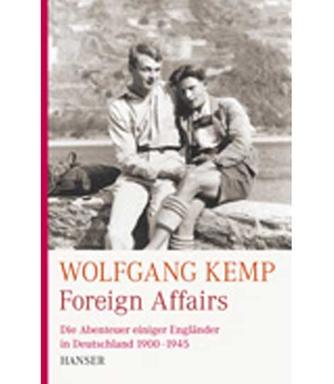
Cover "Foreign Affairs" von Wolgang Kemp© C. Hanser Verlag
