Kurz und kritisch
"Die Epoche der Intellektuellen" zeigt eine Begriffs- und Sozialgeschichte. In "Literatur, die Geschichte schrieb" geht es um Bücher, die historisch bedeutend waren. "Solange das Imperium da ist" ist ein hinreißendes Gespräch mit Carl Schmitt.
Dietz Bering: Die Epoche der Intellektuellen
Berlin University Press.
Von "den Intellektuellen" hat man lange nichts gehört. Nun gibt es wieder mal ein Buch über sie. Das kann man als Nachruf verstehen. "Geburt, Begriff, Grabmal" heißt es im Untertitel. Der Autor Dietz Bering versucht zweierlei: eine Begriffs- und eine Sozialgeschichte. Er eröffnet mit Dreyfus. Das ist naheliegend, aber eigentlich zu kurz, zu modern gegriffen. Waren Marx und Engels und auch die Humboldt-Brüder keine Intellektuellen? Oder die Leute im Umkreis der Französischen Revolution, Babeuf zum Beispiel, oder deren Wegbereiter, Rousseau, d’Alembert, Voltaire? Wie wäre es mit Montesquieu oder und vor allem Montaigne? Und Hobbes und Melanchthon, waren die nicht geradezu prototypische Intellektuelle? War nicht das Ganze klassische Griechenland ein Intellektuellen-Nest? Berings Begriff ist weniger systematisch und geistesgeschichtlich gefaßt als politisch und praktisch. Das reicht ja auch.
Man muss es nur wissen. Der Autor hat vor allem die aktuellere deutsche, westdeutsche, Szene im Blick. DDR-Intellektuelle kommen nicht vor. "Westdeutsche Linksintellektuelle nach 1945" müsste das Buch heißen. Offenbar sind für ihn die Leute der Gruppe 47 und die 68er die wahren Intellektuellen. Dass er den Publizisten Melvin Lasky einen "Deutsch-Amerikaner" nennt, ist eine bezeichnende Panne. Offenbar hat Bering vieles aus der eigenen Biografie geschöpft, aus der eines ideologisch festgelegten 68ers. In diesem Sinne dürfte das Buch als Nachschlagewerk gute Dienste leisten, 756 Seiten mit Literatur- und Personenverzeichnis und Register.
Dirk van Laak: Literatur, die Geschichte schrieb
Vandenhoeck & Ruprecht
Viele der Titel und Autoren, die Dirk van Laak in diesem Band versammelt hat, kennt man - aber hat man sie auch gelesen? Neugierig macht die spezielle Perspektive des Gießener Historikers. Er stellt nämlich die Frage, ob Literatur die Geschichte verändern kann. Nun ist diese Frage zwar nicht neu, aber bisher gab es keine Antwort in dieser gewissermaßen gebündelten Form einer vergleichenden Übersicht. In 17 Beiträgen befassen sich Autoren mit geschichtsmächtigen Titeln aus dem Bereich der sogenannten ‘schönen’ Literatur; Titel, die, wie van Laak meint, für politische, soziale, rechtliche oder kulturelle Veränderungen ursächlich waren und so den Gang der Geschichte beeinflussten. Der Herausgeber fand, dass dieses Auswahlkriterium nur erstaunlich wenige fiktive Texte erfüllen. Es treten auf: Lord Byron und Bertha von Suttner, H. G. Wells und Theodor Herzl, Upton Sinclair, Remarque, Sartre, Rushdie und andere. Mit großem Gewinn zu lesen.
Frank Hertweck und Dimitrios Kisoudis: Solange das Imperium da ist. Carl Schmitt im Gespräch mit Klaus Figge und Dieter Groh 1971
in Zusammenarbeit mit Gerd Giesler, Verlag Duncker & Humblot.
Noch immer ist Carl Schmitt das Rätsel, aber auch der Spiegel jener als Zeitenwende empfundenen Zäsur von 1933. Noch immer suchen Historiker und Publizisten in Schmitts Denken und in seiner Biografie die Lösung. Er wird gelesen, befragt, analysiert. Dabei sagen unsere nervösen Fragen oft mehr als seine oft brillant schillernden Antworten. Der Nationalsozialismus als ewiges Rätsel der Deutschen. Und Schmitt soll der Verklärer sein, der Verkünder und der Sünder - neben Heidegger, aus dem die Deutschen bis heute nicht schlau geworden sind, umgibt ihn ein Geheimnis.
Den Versuch, dieses Geheimnis zu lüften, machten 1971 Klaus Figge und Dieter Groh in Gesprächen mit Carl Schmitt, die aufgezeichnet und im Südwestfunk gesendet wurden. Es handelt sich um 17 gut ausgewählte Themen, zu denen Schmitt sich ausführlich, klug, wenn auch gelegentlich kryptisch äußert. Es gelingt den beiden Interviewern, ein weit gespanntes Panorama deutschen Schicksals mit Schmitt zu skizzieren, etwa: "Legalität und Legitimität", "Goethe", "Nachkriegsjournalismus" geben spannende Einblicke in die Zeit und den Zeitgeist. Alles gut beisammen: Carl Schmitt und auch wir, die Deutschen, und ein Namensregister. Eine hinreißende Lektüre.
Berlin University Press.
Von "den Intellektuellen" hat man lange nichts gehört. Nun gibt es wieder mal ein Buch über sie. Das kann man als Nachruf verstehen. "Geburt, Begriff, Grabmal" heißt es im Untertitel. Der Autor Dietz Bering versucht zweierlei: eine Begriffs- und eine Sozialgeschichte. Er eröffnet mit Dreyfus. Das ist naheliegend, aber eigentlich zu kurz, zu modern gegriffen. Waren Marx und Engels und auch die Humboldt-Brüder keine Intellektuellen? Oder die Leute im Umkreis der Französischen Revolution, Babeuf zum Beispiel, oder deren Wegbereiter, Rousseau, d’Alembert, Voltaire? Wie wäre es mit Montesquieu oder und vor allem Montaigne? Und Hobbes und Melanchthon, waren die nicht geradezu prototypische Intellektuelle? War nicht das Ganze klassische Griechenland ein Intellektuellen-Nest? Berings Begriff ist weniger systematisch und geistesgeschichtlich gefaßt als politisch und praktisch. Das reicht ja auch.
Man muss es nur wissen. Der Autor hat vor allem die aktuellere deutsche, westdeutsche, Szene im Blick. DDR-Intellektuelle kommen nicht vor. "Westdeutsche Linksintellektuelle nach 1945" müsste das Buch heißen. Offenbar sind für ihn die Leute der Gruppe 47 und die 68er die wahren Intellektuellen. Dass er den Publizisten Melvin Lasky einen "Deutsch-Amerikaner" nennt, ist eine bezeichnende Panne. Offenbar hat Bering vieles aus der eigenen Biografie geschöpft, aus der eines ideologisch festgelegten 68ers. In diesem Sinne dürfte das Buch als Nachschlagewerk gute Dienste leisten, 756 Seiten mit Literatur- und Personenverzeichnis und Register.
Dirk van Laak: Literatur, die Geschichte schrieb
Vandenhoeck & Ruprecht
Viele der Titel und Autoren, die Dirk van Laak in diesem Band versammelt hat, kennt man - aber hat man sie auch gelesen? Neugierig macht die spezielle Perspektive des Gießener Historikers. Er stellt nämlich die Frage, ob Literatur die Geschichte verändern kann. Nun ist diese Frage zwar nicht neu, aber bisher gab es keine Antwort in dieser gewissermaßen gebündelten Form einer vergleichenden Übersicht. In 17 Beiträgen befassen sich Autoren mit geschichtsmächtigen Titeln aus dem Bereich der sogenannten ‘schönen’ Literatur; Titel, die, wie van Laak meint, für politische, soziale, rechtliche oder kulturelle Veränderungen ursächlich waren und so den Gang der Geschichte beeinflussten. Der Herausgeber fand, dass dieses Auswahlkriterium nur erstaunlich wenige fiktive Texte erfüllen. Es treten auf: Lord Byron und Bertha von Suttner, H. G. Wells und Theodor Herzl, Upton Sinclair, Remarque, Sartre, Rushdie und andere. Mit großem Gewinn zu lesen.
Frank Hertweck und Dimitrios Kisoudis: Solange das Imperium da ist. Carl Schmitt im Gespräch mit Klaus Figge und Dieter Groh 1971
in Zusammenarbeit mit Gerd Giesler, Verlag Duncker & Humblot.
Noch immer ist Carl Schmitt das Rätsel, aber auch der Spiegel jener als Zeitenwende empfundenen Zäsur von 1933. Noch immer suchen Historiker und Publizisten in Schmitts Denken und in seiner Biografie die Lösung. Er wird gelesen, befragt, analysiert. Dabei sagen unsere nervösen Fragen oft mehr als seine oft brillant schillernden Antworten. Der Nationalsozialismus als ewiges Rätsel der Deutschen. Und Schmitt soll der Verklärer sein, der Verkünder und der Sünder - neben Heidegger, aus dem die Deutschen bis heute nicht schlau geworden sind, umgibt ihn ein Geheimnis.
Den Versuch, dieses Geheimnis zu lüften, machten 1971 Klaus Figge und Dieter Groh in Gesprächen mit Carl Schmitt, die aufgezeichnet und im Südwestfunk gesendet wurden. Es handelt sich um 17 gut ausgewählte Themen, zu denen Schmitt sich ausführlich, klug, wenn auch gelegentlich kryptisch äußert. Es gelingt den beiden Interviewern, ein weit gespanntes Panorama deutschen Schicksals mit Schmitt zu skizzieren, etwa: "Legalität und Legitimität", "Goethe", "Nachkriegsjournalismus" geben spannende Einblicke in die Zeit und den Zeitgeist. Alles gut beisammen: Carl Schmitt und auch wir, die Deutschen, und ein Namensregister. Eine hinreißende Lektüre.
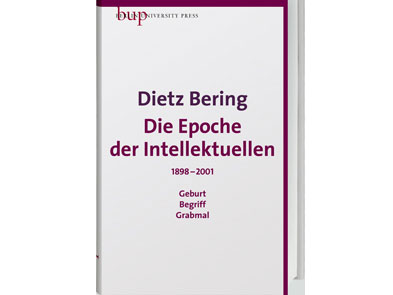
Cover: "Dietz Bering: Die Epoche der Intellektuellen"© Berlin University Press
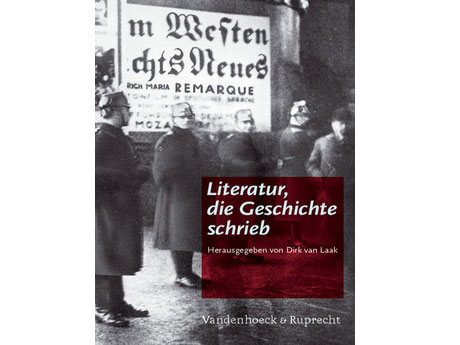
Cover: "Dirk van Laak: Literatur, die Geschichte schrieb"© Vandenhoeck & Ruprecht
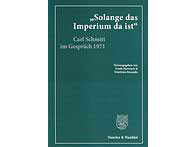
Cover: "Solange das Imperium da ist"© Verlag Duncker & Humblot
