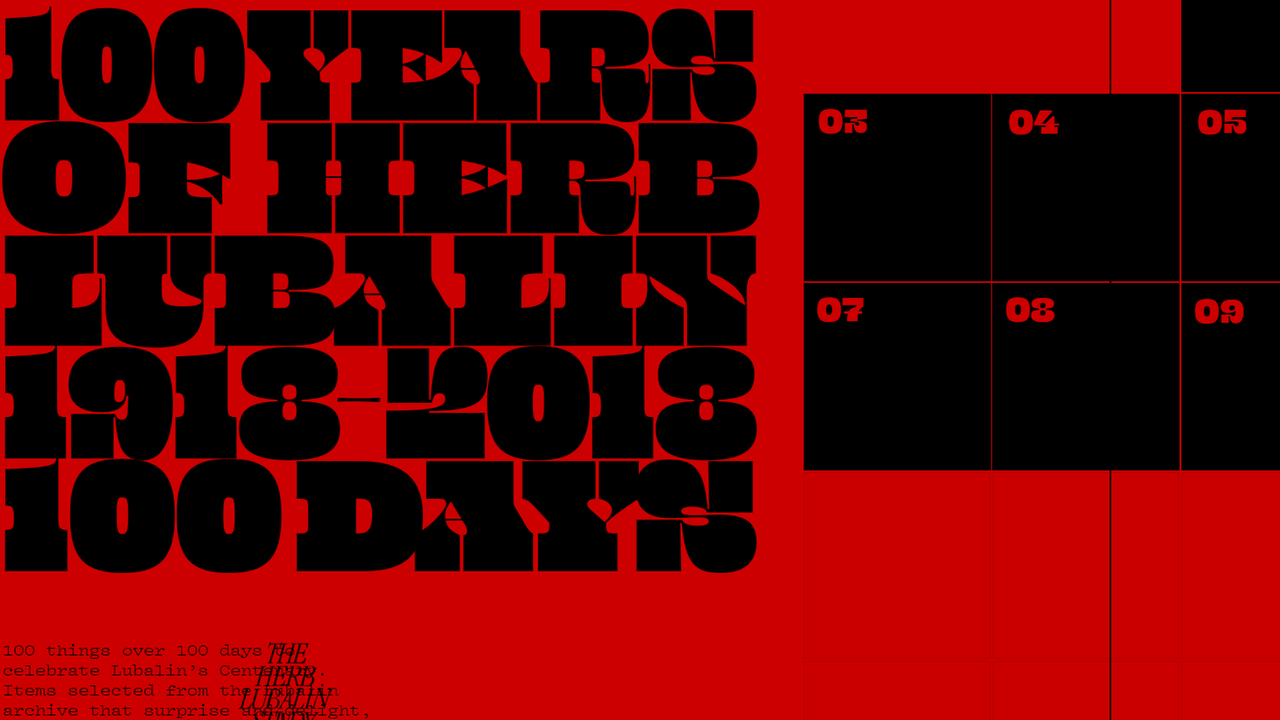Miriam Zeh: Herr Parr, "in unserem Alltag", das schreiben Sie und Alexander Honold, "agieren wir mit größter Selbstverständlichkeit unter Lesenden." Wir gehen also davon aus, dass jeder, dem wir auf der Straße begegnen, lesen kann und dies auch ständig tut. Aber was meinen wir überhaupt heutzutage ganz grundsätzlich damit, wenn wir vom Lesen sprechen?
Rolf Parr: Wir meinen wahrscheinlich alles das als Letztes, was die Schule uns gerne beibringen möchte, nämlich ganze Bücher von der ersten bis zur letzten Zeile zu lesen. Das Lesen im Alltag ist eher ein spontanes Lesen. Ich nehme einzelne Wörter wahr, kleine Zusammenhänge; ich schaue auf einen Fahrplan, ob meine Linie kommt und ob sie zum richtigen Ort fährt; ich werfe einen Blick auf eine Reklame, gucke beim Nachbarn in der Straßenbahn in die Zeitung und lese drei Worte. Dieses Lesen in kleinen Häppchen, in einer kleinen Dosis, kommt heutzutage am häufigsten vor, weniger das Lesen, bei dem ich ein Buch aufschlage und es von der ersten bis letzten Zeile durchlese.
Informationsentnehmendes Lesen unterscheidet sich von selbstvergessenem
Zeh: Die meisten leidenschaftlichen Buchleser würden intuitiv aber wahrscheinlich einen Unterschied empfinden zwischen diesem reinen Informationslesen und der kontemplativen Versenkung in einen Roman oder ein Gedicht. Gibt es zwischen diesen beiden Arten des Lesens einen Unterschied, den man wissenschaftlich messen oder beschreiben kann?
Parr: Ja, der lässt sich sehr gut beschreiben. Das eine ist in der Tat das informationsentnehmende Lesen zur Orientierung. Das andere ist ein Lesen, bei dem ich selbstvergessen lesen kann. Das ist eine erste Qualitätsstufe des Lesens. Die kennen wir alle aus den Zeiten, wo wir vielleicht noch jugendliche Vielleser waren und ganze Serien verschlungen haben. In meinem Alter war das noch Karl May, aktuell sind es Fantasy-Reihen, die so selbstvergessen von vorne bis hinten gelesen werden, dass die Umwelt dabei vergessen wird.
Eine nächste Qualitätsstufe wäre dann die, bei der ich lese und mir dabei Gedanken mache darüber: "Wie ist so ein Text gemacht?" und meinen Spaß auch daran habe zu sehen: "Ah, ich durchblicke, wie es gemacht ist! Ich verstehe, was ein Autor sich da gedacht hat, was eine Autorin gewollt hat." Das wäre die zweite Qualitätsstufe und auch diese ist natürlich von dem Alltagslesen stark unterschieden.
Lesen war nicht immer einsam und stumm
Zeh: Vor allem diese letzten beiden Qualitätsstufen des Lesens assoziieren wir heute mit einem stummen und einsamen Prozess. Schließlich ist es an Orten, die dem Lesen gewidmet sind, in Lesesälen von Bibliotheken etwa, sehr leise. Der Lektüre eines Romans widmet man sich meist allein. Das war allerdings nicht immer so. Wann hat sich diese Vorstellung vom stummen und einsamen Leser entwickelt?
Parr: Die hat sich erst entwickelt, als Bücher und Lesestoffe überhaupt – auch Zeitungen etwa – sehr viel billiger angeboten wurden als bis dahin. Es gab sehr viel früher sogenannte Lesegesellschaften, schon seit dem 17. Jahrhundert, in denen man sich zum einen Bücher und Zeitungen zusammen kaufte, dann aber auch zusammen daraus vorlas. Oder es war in den bessergestellten bürgerlichen Familien sehr üblich, dass der Vater seiner Familie vorlas. Auch, um zum Beispiel Stoffe zu kontrollieren und Gutes oder Schlechtes auszusortieren. Und das letzte wäre das gesellige Lesen in dem Sinne, dass Leute, die aus einer Schicht kommen und ähnliche literarische Interessen haben, sich vorlesen und während des Vorlesens gleich wieder zusammen kommentieren, also zusammen rezipieren. Das sind alles Möglichkeiten, die es schon lange gegeben hat.
Ein erstaunlicher Befund ist, dass mit allen den Formen des kollektiven Schreibens im Netz auch wieder neue kollektive Formen des Lesens entstanden sind. Man schaltet sich mit zwei, drei Leuten im Netz zusammen, liest sich wechselseitig etwas vor und kommentiert es gleich wieder. Da sind alte Formen in neuen Medien wieder aufgegriffen worden als Teil einer anderen Revival-Bewegung, nämlich sich wieder in vielfältiger Weise zu verlangsamen und es sich gemütlich einzurichten.
Wenn Sie etwa den Erfolg von Karl Ove Knausgård nehmen, der sieben dicke Bände mit je fast 600 oder 700 Seiten geschrieben hat – dafür muss man sich schon Zeit nehmen, aber das sind Erfolgsbücher. Es sind nicht die dünnen Texte, die erfolgreich sind im Moment, sondern eher die etwas längeren literarischen Texte, also Bücher, in denen man – wie man zu Pubertätszeiten gesagt hätte – einige Zeit "lebt".
Am Wochenende lesen Germanistik-Studierende selbstvergessener
Zeh: Diese neuen Leserbewegungen reagieren auf eine Entwicklung, die man vor einigen Jahren diagnostiziert hatte und die mit der digitalen Verfügbarkeit von Unmengen an Text einherging. Im Internet findet jeder von uns einen endlosen Text. Durch verschiedene Hyperlinks können wir uns immer weiter klicken zu noch mehr Text. Am Lesen im Internet wird dabei häufig kritisiert, dass die Lektüre dann aber oberflächlich und sprunghaft beliebe. Interessant fand ich jetzt aber bei Ihnen zu lesen, dass genau diese Kritik gar nicht neu ist. Schon im 18. Jahrhundert befürchteten viele Gelehrte, dass die sogenannte ‚Zeitungsleserei‘ zu einer zerstreuten Form des Lesen führe und die eingehende Lektüre einer wissenschaftlichen Abhandlung etwa dadurch verlernt würde.
Parr: Ja, das ist einer der Vorwürfe, der immer auf der Höhe der jeweiligen medialen Zeit neu gefasst wird. Mal kann man sagen, es ist die Zeitung, dann war es in den Schulen der Fotokopierer, wo man nur noch stückchenweise gelesen hat, was auf eine DIN A4-Seite für die ganze Klasse passt, und heute ist es das Netz. Dass in kurzen Stücken gelesen wird, ist ein Befund, den man wahrscheinlich, seitdem Leute lesen, seitdem geschrieben wird und seitdem es Buchstaben gibt, anzutreffen ist. Aber die mediale Form ändert sich und auch die Funktion ändert sich jeweils.
Um es an einem Beispiel festzumachen: Wir haben an einem Forschungsprojekt einmal untersucht, wie unsere Germanistikstudenten eigentlich lesen und wir haben sehr ausführliche Lesetagebücher schreiben lassen. Da zeigte sich, dass die Studenten auch dann das Buch, die Lektüre oder den Aufsatz wechseln, also zwischen Belletristik und Fachliteratur hin und her wechseln, wenn sie mehr als 20 Minuten Zeit haben. Das heißt, man konnte dort sehen, dass eine Gewohnheit sehen aus dem Lesen im Netz auf den Alltag übertragen wird. Das änderte sich aber freitagsmittags und die Studenten lasen die gleichen dicken Romane, vor allen Dingen historische Romane, Fantasy-Romane, also die Bestseller, bis montagsmittags am Stück und über längere Zeiträume. Montags gingen sie wieder zurück in den Modus des stückweisen Lesens, wie sie ihn aus dem Netz kennen. Also da spielen eine ganze Menge Faktoren eine Rolle.
Viel Nachholbedarf bei der Leseforschung
Zeh: In der Literarturwissenschaft ist das Lesen ein Basishandwerk. Trotzdem wird sich dieses Themas, wie Sie schreiben, in der Germanistik, eher nachrangig angenommen – bisher jedenfalls. Ihr Handbuch "Grundthemen der Literaturwissenschaft: Lesen" versammelt erstmals an einer Stelle medienhistorische, soziologische und kognitive Ansätze der Leseforschung. Was gibt es sonst noch für Nachholbedarf?
Parr: Der Nachholbedarf liegt vor allen Dingen darin, dass Lesen als Gegenstand der Kultur- und Medienwissenschaften in den Blick zu nehmen. Wie lesen bei Kindern funktioniert, wie die Lesesozialisation abläuft, wie man überhaupt lesen technisch lernt – all das ist sehr gut durch die Didaktiken für den Schulunterricht erforscht worden. Aber man hat darüber ein bisschen hintenangestellt und sich keine Gedanken gemacht beispielsweise darüber, was eigentlich passiert, wenn ich ein Buch zweimal lese, wenn eine Relektüre vorliegt und ich einen komplett anderen Sinn beim zweiten Lesen bilde. Oder: Was passiert, wenn ich zwei Bücher parallel lese? Viele Leser lesen mehrere Bücher parallel und nicht erst eines zu Ende. Oder man fragt sich vielleicht: Was passiert bei den neuen sozialen Medien, wenn ich einen Text im Netz lese, ist da irgendetwas anders? Was ist da anders? Das wären alles Elemente, die bisher in dieser Perspektive sehr selten wahrgenommen worden sind und die wir versucht haben jetzt einmal mit diesem Band auch zu bündeln.
Zeh: Die Projekte, die Sie gerade beschrieben haben, das wären aber alles empirische Studien, wenn man sie durchführen müsste?
Parr: Das können auch empirische Studien sein oder anders gesagt: Alle diese Themen haben natürlich einen leichten empirischen Background. Jemand wie Julia Bertschik untersucht zum Beispiel, wie kulturwissenschaftliches Lesen funktioniert, also Zuschreibungen wie "eine Stadt lesen", "ein Land lesen". Wo das Lesen auch zur Metapher wird, braucht man natürlich Beispielmaterial, sodass man im Hintergrund immer eine leichte Empirie hat, aber nicht eine des Auszählens von irgendwelchen Dingen, die sich dann nur in Zahlen niederschlagen, sondern eine Empirie, die eher zeigt: "Ah, es wird immer auf dieselben Diskurse zurückgegriffen, auf dieselben Argumentationsformen, auf dieselben Begründungen!"
Zeh: Lesen Sie eigentlich noch gerne oder gibt es irgendwann eine déformation professionelle, wo man das gar nicht mehr so genießen kann?
Parr: Sagen wir es so: Es gibt ein Lesen unter den Bedingungen der déformation professionelle. Da, wo ich Dinge lese, die ich eigentlich nicht lesen möchte, aber lesen muss, weil ich eine Seminararbeit betreuen muss oder eine Masterarbeit oder eine Doktorarbeit betreuen muss und eben selber mich auch immer up to date halten muss. Und es gibt das Lesen, wo ich für mich etwas entdecke, was ich bisher nicht kannte: einen Autor, eine Schreibart und dann auch schon einmal vielleicht sogar trotz besseren wissenschaftlichen Wissens in den Modus wieder des selbstversunkenen Lesens abtauchen kann. Und es gibt die Autoren und die Bücher, bei denen ich mir geschworen habe, nie etwas wisssenschaftlich darüber zu machen. Die ich mir sozusagen behalte für mich.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassung wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Alexander Honold / Rolf Parr: "Grundthemen der Literaturwissenschaft: Lesen"
De Gruyter, Berlin. 666 Seiten, 159,95 Euro
De Gruyter, Berlin. 666 Seiten, 159,95 Euro