Ijeoma Oluo: "Das Land der weißen Männer"
Aus dem Englischen von Benjamin Mildner
Hoffmann & Campe, Hamburg 2021
384 Seiten, 25 Euro
Die vermeintliche Überlegenheit des Mittelmaßes
06:23 Minuten
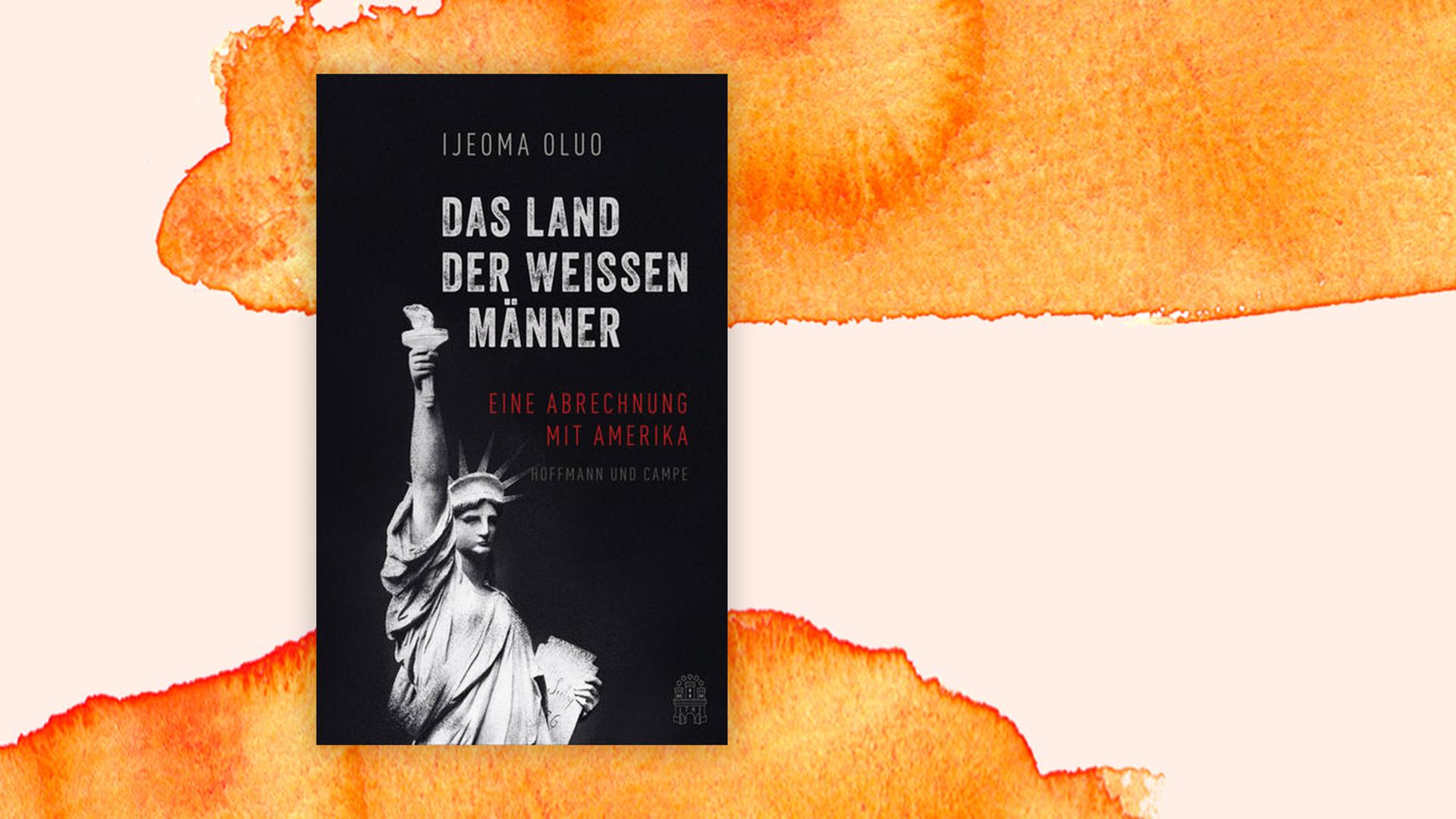
Von Pieke Biermann · 13.02.2021
Radikal und mit treffsicherem Spott analysiert Ijeoma Oluo die Macht von mittelmäßigen weißen Männern. Dabei kommt sie ohne Opfergebärden aus. Stattdessen entlarvt sie ein rassistisches Prinzip und sein gefährliches Vermächtnis.
"Writer/Speaker/Internet Yeller" nennt sie sich auf ihrer Homepage von 2017. Da ist Ijeoma Oluo schon bekannt, eben als schreibende, öffentlich redende "Netz-Schreierin", hat aber ihr erstes Buch noch vor sich. Es heißt, ebenso kiebig-herausfordernd: "So You Want to Talk About Race", also etwa: "Soso, Sie wollen also über race reden" – sicher mit Augenzwinkern an die afrobritische Essayistin Reni Eddo-Lodge, die 2017 in "Why I'm No Longer Talking to White People About Race" eben solche Gespräche radikal verweigert hatte.
Ein Parforceritt durch die Geschichte
Oluos Buch ist nicht weniger radikal, denn natürlich schwingt im Titel mit: "Na, dann ziehen Sie sich mal warm an!" Es erscheint 2018, wird sofort "New York Times"-Bestseller, erscheint 2020 auch auf Deutsch und wird – kaum beachtet. Vielleicht liegt's am dröge-apologetischen Titel "Schwarz sein in einer rassistischen Welt: Warum ich darüber immer noch mit Weißen spreche".
Immerhin, auch Eddo-Lodges Buch ist seit 2019 auf Deutsch zu lesen. Wer will, kann also erkennen: Schwarze Autorinnen demontieren den "strukturellen Rassismus" inzwischen auch in Non-Fiction-Form, und sie dialogisieren selbstverständlich miteinander, auch international. Alice Hasters gehört hierzulande dazu, um nur eine afrodeutsche Stimme zu nennen (es gibt einige).
Oluos zweites Buch ist noch radikaler. Für sie ist Rassismus nicht mehr "nur" strukturell, er ist konstitutiv, und sie zeigt das in einem Parforceritt durch die US-Geschichte, in und mit der sich das weiße männliche Amerika selbst erschafft und zur Messlatte für alle und alles macht. "Das Land der weißen Männer: Eine Abrechnung mit Amerika" ist also eine Reise in den Mythos weißer Maskulinität, den Amerika sich immer wieder neu über sich selbst erzählt.
Eine Meisterin des entlarvendes Spotts
Amerikanische Maskulinität ist von Anfang an ein fatales Junktim aus Gemetzel, Entertainment und Medienrummel – Oluo belegt es unter anderem an Buffalo Bill und der folgenden Western-Tradition, an der Lüge vom Skalpieren als "Indianer-Grausamkeit", während in Wahrheit die Skalps der Ureinwohner ein bezahlter "Arbeitsnachweis" bei der brutalen Landnahme durch die europäischen Siedler waren. An der Figur des heldenhaften, gern einzelkämpferischen und immer körperlich (oder waffenmäßig) überlegenen weißen Mannes und des "Muskulösen Christentums" ("Muscular Christianity"), in dem er sich selbst feiert. Von Cowboy bis Hip-Hop.
Dieser Held braucht Schwächere, um sich als Mann zu fühlen, und erfindet Dämonen, um sich als Held fühlen und gebärden zu können. Und dieses Prinzip Weißer Mann findet sich bis heute überall und prägt von frühester Kindheit an die amerikanische Bevölkerung, ob weiß oder nicht, männlich oder nicht.
Oluo denkt auch radikal race und gender zusammen, und das ohne identitaristischte Opfergebärden. Ganz im Gegenteil. Sie ist eine Meisterin des punktgenauen, entlarvenden Spotts. "Niemand ist pessimistischer, was weiße Männer angeht, als weiße Männer", kontert sie Hatemails, in denen wieder mal jemand mit Suizid droht, weil sie ihm und seinesgleichen ja den Tod an den Hals wünsche.
Weißer Mann sieht sich überlegen qua Existenz
Natürlich – man muss es wohl doch extra erwähnen – geht es in Oluos Buch nicht um pöse, pöse weiße Männer. Es geht um ein Prinzip und sein gefährliches Vermächtnis. Knapp zusammengefasst: Der Weiße Mann hat sich selbst als der Überlegene qua Existenz in die Welt gesetzt, er muss sich gar nicht anstrengen, in irgendetwas besser zu werden – es gibt ja immer Schwächere: Frauen, Nichtweiße.
Er darf so mittelmäßig sein, wie er will, er wird etwas – vor allem etwas mit Macht. Das verhindert auf fundamentale Weise die Entfaltung von Talent, von Kreativität, von wirklichen Stärken, die dringend nötig sind, um mit den Problemen der Welt klarzukommen – an denen ist nämlich nichts medioker.
Im Original heißt Oluos grandiose Philippika "Mediocre: The Dangerous Legacy of White Male America". Wer das weiß (und den falschen deutschen Titel gnädig überliest), dem und der ist eine mitreißende Lektüre sicher, die sämtliche Gehirnwindungen ins Schwingen bringt.






