Warum viele Menschen nicht an ihre Fähigkeiten glauben
08:28 Minuten
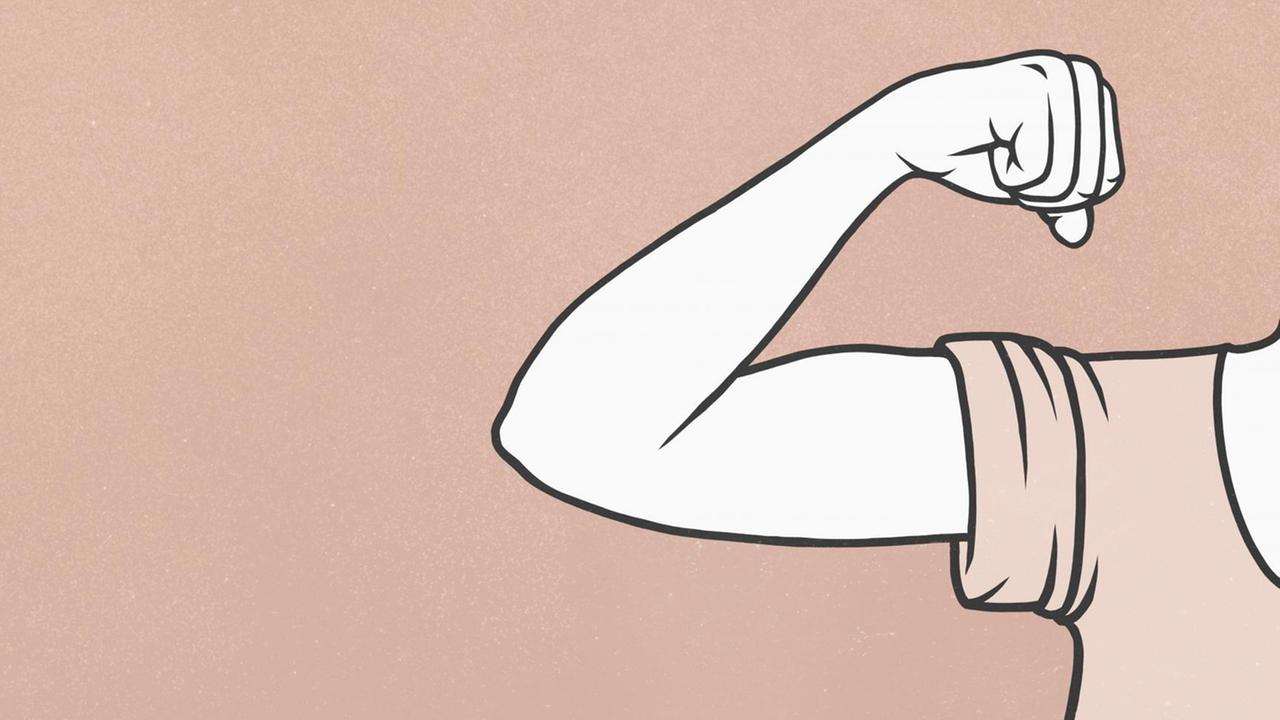
Von Katja Bigalke · 19.12.2019
Gerade Frauen tun sich oft schwer damit, Erfolge ihrer Leistung zuzuschreiben. Stattdessen fühlen sie sich wie Hochstaplerinnen, die sich den Erfolg nur erschlichen haben. Dieses "Hochstapler-Phänomen" tritt vor allem bei höher Gebildeten auf.
Manchmal erwischt es mich schlimm. Wenn ich vor größeren Gruppen etwas vortragen soll zum Beispiel. Dass ich denke, jetzt werden es gleich alle merken, dass ich hier eigentlich fehl am Platz bin. Dass ich entlarvt werde als eine, die das, was sie tut, eigentlich nicht kann. Bis vor einiger Zeit dachte ich, dass sei mein eigenes, persönliches Problem. Bis ich diese Geschichte von einer mir nahestehenden, erfolgreichen Biochemikerin hörte:
"Am schlimmsten sind wissenschaftliche Konferenzen. Eigentlich freut man sich da drauf, wenn man ausgewählt wird und seine Ergebnisse präsentieren kann. Aber das ist echt schlimm, wenn so viele Experten aufeinandertreffen, die das zum Teil seit vielen Jahren machen. Und da hab ich immer das Gefühl, gleich passiert es und die merken, du hast keine Ahnung und fällst jetzt vom Podium."
Und dann hörte ich diese Geschichte:
"Ich habe telefoniert mit einer Freundin, die ist Fotografin, noch dazu eine sehr gute. Sie hatte eine große Reportage in einem renommierten Magazin veröffentlicht und ich habe sie dazu beglückwünscht. Und sie antwortete immer nur so: Naja, war halt Glück, das Licht war gut, die Leute waren nett", so die Autorin Sabine Magnet.
"Und ich bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe: Warum können wir denn diese Komplimente nicht annehmen? Dann gab es eine Pause und sie seufzte und sagte: Manchmal hab ich Angst, dass die rausfinden, dass ich nur bluffe. Und das hat mich sehr, sehr getroffen, ich hab mich davon sehr ertappt gefühlt. Ich hab auch oft das Gefühl, dass ich nur durch Zufall irgendwo sitze und meine Meinung abgebe, weil mich die Leute nett fanden."
Starke Selbstzweifel trotz herausragender Leistung
Die Autorin Sabine Magnet begann zu recherchieren und stieß auf einen Begriff, der in der amerikanischen Literatur schon ein paar Jahrzehnte kursiert: Impostor - auf Deutsch Hochstapler. Ende der 70er-Jahre hatten die Psychotherapeutinnen Pauline Rose Clance und Suzanne Imes in ihrer Arbeit mit jungen Frauen an der Universität Georgia festgestellt, dass viele von ihnen trotz herausragender akademischer Leistungen unter starken Selbstzweifeln litten. Sie gaben dem Phänomen seinen Namen.
"Das Phänomen ist ziemlich breit gefächert. Wissenschaftliche Untersuchungen gibt es fast ausschließlich im beruflichen Kontext. Das bedeutet, ich hab Angst, dass ich die Profession nicht gut genug ausfülle oder nicht kann, die ich gelernt habe."
Im Gegensatz zu richtigen Hochstaplern, die sich Erfolge erschleichen und bewusst vortäuschen, identifizierten Clance und Imes Menschen, die unter dem Impostor-Phänomen litten, als solche, die eher tiefstapeln. Die objektiven Erfolge subjektiv nicht als solche verbuchen. Sondern auf Glück, Sympathie oder ausufernde Vorbereitung zurückführen.
In Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaften verbreitet
Obwohl das Impostor-Phänomen durchaus mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Stress oder Angststörungen einhergehen kann, beschreibt es keine Krankheit. Es basiert allerdings auf bestimmten Persönlichkeitsstrukturen, sagt Sonja Rohrmann, Professorin für Differentielle Psychologie an der Uni Frankfurt, die gerade einen Impostor-Fragebogen für den deutschsprachigen Raum entwickelt:
"Das ist emotionale Labilität, Leute, die eher stimmungsschwankend sind, wenig selbstsicher, introvertiert, sehr perfektionistisch und die so ne... man nennt es externale Attributionsmuster haben, dass also zum Beispiel Erfolg external attribuiert wird, also auf Glück zurückgeführt wird, aber Misserfolg auf die eigene Person. Das macht so ein depressives Muster."
Besonders in leistungs- und wettbewerbsorientierten Gesellschaften sei das Phänomen weit verbreitet. Gesellschaften, in denen der persönliche Wert stark an erbrachten Leistungen gemessen wird:
"Studien haben immer herausgefunden, dass etwa 50 Prozent der Probanden, die diese Fragebögen ausgefüllt haben, dieses Phänomen kennen und auch unsere erste Studie an Führungskräften hat gezeigt, dass etwa 50 Prozent davon betroffen sind. Das scheint schon ein Großteil der Personen zu sein, auch über verschiedenen Berufsgruppen hinweg. Allerdings scheint es mit höherer Ausbildung extremer zu werden."
Zu wissen, man steht nicht allein, ist die halbe Therapie
Ein Eindruck, den auch die mir nahestehende Biochemikerin teilt:
"Ich glaube, das betrifft viele Wissenschaftler, vor allem jüngere. Zum einen, weil man ab der Doktorarbeit als Experte gilt, man aber nicht alles wissen kann - vor allem nicht im Vergleich mit Leuten, die das Thema seit 30 Jahren bearbeiten. Daher hat man immer die Angst, dass die Leute einen ausfragen, bis man nicht mehr weiter weiß."
Der erste Ansatz das Problem zu lindern, meint Sonja Rohrmann, sei darüber zu reden und anzuerkennen, dass das Phänomen existiert:
"Das ist die halbe Therapie, wenn man sich bewusst ist, das haben andere auch, ich stehe nicht allein da und anfängt, das selbst zu reflektieren. Es gibt auch so Selbsthilfemaßnahmen, auch Tagebuch zu schreiben und sich auch klar zu machen, welche Anteile man am Erfolg hat. Das wichtigste, und darauf ziehen auch alle Methoden ab: es soll ein verinnerlichtes Selbstwertgefühl aufgebaut werden, was unabhängig ist von der Bewertung anderer, und diese irrationalen Denkmuster müssen aufgedeckt werden und diese Arbeitsstile, die mit diesen Denkmustern zusammenhängen: Perfektionismus und Prokrastination, die muss man verändern und mehr auf eine positive Work-Life-Balance hinarbeiten."
Lernen, ein Lob anzunehmen
Und sich für Lob auch einfach mal bedanken, statt die eigene Leistung immer herunterzuspielen. Für die Autorin Sabine Magnet, die aus ihren Recherchen das Buch "Und was, wenn alle merken, dass ich gar nichts kann" gemacht hat, hat die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema jedenfalls einiges gebracht:
"Also, ich bin mir bewusst, wenn sich in mir innerlich eine Spannung aufbaut. Diese Art der Selbstbeobachtung hatte ich vorher nicht. Ich bin auch schon besser geworden, nicht ständig die psychische Peitsche auszupacken und zu sagen: Mensch, checkst du das immer noch nicht? Ich bin milder mit mir geworden, das ist wahnsinnig schön. Für mich hat diese ganze Recherche und das Ausprobieren der Methoden eine wahnsinnige Verbesserung meiner Lebensqualität bewirkt."
Letztendlich braucht es aber auch ein Umdenken am Arbeitsplatz. Ein toleranter Umgang mit Schwächen zum Beispiel, der eher das Entwicklungspotenzial als das Scheitern herausstellt, scheint bisweilen Wunder zu wirken. Selbst im Impostor-anfälligen Bereich der Wissenschaft:
"Wichtig ist eine gute Arbeitsgruppe mit einem engagierten Chef oder Chefin und netten, hilfsbereiten Kollegen. Das ist das einzige, was hilft. Weil, sonst an vielen großen Unis ist das so, da ist ein Professor, der hat 30 bis 40 Leute unter sich, der hat nur Interesse an den Projekten, wenn es gut läuft. Und bis dahin müssen die alles alleine stemmen. Es ist halt natürlich wahnsinnig frustrierend, wenn man so alleine gegen alle kämpft."


