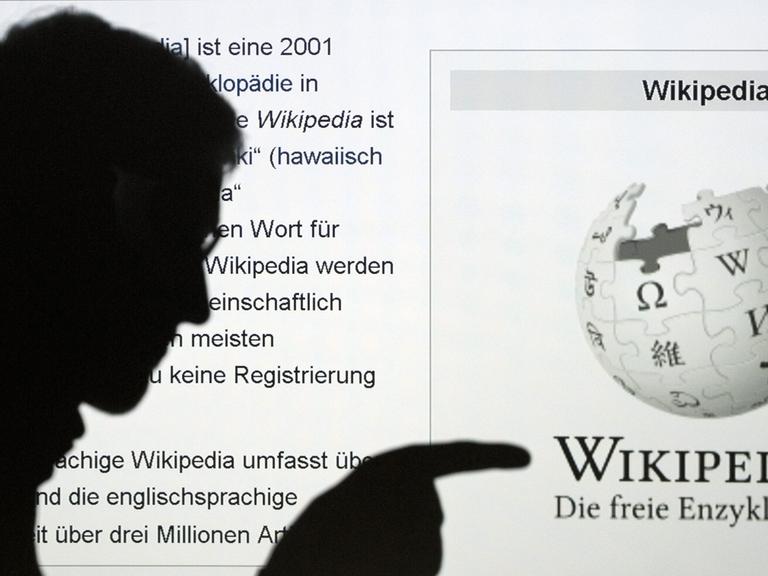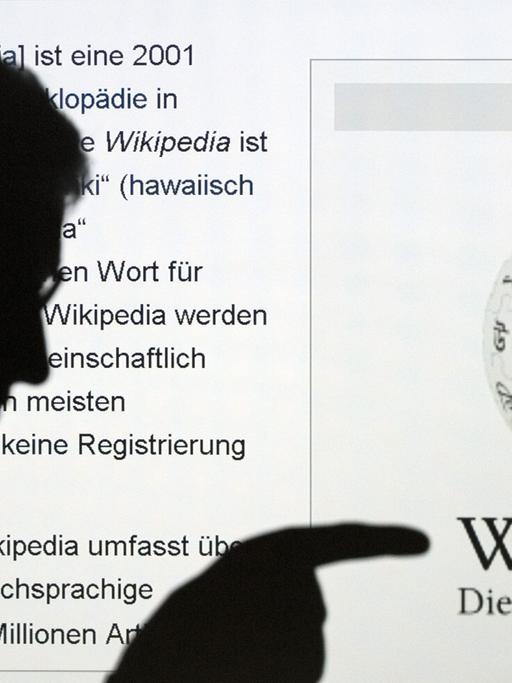Ein Manifest gegen drohende Irrelevanz
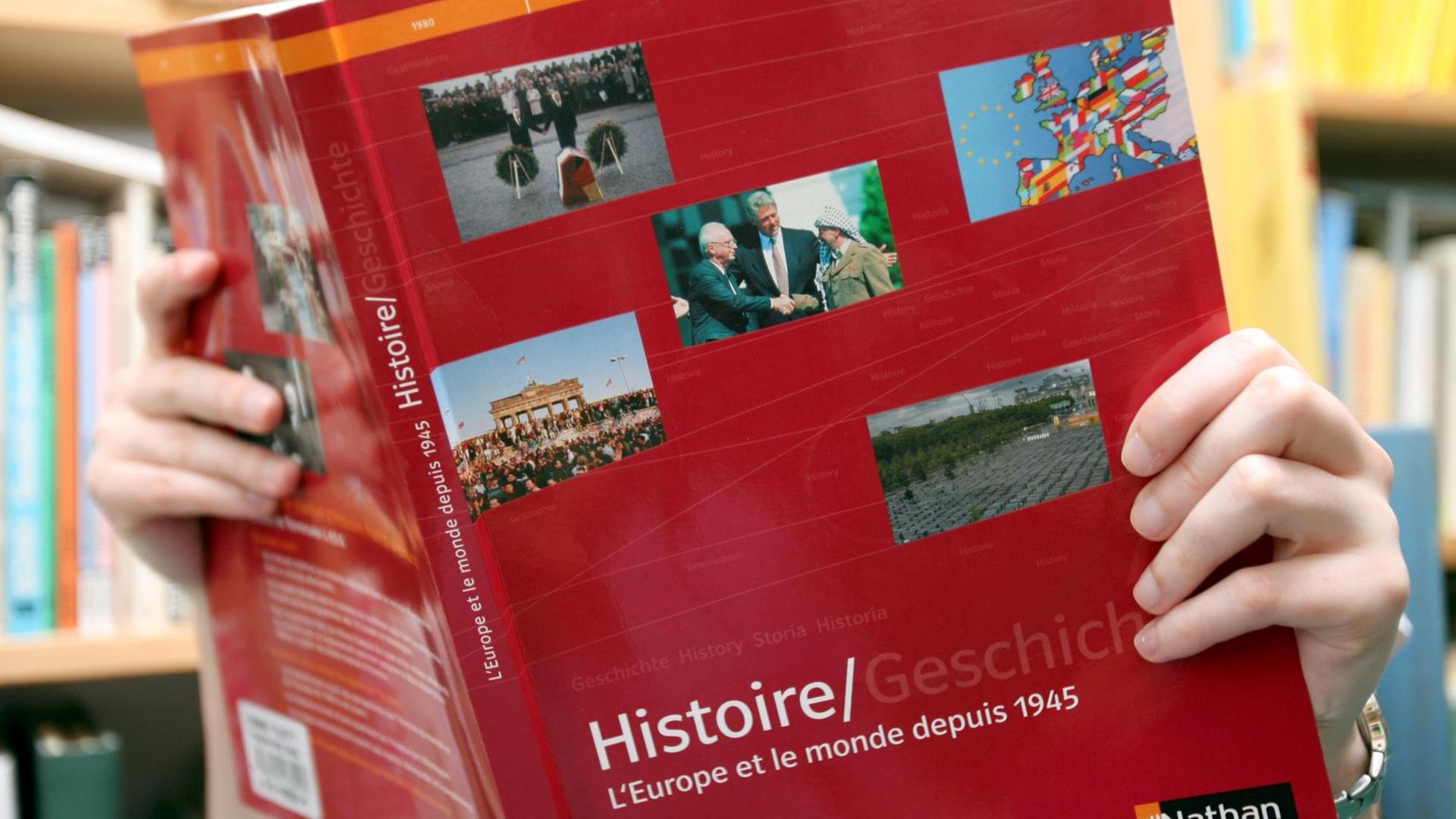
Von Philipp Schnee · 07.01.2015
Das in der Cambridge University Press erschienene "History Manifesto“ appelliert an Historiker, sich nicht abzuschotten, sondern in die Politik einzumischen. Die Geschichtswissenschaft habe sich selbst marginalisiert.
Jo Guldi und David Armitage sorgen sich um ihre Zunft, die Historiker. Die Amerikanerin und der Brite – beide lehren an angesehenen Ostküsten-Universitäten in den USA - konstatieren einen gewaltigen Bedeutungsverlust.
"Wann wurde das letzte Mal ein Historiker von seinem akademischen Posten in die Downing Street oder ins Weiße Haus beordert, wann das letzte Mal von der Weltbank konsultiert, wann hat einer das letzte Mal den UN-Generalsekretär beraten?"
...fragen sie, um dann recht schnell trocken festzustellen:
"Die Professionalisierung hat zur Marginalisierung geführt."
Die Anfänge dieser Professionalisierung verorten sie in den frühen 70er Jahren. Die historischen Methoden wurden immer ausgefeilter, die Untersuchungsansätze immer theoriegesättigter, die Historiker gruben immer tiefer und intensiver in Archivmaterial.
"Der Kult der Professionalisierung bedeutete, dass immer mehr akademische Historiker immer mehr akademische Geschichte schrieben, die immer weniger Leute tatsächlich lasen."
Krisen unserer Zeit verlangen nach Langzeitgeschichte
Als Kardinalfehler machen sie ein "Misstrauen gegenüber der großen Erzählung aus": Seit etwa 40 Jahren untersuchen die meisten historischen Arbeiten eine Zeitspanne zwischen fünf und fünfzig Jahren, die große Geschichte über große Zeiträume aber fehlt, so der Vorwurf der Autoren des Manifests.
Gleichzeitig stellen sie fest, dass die Informationstechnologien solch kurzfristiges Denken in Frage stellen - durch neue technologische Möglichkeiten, die es erlauben, große Zeiträume mit Hilfe riesiger historischer Datenmengen zu erschließen. Ja, sie konstatieren, dass die Krisen unserer Zeit geradezu nach Langzeitgeschichte verlangen.
"Der Aufstieg von Big Data und Problemen wie Klimawandel, Governance und Ungleichheit bewirkten eine Rückkehr zu den Fragen, wie die Vergangenheit sich über Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt und was uns dies über das Überleben und vielleicht sogar das Florieren in der Zukunft sagen kann."
Sie fordern deshalb - vehement - eine Rückkehr der longue durée. Ein Begriff, den sie vom französischen Historiker Fernand Braudel und seiner Annales-Schule entlehnen, wenn auch etwas unsauber angewendet. Historiker sollen wieder, ohne an Details zu kleben, große Geschichte schreiben, über mehrere Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende.
Um der Unübersichtlichkeit der heutigen Zeit und der möglichen Zukünfte Herr zu werden, verlangen sie nach denjenigen, die das "Bigger Picture", das ganz große Bild, zeichnen können, die Überblickskarte:
"Eine Informationsgesellschaft wie die unsere braucht Vermittler, Synthetisierer, die uns helfen zu verstehen, wie wir über Klimadaten und ökonomische Indikatoren sprechen. Es braucht auf diesem Weg Führer, die die gesammelten Daten, die Erzählungen darüber und die Handlungen, die daraus abgeleitet werden, untersuchen. Vor allem aber müssen diese großen Erzählungen der Öffentlichkeit, die über die zukünftigen Spielräume informiert werden sollen, einfach verständlich gemacht werden."
Die Forderung, Geschichte einfach verständlich zu vermitteln, verbinden Armitage and Guldi mit einem sehr pathetischen Glauben an die Nützlichkeit von Geschichte für die Zukunft. Geschichte des Klimawandels, Geschichte des Anthropozäns, des ersten durch den Menschen geprägten Erdzeitalters, Geschichte der Ungleichheit. Mit einem Ziel:
"Neue mögliche Zukünfte entwerfen und vorhersagen."
Wissenschaftlicher scheuen Lesbarkeit und Zugänglichkeit
Prädestiniert dafür seien Historiker, die mit leichter Hand und mit Mut zur großen These den Gang an die Öffentlichkeit wagen. Bei den heutigen Historikern diagnostizieren sie eine Scheu vor der Lesbarkeit und Zugänglichkeit geschichtswissenschaftlicher Arbeiten. Das trifft. Die Geschichtswissenschaft hat sich in großen Teilen in den Elfenbeinturm zurückgezogen, nur manchmal tritt sie, durch einen wie Christopher Clark herausgelockt, scheu vor die Tür. Dass wirksame Geschichtswissenschaft immer auch auf die Öffentlichkeit zielen muss, geht in den hochgradig spezialisierten Diskursen häufig unter. Aber kann Geschichtswissenschaft
"Neue mögliche Zukünfte entwerfen und vorhersagen."
Wie das Manifest mit einer gewissen Naivität verlangt? Kann man so einfach:
"Das aus der Geschichte gewonnene Wissen ... als Werkzeug .. benutzen, um die Zukunft zu formen?"
Kann die Geschichte Leitplanken für Zukunftsentwürfe bieten? Die Historiker sind (in der Regel) Zyniker. In der Geschichte haben sie schon alles gesehen. Für Zukunftsentwürfe eignen sie sich nicht, weil sie lieber alles Geschehene historisch erklären. Ihr Talent ist ein anderes – die Distanz zur eigenen Zeit:
Wer in historische Quellen vorgedrungen ist und der Zeitbedingtheit vieler Phänomene und Diskurse nachgespürt hat, der kann auch in der Gegenwart zum Zeitgeist, zu den scheinbaren Unausweichlichkeiten, Alternativlosigkeiten, den scheinbar pragmatisch gegebenen Schritten und Rezepten, eine Distanz einnehmen. In dieser Distanz zu den unhinterfragten Selbstverständlichkeiten der eigenen Zeit kann die Relevanz der Historiker liegen.
"The history manifesto."
Man kann diese in Cambridge erschienen großen Aufschlag in zwei Richtungen lesen: Nach außen: als Appell an die Entscheider, wieder mehr auf die Stimmen aus den Geisteswissenschaften zu hören, neben jenen der Technokraten und Ökonomen. Und nach innen: an die eigenen Fachkollegen, als herbe Kritik an der Theoretisierung der Geschichtswissenschaften.
Nach Jahrzehnten der Spezialisierung und Akademisierung dürfen die Geschichtswissenschaften wieder mutiger werden. Sie sollten nicht dem technokratischen Pragmatismus das Feld überlassen. In die Futurologie aber sollten Historiker nicht einsteigen.