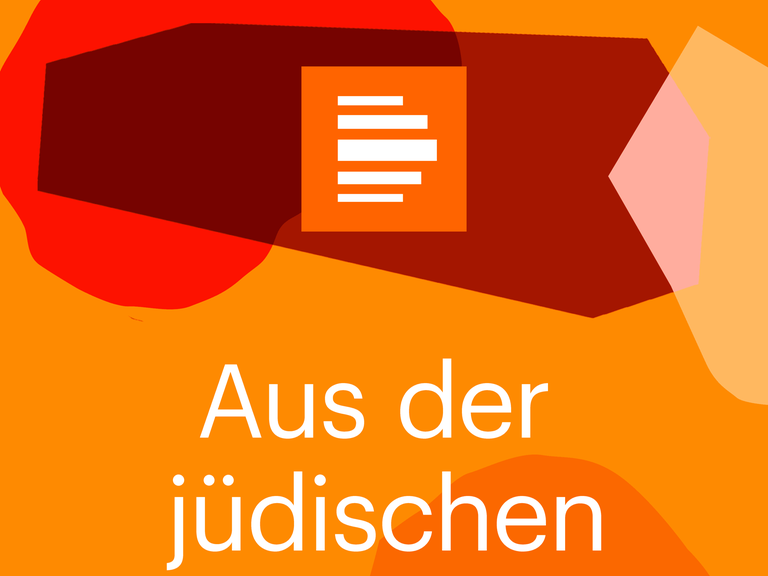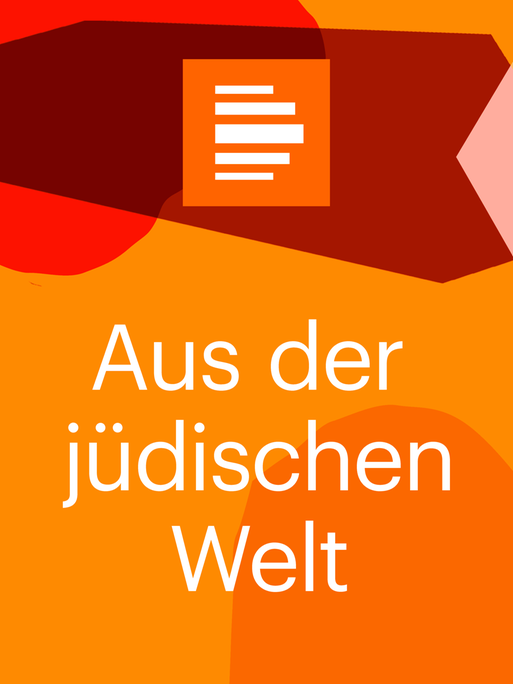Die Freude über das Wasser
Ohne Wein kann der Mensch sehr wohl leben, ohne Wasser jedoch nicht. Deshalb wird am Ende von Sukkot das Wasser-Trankopfer vollzogen. Außerdem wird das Achtzehn-Bitten-Gebet mit der Bitte um Regen zur richtigen Zeit erweitert.
Das gestern zu Ende gegangene Sukkot gehört zu den drei von der Torah gebotenen Wallfahrtsfesten, an denen die Israeliten sich auf die Pilgertour nach Jerusalem begeben mussten, um dem Allmächtigen ihre Opfergaben darzubringen. Der Abschluss des Festes ist Simchat Torah, die Freude darüber, dass erneut mit der Lesung der Torah begonnen wird.
Als das Heiligtum noch in Jerusalem stand, wurde im Tempel am Ende von Sukkot noch ein anderes Ritual vollzogen, das sogenannte Wasser-Trankopfer. Zu jedem Tier- oder Speiseopfer, das im Tempel dargebracht wurde, vergossen die Priester normalerweise auch Wein. Dessen Menge richtete sich danach, welches Tier geopfert wurde, etwa eine halbe Kanne Wein zu je einem jungen Stier, eine drittel Kanne zum Widder, eine viertel Kanne zu jedem Schaf, wie wir im 4. Buch Mose lesen. Zu Sukkot hat man dann am siebten Tag, der Hoschana Raba heißt, anstelle von Wein Wasser vergossen, und dieses Ritual hieß nisuch hamaim und verweist bereits darauf, wie wichtig das Wasser war und sogar höher als Wein geschätzt wurde. Denn ohne Wein kann der Mensch sehr wohl leben, ohne Wasser jedoch nicht.
Auf dem Altar nun gab es an der südwestlichen Ecke ein Loch, durch das alle Flüssigkeiten in den Wasserlauf der Gichon-Quelle unterhalb des Tempels abgeleitet wurden. Warum dieses Abflussloch ausgerechnet an der südwestlichen Ecke des Altartisches lag, hat den ganz einfachen Grund, dass der so lebenswichtige Regen in Israel in aller Regel mit den südwestlichen Winden kommt, und daher befand sich das Loch auch an dieser so symbolträchtigen Stelle.
Und schließlich beginnt noch eine weitere rituelle Besonderheit zum Ende des Sukkot-Festes. Das bekannte Schmone Esre, das Achtzehn-Bitten-Gebet, das jeder Jude täglich dreimal beten muss, wird am letzten Tag von Sukkot um die Bitte ergänzt, dass es im kommenden Jahr zu seiner Zeit regnen möge. Und natürlich hat es auch einen Grund, dass diese Bitte erst am letzten Tag des Wallfahrtsfestes ausgesprochen wird, wie Avi Zur, Vorbeter in einer Synagoge in Hod Hascharon, erklärt:
"Es ist sehr wichtig, dass der Regen zu seiner Zeit kommt, denn ansonsten schadet er. Um von den nördlichen Grenzen des Landes bis zum Tempel zu laufen, brauchte man damals zwei Wochen, und die Bitte war, dass der Regen frühestens zwei Wochen nach Sukkot kommen möge. Warum? Damit er nicht die Pilger behinderte, die auf dem Weg nach Hause waren, und deshalb beten wir bis heute, dass der Regen nach dem 7. des Monats Heschwan kommen möge. Und so gibt es im Achtzehn-Bitten-Gebet zwei Zusätze. Der eine lautet: "Lass’ die Pilger unbeschadet heimkehren!", und der zweite: "Gib’ uns Deinen Segen!" Den zweiten Zusatz hat man nach dem 7. Heschwan eingefügt, denn dann waren die Pilger wieder zu Hause und es war die richtige Zeit für den Regen."
Ein weiterer Brauch von Sukkot schließlich hat sich bis in unsere Tage erhalten und kann vor allem in Jerusalem beobachtet werden: Simchat beit hascho’ewa, die Freude über das Wasser, von dem so sehr das Wohlergehen der Menschen abhängt. Ähnlich wie zu Simchat Torah tanzen die Männer mit fröhlichem Gesang auf dem Vorplatz der Westmauer, und es heißt, "Wer nicht die Freude von 'beit hascho'ewa' gesehen hat, hat nie im Leben eine Freude gesehen!"
Avi Zur: "Die Freude über das Wasser ist so stark, das sie keiner anderen gleicht. In der Praxis ist dies eine Form der Autosuggestion, eine Vorwegnahme des künftigen Zustandes auf spiritueller Ebene. Ich freue mich heute, damit meine Zukunft freudvoller wird. Und wenn ich mich heute über das Wasser freue, das man mir geben wird und woran ich ganz fest glaube, dann gibt mir die Freude heute das Wasser in der Zukunft."
Als das Heiligtum noch in Jerusalem stand, wurde im Tempel am Ende von Sukkot noch ein anderes Ritual vollzogen, das sogenannte Wasser-Trankopfer. Zu jedem Tier- oder Speiseopfer, das im Tempel dargebracht wurde, vergossen die Priester normalerweise auch Wein. Dessen Menge richtete sich danach, welches Tier geopfert wurde, etwa eine halbe Kanne Wein zu je einem jungen Stier, eine drittel Kanne zum Widder, eine viertel Kanne zu jedem Schaf, wie wir im 4. Buch Mose lesen. Zu Sukkot hat man dann am siebten Tag, der Hoschana Raba heißt, anstelle von Wein Wasser vergossen, und dieses Ritual hieß nisuch hamaim und verweist bereits darauf, wie wichtig das Wasser war und sogar höher als Wein geschätzt wurde. Denn ohne Wein kann der Mensch sehr wohl leben, ohne Wasser jedoch nicht.
Auf dem Altar nun gab es an der südwestlichen Ecke ein Loch, durch das alle Flüssigkeiten in den Wasserlauf der Gichon-Quelle unterhalb des Tempels abgeleitet wurden. Warum dieses Abflussloch ausgerechnet an der südwestlichen Ecke des Altartisches lag, hat den ganz einfachen Grund, dass der so lebenswichtige Regen in Israel in aller Regel mit den südwestlichen Winden kommt, und daher befand sich das Loch auch an dieser so symbolträchtigen Stelle.
Und schließlich beginnt noch eine weitere rituelle Besonderheit zum Ende des Sukkot-Festes. Das bekannte Schmone Esre, das Achtzehn-Bitten-Gebet, das jeder Jude täglich dreimal beten muss, wird am letzten Tag von Sukkot um die Bitte ergänzt, dass es im kommenden Jahr zu seiner Zeit regnen möge. Und natürlich hat es auch einen Grund, dass diese Bitte erst am letzten Tag des Wallfahrtsfestes ausgesprochen wird, wie Avi Zur, Vorbeter in einer Synagoge in Hod Hascharon, erklärt:
"Es ist sehr wichtig, dass der Regen zu seiner Zeit kommt, denn ansonsten schadet er. Um von den nördlichen Grenzen des Landes bis zum Tempel zu laufen, brauchte man damals zwei Wochen, und die Bitte war, dass der Regen frühestens zwei Wochen nach Sukkot kommen möge. Warum? Damit er nicht die Pilger behinderte, die auf dem Weg nach Hause waren, und deshalb beten wir bis heute, dass der Regen nach dem 7. des Monats Heschwan kommen möge. Und so gibt es im Achtzehn-Bitten-Gebet zwei Zusätze. Der eine lautet: "Lass’ die Pilger unbeschadet heimkehren!", und der zweite: "Gib’ uns Deinen Segen!" Den zweiten Zusatz hat man nach dem 7. Heschwan eingefügt, denn dann waren die Pilger wieder zu Hause und es war die richtige Zeit für den Regen."
Ein weiterer Brauch von Sukkot schließlich hat sich bis in unsere Tage erhalten und kann vor allem in Jerusalem beobachtet werden: Simchat beit hascho’ewa, die Freude über das Wasser, von dem so sehr das Wohlergehen der Menschen abhängt. Ähnlich wie zu Simchat Torah tanzen die Männer mit fröhlichem Gesang auf dem Vorplatz der Westmauer, und es heißt, "Wer nicht die Freude von 'beit hascho'ewa' gesehen hat, hat nie im Leben eine Freude gesehen!"
Avi Zur: "Die Freude über das Wasser ist so stark, das sie keiner anderen gleicht. In der Praxis ist dies eine Form der Autosuggestion, eine Vorwegnahme des künftigen Zustandes auf spiritueller Ebene. Ich freue mich heute, damit meine Zukunft freudvoller wird. Und wenn ich mich heute über das Wasser freue, das man mir geben wird und woran ich ganz fest glaube, dann gibt mir die Freude heute das Wasser in der Zukunft."