Der Sprachmonteur
Von Jochen L. Stöckmann · 18.02.2011
Ferdinand Kriwet gilt als Pionier der Medienkunst. Die Kunsthalle Düsseldorf widmet ihm erstmals eine umfassende Retrospektive seines Werks. Gezeigt werden seine Neonschriften, Wandbemalungen sowie die Hörcollage "Apollo Amerika".
"Apollo 11", die Landung von drei Astronauten auf dem Mond, beherrschte 1969 die Medien – und hatte auch einen deutschen Künstler in die USA gezogen: Ferdinand Kriwet, professionell ausgerüstet mit Tonband und Kamera, mied den Journalistenpulk im Kennedy Space Center. Er saß in einem New Yorker Hotelzimmer, vor sich eine Batterie von acht Fernsehgeräten:
"Es ging ja darum, nicht über die Mondlandung zu berichten, es wurde ja pausenlos darüber berichtet. Ich wollte ganz simpel nur den Eindruck vermitteln, den das Medium Fernsehen auf mich als Deutschen, als Fremden in Amerika macht. Das hat mir natürlich auch Spaß gemacht – und dieses amerikanische Pathos, das ist ja fantastisch als Material."
Aus dem mehr oder weniger melodischen Klangteppich der Radiojingles und TV-Fanfaren hatte Kriwet charakteristische Momente herausgeschnitten und völlig neu montiert. Diese Quintessenz aus seinem Ton- und Bildmaterial wurde 1969 als "Hörtext" im Radio gesendet, der rasant geschnittene Dokumentarfilm "Apollovision" lief im WDR. Jetzt hat die Düsseldorfer Kunsthalle Kriwets Arbeiten versammelt – seine Demontage von Pathos und Propaganda wirkt nach über 40 Jahren frischer denn je:
In "Voice of America" nimmt Kriwet 1970 den Titel fast verbissen wörtlich, seziert einzelne Stimmen aus dem Programm des US-Senders. Der damals einsetzenden Medienberieselung setzt der 28-jährige Autodidakt keine ideologisch gefärbte Kulturkritik entgegen, sondern betrachtet Funk und Fernsehen ganz nüchtern – und auch spielerisch – als Material. Aber auch das Buchstabengestöber der Großstadt, etwa die Plakatwerbung, liefert Rohstoff für seine Experimente. Franz Mon, Nestor der Konkreten Poesie und Förderer des jungen Künstlertalents, schärft ihm ein: "Es gibt nichts sichtbares, was nicht auch lesbar wäre." Kriwet hält sich daran, lässt mit typografischem Geschick die Lettern tanzen, tippt auf der DIN-A3-Schreibmaschine wie aus dem Unbewussten heraus endlos lange "Leseblätter", verfremdet Slogans zum kreisrunden "Scheibentext". Ganze Museumswände sind damit bedeckt: ein Panorama aus Alltagsfragmenten und Realitätspartikeln, komponiert nach dem Muster von Kriwets Radioarbeiten:
"Jetzt musste ich gucken, was mache ich für ein akustisches Bild daraus, aus diesen ganzen Facetten? Dann habe ich eine Partitur gemacht, wie ich das nannte – und dann ging es ins Studio."
Auf der Hörfunkpartitur für "One Two Two" umreißt Kriwet Stimmhöhen und Duktus mit grafischen Diagrammen, vermerkt "Takes der Hitler-Rede nicht chronologisch montieren". So entstehen neue Wortgruppen, regelrechte Cluster, die einen verräterischen Subtext zum Vorschein, besser: zu Gehör bringen:
"Es geht um Sprache. Und darum, die unterschiedlichen Sprachtypen und Sprechweisen zu komponieren. Zum Beispiel bei der Hitler-Passage, da habe ich dann nur ein Wort genommen: "stark". Und das hat ja sowohl eine politische Aussage als eben auch ein rhetorisches Moment. Und das wollte ich auch zeigen."
Im Gegensatz zu den vordergründigen Späßen von Kabarettisten und Stimmimitatoren versteht es Kriwet, allen des Politikjargons überdrüssigen Hörern die Ohren zu schärfen. Als "Schrift-Steller" nimmt er die Sprache aber nicht nur beim Wort, sondern setzt sie auch ins Bild, ins Stadtbild: mit einem Wand-Emblem für den Landtag in Düsseldorf, dem Leitsystem für ein Unternehmen, der Beschriftung ganzer Silos. Und er veröffentlicht das Manifest "glück auf". Das war Anfang 1968 – und liest sich heute wie ein vorweggenommenes Drehbuch für den Stadtumbau der IBA und die Kulturhauptstadt 2010:
"Die Zechen wurden geschlossen, alle überlegten – ob Politik oder Wirtschaft – was machen wir nun? Es muss umstrukturiert werden. Und da habe ich gedacht, es könnte ja auch eine Kulturlandschaft werden, ein großes Kunstwerk von Duisburg bis Dortmund."
Wohlgemerkt: nicht monumental, sondern multimedial. Das war Kriwets Devise, und damit nahm er bei Buchobjekten wie "Rotor" die Idee des Hypertexts um Jahrzehnte vorweg.
"Es geht ja nicht nur um den Text, sondern es geht ums Lesen. Wie es beim Hörtext ums Hören geht. Nicht nur das Was, sondern auch das Wie. Und um die verschiedenen Lesevorgänge, vom plakativen bis zum dechiffrieren. "Rotor" war der Versuch, eine Mischung zu machen zwischen Buch und Album. Man kann drin herumlesen, wie man möchte, man wird nicht geführt."
Für jedermann frei verfügbar, in vielerlei Sinn zu interpretieren – das ist der durchaus politische Ansatz einer Kunst, die subtil verändert, die niemanden so aus dem Museum herauskommen lässt, wie er hineingegangen ist. Ganz im Geiste einer noch nicht durch kommerzielle Inanspruchnahme domestizierten Avantgarde, wie ihn die ready-mades des jungen Marcel Duchamp atmen:
"Man stellt eine Tasse ins Museum – und schon ist es, wie bei Duchamp, ein Kunstobjekt. Und wenn man die Tasse dann draußen sieht, sieht man sie wieder anders. So genau ist es auch mit der akustischen Wahrnehmung."
"Es ging ja darum, nicht über die Mondlandung zu berichten, es wurde ja pausenlos darüber berichtet. Ich wollte ganz simpel nur den Eindruck vermitteln, den das Medium Fernsehen auf mich als Deutschen, als Fremden in Amerika macht. Das hat mir natürlich auch Spaß gemacht – und dieses amerikanische Pathos, das ist ja fantastisch als Material."
Aus dem mehr oder weniger melodischen Klangteppich der Radiojingles und TV-Fanfaren hatte Kriwet charakteristische Momente herausgeschnitten und völlig neu montiert. Diese Quintessenz aus seinem Ton- und Bildmaterial wurde 1969 als "Hörtext" im Radio gesendet, der rasant geschnittene Dokumentarfilm "Apollovision" lief im WDR. Jetzt hat die Düsseldorfer Kunsthalle Kriwets Arbeiten versammelt – seine Demontage von Pathos und Propaganda wirkt nach über 40 Jahren frischer denn je:
In "Voice of America" nimmt Kriwet 1970 den Titel fast verbissen wörtlich, seziert einzelne Stimmen aus dem Programm des US-Senders. Der damals einsetzenden Medienberieselung setzt der 28-jährige Autodidakt keine ideologisch gefärbte Kulturkritik entgegen, sondern betrachtet Funk und Fernsehen ganz nüchtern – und auch spielerisch – als Material. Aber auch das Buchstabengestöber der Großstadt, etwa die Plakatwerbung, liefert Rohstoff für seine Experimente. Franz Mon, Nestor der Konkreten Poesie und Förderer des jungen Künstlertalents, schärft ihm ein: "Es gibt nichts sichtbares, was nicht auch lesbar wäre." Kriwet hält sich daran, lässt mit typografischem Geschick die Lettern tanzen, tippt auf der DIN-A3-Schreibmaschine wie aus dem Unbewussten heraus endlos lange "Leseblätter", verfremdet Slogans zum kreisrunden "Scheibentext". Ganze Museumswände sind damit bedeckt: ein Panorama aus Alltagsfragmenten und Realitätspartikeln, komponiert nach dem Muster von Kriwets Radioarbeiten:
"Jetzt musste ich gucken, was mache ich für ein akustisches Bild daraus, aus diesen ganzen Facetten? Dann habe ich eine Partitur gemacht, wie ich das nannte – und dann ging es ins Studio."
Auf der Hörfunkpartitur für "One Two Two" umreißt Kriwet Stimmhöhen und Duktus mit grafischen Diagrammen, vermerkt "Takes der Hitler-Rede nicht chronologisch montieren". So entstehen neue Wortgruppen, regelrechte Cluster, die einen verräterischen Subtext zum Vorschein, besser: zu Gehör bringen:
"Es geht um Sprache. Und darum, die unterschiedlichen Sprachtypen und Sprechweisen zu komponieren. Zum Beispiel bei der Hitler-Passage, da habe ich dann nur ein Wort genommen: "stark". Und das hat ja sowohl eine politische Aussage als eben auch ein rhetorisches Moment. Und das wollte ich auch zeigen."
Im Gegensatz zu den vordergründigen Späßen von Kabarettisten und Stimmimitatoren versteht es Kriwet, allen des Politikjargons überdrüssigen Hörern die Ohren zu schärfen. Als "Schrift-Steller" nimmt er die Sprache aber nicht nur beim Wort, sondern setzt sie auch ins Bild, ins Stadtbild: mit einem Wand-Emblem für den Landtag in Düsseldorf, dem Leitsystem für ein Unternehmen, der Beschriftung ganzer Silos. Und er veröffentlicht das Manifest "glück auf". Das war Anfang 1968 – und liest sich heute wie ein vorweggenommenes Drehbuch für den Stadtumbau der IBA und die Kulturhauptstadt 2010:
"Die Zechen wurden geschlossen, alle überlegten – ob Politik oder Wirtschaft – was machen wir nun? Es muss umstrukturiert werden. Und da habe ich gedacht, es könnte ja auch eine Kulturlandschaft werden, ein großes Kunstwerk von Duisburg bis Dortmund."
Wohlgemerkt: nicht monumental, sondern multimedial. Das war Kriwets Devise, und damit nahm er bei Buchobjekten wie "Rotor" die Idee des Hypertexts um Jahrzehnte vorweg.
"Es geht ja nicht nur um den Text, sondern es geht ums Lesen. Wie es beim Hörtext ums Hören geht. Nicht nur das Was, sondern auch das Wie. Und um die verschiedenen Lesevorgänge, vom plakativen bis zum dechiffrieren. "Rotor" war der Versuch, eine Mischung zu machen zwischen Buch und Album. Man kann drin herumlesen, wie man möchte, man wird nicht geführt."
Für jedermann frei verfügbar, in vielerlei Sinn zu interpretieren – das ist der durchaus politische Ansatz einer Kunst, die subtil verändert, die niemanden so aus dem Museum herauskommen lässt, wie er hineingegangen ist. Ganz im Geiste einer noch nicht durch kommerzielle Inanspruchnahme domestizierten Avantgarde, wie ihn die ready-mades des jungen Marcel Duchamp atmen:
"Man stellt eine Tasse ins Museum – und schon ist es, wie bei Duchamp, ein Kunstobjekt. Und wenn man die Tasse dann draußen sieht, sieht man sie wieder anders. So genau ist es auch mit der akustischen Wahrnehmung."
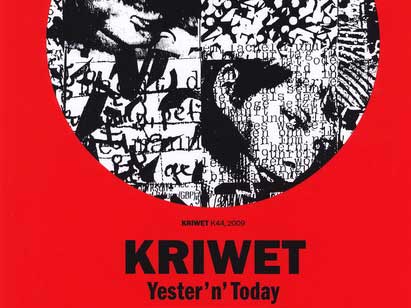
Ausstellungsplakat: Ferdinand Kriwet "Yester'n'Today"© Kunsthalle Düsseldorf
