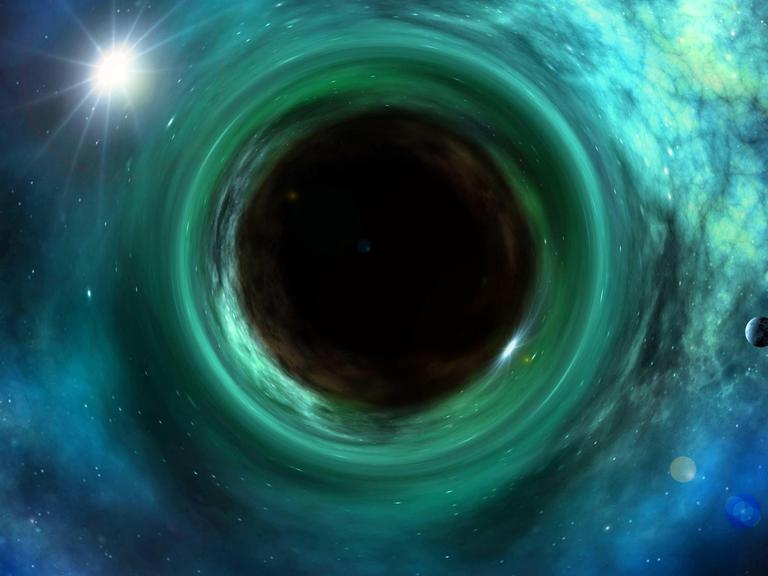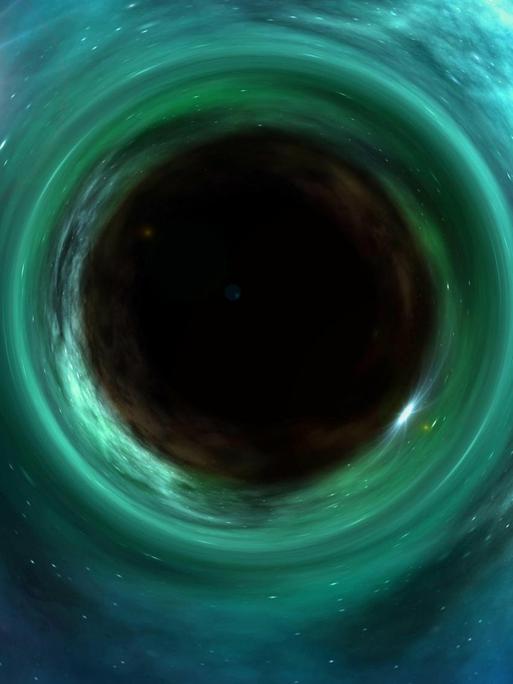Was der Himmel uns zu sagen hat
06:23 Minuten

Von Arno Orzessek · 10.10.2020
Der Philosoph Peter Sloterdijk bescheinigt den menschlichen Erdenbewohnern ihre anhaltende Rückständigkeit: Noch immer benähmen sie sich, als ob sie nicht wüssten, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Nachzulesen in der „Zeit“.
Eigentlich ist ja die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG auf Besinnungsaufsätze spezialisiert, die genauso gut vor drei Jahren hätten erscheinen können wie in drei Jahren. In der vergangenen Woche jedoch war es die Wochenzeitung DIE ZEIT, die sich auf der Seite "Sinn & Verstand" einer Frage widmete, die man spätestens seit Friedrich Nietzsches "Gott ist tot" jede Woche hätte stellen können – nämlich: "Hat uns der Himmel noch etwas zu sagen?"
Die Antwort gab Peter Sloterdijk, der einen vergleichsweise soften, sinnenden, man könnte sagen, fast Hans-Blumenberg’schen Ton anschlug und am Ende aus stark erhöhter Perspektive zum Umweltschutz aufrief:
"Vom Himmel, der sich als Hort der Unlebbarkeit erweist, fällt ein verfremdeter Blick auf den kleinen blauen Planeten. Aus der Höhe betrachtet, weist er eine dünne atmosphärische Hülle auf, die einen noch viel dünneren biosphärischen Film bedeckt. Beide, die Hülle wie der Film, sind als naturwüchsige erdbasierte Lebensunterstützungssysteme zu begreifen. Der Kultivierung beider müsste in einem künftigen Erdmanagement die höchste Priorität zukommen."
Peter Sloterdijks Blick in den Himmel
Sie meinen, Sloterdijk habe da nur eine, wenn auch hübsch formulierte, Banalität vorgetragen? Okay – vielleicht werden folgende Nachsätze Ihren Ansprüchen gerecht:
"Nun zeigt sich erst, wie weit die auf den Erdoberflächen verstreuten Sterblichen noch immer davon entfernt sind, ihrer nachkopernikanischen Kondition gerecht zu werden. Sie verhalten sich in ihrer großen Mehrheit so, als wollten sie um nichts in der Welt begreifen, wie ihre Erde um die Sonne stürzt. Sie müssten erst die unvermeidbare kosmische Panik durchgestanden haben, wenn sie dem letzten Wort des Himmels vor seinem Verstummen gehorchen wollten: dem Auftrag, einen sorgenden Geozentrismus hervorzubringen."
Für die Erforschung der Schwarzen Löcher in selbigem Himmel gab's den Physik-Nobelpreis. Aber glaube niemand, deshalb sei geklärt, was in den vertrackten Löchern eigentlich genau drin ist: "Wir wissen es nicht. Sie repräsentieren die Grenze unseres physikalischen Verständnisses", zitierte die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG die US-amerikanische Astronomin Andrea Ghez, die den Preis gemeinsam mit dem britischen Theoretiker Roger Penrose und dem deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel erhält.
Hohn und Spott für Louise Glück
Der Literaturnobelpreis geht unterdessen an die US-Amerikanerin Louise Glück. Eine Entscheidung, angesichts derer die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG in Hohn und Spott verfiel: "Wer?", fragte die SZ und veröffentlichte im Stil eines Satiremagazins "eine Würdigung der Nobelpreisträgerin Louise Glück (erster, gescheiterter Versuch)":
"Dass auf Nachfrage am Donnerstag nur einer von vielen Kennerinnen und Kennern jemals einen Text von Louise Glück gelesen hatte, spricht nicht gegen Louise Glück. So verzehrt sich zum Beispiel das Nobelpreiskomitee seit jeher nach der Lyrik der Autorin. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Stockholm zuschlagen und den Feuilletons eine Nase drehen würde", ätzten Willi Winkler und Alexander Gorkow, wurden aber von Tobias Lehmkuhl in einem zweiten Artikel noch überboten:
"Die literarischen Werte, das muss man wieder einmal so sehen, wurden mit dieser Preisentscheidung mit Füßen getreten. Denn blättert man in Glücks Band ‚Wilde Iris’, herrscht allerorten höchster Kitschalarm: ‚depressiv ja, aber doch leidenschaftlich / dem lebendigen Baum zugetan, mein Körper / sogar in den gespaltenen Stamm geschmiegt, beinah friedvoll, im Abendregen / beinah fähig zu fühlen, / wie Saft schäumt und steigt.' Manch einem steigt da die Galle hoch", monierte der SZ-Autor Lehmkuhl.
Aber auch Lob – wenngleich mit Einschränkungen
Erkennbar weniger in Haudraufstimmung zeigte sich Gregor Dotzauer im Berliner TAGESSPIEGEL.
"Glück, die ein enges Verhältnis zur Psychoanalyse pflegt, weiß genau, was es heißt, zerstörerische Energien zu kanalisieren. Man kann ihre Texte auf Biografisches beziehen, die jugendliche Magersucht und die beiden schwierigen, bald geschiedenen Ehen. Doch die Verwandlung ist offensichtlich, und dass sie in ihren Texten einen Wesenskern berührt, an den sie in der sprachlichen Vermittlung zugleich nicht heranreicht, macht das literarische Kippmoment von Nähe und Distanz in ihren Gedichten aus."
Den letzten Satz des klugen Gregor Dotzauer stellen wir hiermit unter Schwurbelverdacht.
Dietmar Dath, sonst urteilssicher bis dort hinaus, fragte in der FAZ unterdessen leicht verunsichert:
"Begönnert man die Dichterin mit modischer Gender-Galanterie, wenn man sie als entschieden weibliche Stimme liest? Ein altes, allerlei Gewohnheiten implizites Sozialdekret nicht nur des Abendlandes sieht ‚die Frau‘, weil sie Kinder kriegen kann, während der Mann sich in Werken fortsetzt und verewigt, als Naturwesen. Louise Glück liebt dezente Irreführungen auf diesem Glatteis und spricht daher mit der Natur oft vertraulicher als mit dem lesenden menschlichen Gegenüber."
Herbert Feuerstein war "der Größte"
Viele, wie immer allzu viele, sind in der vergangenen Woche für immer verstummt – hier wenigstens Sekunden der Erinnerung an sie:
"Mit Günter de Bruyn ist der liebenswürdigste und bescheidenste Schriftsteller gestorben, den die DDR hervorgebracht hat", mobilisierte die Tageszeitung DIE WELT gleich zwei Superlative.
Über Günter de Bruyns Kollegin und KZ-Überlebende Ruth Klüger schrieb Hubert Spiegel in der FAZ: "Scharf die Zunge, weiblich die Perspektive. Das Ungeheuere blieb ihr geläufig."
Während der TAGESSPIEGEL den Rockgitarristen Eddie van Halen als "Lichtgeschwindigkeitsvirtuose" verabschiedete, hielt die NZZ unter einem Foto, das Eddie völlig ausgerastet beim Jumpen auf der Bühne zeigt, konsterniert fest: "Der Zauberer der Rockgitarre ist tot."
Nach Ansicht der SZ wiederum war der übersichtlich emporgewachsene Humorriese Herbert Feuerstein schlicht "Der Größte".
Ja, das ist traurig – wenn man die Toten umständehalber summarisch verabschieden muss. Trotzdem oder gerade deshalb möchten wir Ihnen, was den Sonntagsvertreib angeht, eine Überschrift der SZ als Parole nahelegen. Sie lautet: "Keine Zeit für Unglück".