Stefanie Graefe (PD Dr. phil.), geb. 1966, ist Soziologin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ihre Arbeits- und Interessensgebiete sind Gesellschaftstheorie und -kritik, Subjektivität und gesellschaftlicher Wandel, Bio- Gesundheits- und Alter(n)spolitiken, qualitative Sozialforschung.
Therapie oder Arbeitskampf - was hilft gegen Burnout?
29:44 Minuten
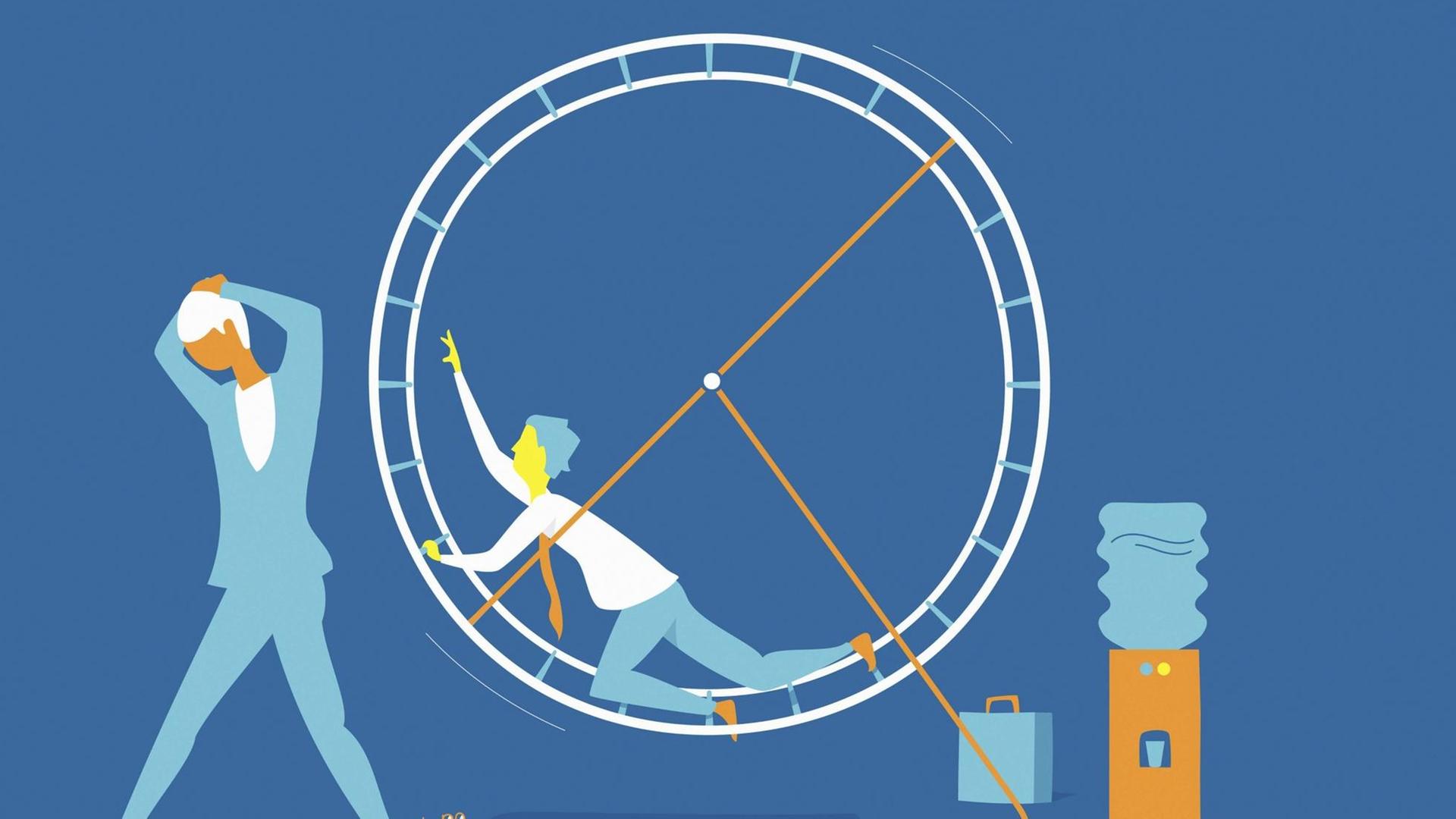
Moderation: Susanne Führer · 20.04.2019
Der Anteil der psychischen Erkrankungen an den Arbeitsunfähigkeitstagen steigt seit Jahren an. Ein Zeitgeistphänomen? Oder liegt es an der neuen Arbeitswelt, die den „ganzen Menschen“ fordert? Wären dann die Leidenden zu therapieren – oder das System?
In der heutigen Arbeitswelt sind wir gefordert, uns als ganze Persönlichkeit in die Arbeit einzubringen, uns mit unserer Arbeit zu identifizieren, sagt die Soziologin Stefanie Graefe von der Universität Jena. Zwar seien die Handlungs- und Entscheidungsspielräume für viele Menschen größer geworden, die Autonomie habe also zugenommen. Doch seien ihr durch gesetzte Termine und geforderte Leistungen wiederum enge Grenzen gesetzt.
Parallel hat die "Therapeutisierung des Sozialen" dazu geführt, dass bei Arbeitsüberlastung nicht die Bedingungen der Arbeit, sondern der überlastete Mensch als Problem angesehen wird. Therapie soll dann beispielsweise die Stressresistenz erhöhen.
Denkbar ist aber auch, so Stefanie Graefe, dass Therapie kritische Distanz schafft und ermuntert, sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen zu wehren. Von den Psychotherapeuten in Deutschland wünscht sie sich, dass sie sich auch zu gesellschaftspolitischen Fragen äußern.
Arbeitsbedingungen seien kein Naturphänomen, sondern "von Menschen gemacht und können von Menschen geändert werden."
Das Gespräch im Wortlaut
Deutschlandfunk Kultur: Wir wollen uns heute auf die Spur eines gesellschaftlich relativ jungen Phänomens begeben: Die Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen nehmen stetig zu, also Depression oder depressive Erschöpfung oder auch Burnout. Immer mehr Menschen geben an, darunter zu leiden und werden deswegen auch krank geschrieben.
Welche Gründe es dafür geben könnte, darüber spreche ich mit der Soziologin Dr. Stefanie Graefe von der Universität Jena.
Fangen wir mal ein bisschen spitz an: Wir leben ja, wenn man von außen guckt, in einer ziemlich geordneten, wohlhabenden, friedlichen Gesellschaft. Die Menschen, die heute arbeiten, haben im Allgemeinen keine Kriege, keine Katastrophen miterleben müssen – anders als die Generationen unserer Eltern oder Großeltern, die wir aus heutiger Warte als schwer traumatisiert bezeichnen würden. Aber es ist ja nun heute so, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen wächst. Ist das also, wie soll ich mal sagen, so ein Zeitgeist-Phänomen?
Graefe: Das kommt darauf an, was man unter Zeitgeist versteht. Wenn man es in einem sehr allgemeinen Sinne versteht - ist es typisch für unsere Zeit, und sagt etwas über die Zeit aus, in der wir leben, und über die Gesellschaft aus, in der wir leben -, dann würde ich das eindeutig bejahen. Es ist auf jeden Fall ein Zeitgeistphänomen, weil es einen interessanten Einblick gibt, was in unserer Gesellschaft - die Sie als eine friedliche Gesellschaft beschrieben haben, als eine Gesellschaft, in der es auch relativ viel Wohlstand gibt, was richtig ist, aber nur die eine Seite der Medaille ist -, was in unserer Gesellschaft auch als Problem erlebt wird.
Zeitgeist in dem Sinne, dass es sich um eine Modeerscheinung handelt, dass man depressiv erschöpft ist oder Burnout hat, weil es schick ist, weil man sich damit hervortun möchte, das würde ich infrage stellen. Es gibt diese Tendenzen, ganz klar. Wir haben auch dieses Phänomen, dass Prominente gerne über ihre Burnout-Erfahrung sprechen. Aber damit wäre, glaube ich, das Phänomen nicht ausreichend beschrieben. Damit kann man es jetzt auch nicht einfach ad acta legen. Also, wir haben es tatsächlich mit einer Veränderung von Arbeits- und Lebensbedingungen zu tun, die man sich angucken muss, die auch etwas damit zu tun haben, dass Menschen jetzt häufiger diese Diagnosen bekommen und deswegen auch arbeitsunfähig geschrieben werden.
Soziale Konflikte werden als psychische Konflikte verstanden
Deutschlandfunk Kultur: Lassen Sie uns aber noch einen Moment bei dem Zeitgeist bleiben. Wenn man mal versucht, was einem ja schwer fällt, zu seiner eigenen Zeit etwas Distanz einzunehmen, aber wenn wir mal versuchen, auf die Diskurse unserer Gesellschaft zu schauen, dann gibt es eigentlich kein Feld, das dieser Psychologisierung entgeht. Eigentlich alle Konflikte, ob es die am Arbeitsplatz gibt oder: Kriege, Naturkatastrophen interessieren uns eigentlich am meisten mit den Traumata, die durch sie verursacht werden. Es wird im Grunde genommen alles psychologisiert.
Es geht ja manchmal bis zum Nahostkonflikt, dass es also wohlmeinende Menschen gibt, die sagen, man müsste einfach nur mal eine gute Mediation machen, Israelis und Palästinenser, und dann werdet ihr euch schon einigen. – Das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass diese psychotherapeutischen, psychologischen Kategorien so verbreitet sind in der Alltagssprache, im Alltagsdenken auch, dass es uns gar nicht mehr auffällt.
Graefe: Das ist jetzt wiederum eine Diagnose, die ich absolut teilen würde. Und das halte ich auch für eine ausgesprochen problematische Entwicklung; nämlich, dass gesellschaftliche Probleme oder eben auch Konflikte zunehmend in therapeutischen Begriffen beschrieben und verhandelt werden, so dass die Botschaft heißt: "Also, wenn du es schaffst, an dir zu arbeiten und dazu gegebenenfalls Expertenunterstützung in Anspruch nimmst, denn allein kannst du es ja wahrscheinlich doch nicht, also mindestens musst du dir mal einen Ratgeber zulegen, in dem das erklärt wird, wie du das machen sollst, am besten gehst du aber zum Therapeuten oder ins Coaching, um es dir erklären zu lassen." Diese Entwicklung würde ich jetzt aber nicht unmittelbar ursächlich dafür ansehen, dass es steigende Erschöpfungszahlen gibt. Das hat damit zu tun, aber ist sicherlich nicht die einzige Ursache.
Wir haben aber tatsächlich diese Tendenz. Wir sprechen in der Soziologie auch von der Therapeutisierung des Sozialen. Das heißt, was ehemals als soziale Konflikte verstanden wurde, wird jetzt zunehmend als psychischer Konflikt verstanden oder als Konflikte, die sich auf einer Beziehungsebene abspielen. Das ist natürlich eine Täuschung, das stimmt natürlich nicht. Namentlich bei Konflikten im Bereich der Arbeit ist das eine hochproblematische Entwicklung, wenn gesagt wird, du als Arbeitnehmerin hast ein Problem mit Überlastung und Überforderung, dann musst du eben in Therapie gehen oder dir einen Coach suchen oder ein Resilienz-Training machen - das ist jetzt der neueste Trend. Damit wird natürlich versucht, das Konfliktpotenzial zu entschärfen.
Deutschlandfunk Kultur: Ich möchte nur zwei Fakten nennen. Das eine ist das DSM, das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen. Alles, was darin auftaucht an Störung, ist eine anerkannte psychische Krankheit. Und da können wir das Phänomen beobachten - das gilt für somatische Erkrankungen übrigens auch, aber jetzt sind wir ja bei den psychischen Leiden -, mit jeder Ausgabe, ich glaube, wir sind jetzt beim DSM 5, wird das Ding dicker und dicker, und die Anzahl der psychischen Störungen nimmt rasant zu. Wie ja auch die Anzahl der Psychotherapeuten in Deutschland in den letzten Jahren stetig angewachsen ist. Die Zahl der Therapien ist damit auch stetig angewachsen und eben die Zahl der psychischen Erkrankungen.
Graefe: Das ist so. Und das wird auch sehr kritisch diskutiert. Das DSM-5, 2013 erschienen, ist ein Manual von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft herausgegeben, in dem psychische Erkrankungen definiert werden, das sehr einflussreich ist. Das erste wurde in den 50er Jahren herausgegeben, und jetzt ist die fünfte Version am Markt sozusagen. Und die Anzahl der Diagnosen, die darin erfasst sind, hat sich deutlich mehr als verdreifacht. Das heißt, wir haben es eigentlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mit einer deutlichen Steigerung von Diagnosen zu tun, die darin aufgenommen werden.
Das heißt, umgekehrt könnte man sagen: Immer mehr Bereiche des menschlichen Lebens, die wir vor zehn, zwanzig, dreißig, vierzig Jahren noch als ganz normalen Bestandteil unseres Daseins angesehen haben, bekommen jetzt Krankheitswert.
Bei dem aktuellen DSM ist ein besonders strittiger Punkt, dass Trauer als Depression definiert wird, als depressive Störung, wenn die schwere Trauer, zum Beispiel bei dem Tod eines nahen Angehörigen, länger als zwei Wochen andauert. Das ist natürlich was, wo man sofort sagt: Das ist absurd.
Also, es werden Dinge, die einfach zum menschlichen Dasein dazu gehören, als Krankheiten definiert und werden eben immer mehr als auch medizinisch zu behandelnde, durch Experten zu behandelnde Phänomene verstanden. Das bedeutet natürlich, dass wir auch ein ganzes Stück unserer Handlungsfähigkeit abgeben und an Experten delegieren. Und das ist in der Tat eine problematische Entwicklung.
Mehr Verantwortung für ein mehr an Leistungsfähigkeit
Deutschlandfunk Kultur: Ja, das ist eine Folge. Und die andere Folge dieser Therapeutisierung des Sozialen, wie Sie es bezeichnet haben, ist ja, dass die Probleme immer individualisiert werden. Also, es liegt immer an der jeweiligen Person, der es gerade nicht gut geht, dass es ihr nicht gut geht.
Graefe: Ja, es wird individualisiert. Es wird Verantwortung zugeschrieben, wir werden verantwortlich gemacht. Wir werden dazu aufgefordert, Verantwortung für uns selbst zu unternehmen, äh, zu übernehmen (lacht) und zu unternehmen auch in dem Sinne, dass wir eben an unserer Leistungsfähigkeit, an unserer Produktivität selber arbeiten sollen. Also, es geht auch immer darum, die eigenen Möglichkeiten zu erweitern und zu verbessern. Das ist in der Tat eine Tendenz, die auch zunehmend früh einsetzt, die im Grunde eine Objektivierung des Selbst mit sich führt.
Also, wir werden sehr früh, inzwischen passiert das teilweise schon in Grundschulen, dazu angehalten, uns selbst zu reflektieren. Im Hinblick zum Beispiel auf unsere Kompetenzen werden Kinder dazu aufgefordert, das selber zu reflektieren. Das ist in gewisser Weise folgerichtig, weil es sie tatsächlich auf genau das vorbereitet, was später am Arbeitsmarkt von ihnen verlangt wird. Es ist natürlich aber die Frage, ob das eine wünschenswerte Entwicklung ist, wenn wir uns quasi in einem permanenten Reflektionsprozess über uns selbst befinden, der letztlich darauf hinausläuft, dass wir unsere Ressourcen und Kompetenzen optimieren sollen.
Da ist auch eine Steigerungsidee enthalten, also die Idee, dass es immer noch besser geht, dass ich immer noch perfekter sein könnte und dass ich an meinen Schwächen arbeiten kann, was natürlich indirekt auch wieder dazu beitragen kann, dass die Erschöpfungsanfälligkeit steigt, weil ich feststelle: Auch meinen eigenen Vorstellungen, meinen eigenen Ansprüchen kann ich im Grunde gar nicht genügen. Und diese werden auch immer ununterscheidbarer von den Ansprüchen, die uns die Gesellschaft entgegen hält.
Deutschlandfunk Kultur: Okay, dann widmen wir uns dem Phänomen jetzt mal von einer anderen Seite. Wir haben diese Tatsache, dass die Zahl der Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen steigt, seit mehreren Jahren regelmäßig immer weiter ansteigt. Und ob jetzt Zeitgeistphänomen oder nicht, man kann auf jeden Fall festhalten, die Menschen leiden ja offenkundig unter etwas. Und wenn es jetzt nicht die individuelle Psyche ist, dann könnten wir vielleicht doch mal fruchtbarerweise einen Blick auf die Arbeitswelt werfen und der Frage nachgehen, ob eben die Zunahme der Arbeitsausfälle vielleicht mit den Arbeitsbedingungen selbst zu tun hat.
Was ist denn - wenn wir mal vergleichen mit den 60er Jahren, den 50er Jahren -, was ist denn an unserer Arbeitswelt heute so anders, woraus man begründen könnte, dass die Menschen seelisch mehr krank werden als früher?
Graefe: Also, da hat sich ganz viel sehr grundlegend verändert.
Ich würde gern noch einen Satz zu dem Punkt vorher sagen, zu der Frage des Anstiegs der psychischen Diagnosen. – Ich habe ja eben gesagt, dass ich das nicht so gerne auf den Zeitgeist reduzieren möchte. Wir können aber davon ausgehen, dass wir es tatsächlich auch mit einer Diagnoseverschiebung zu tun haben, dass Symptome, die heute als psychische Diagnosen in den Statistiken auftauchen, weil sie von den Hausärzten - die sind es ja sehr häufig, die diese Diagnosen stellen - so gestellt wurden, dass diese Symptome vor zwanzig, dreißig Jahren als andere Diagnosen in den Statistiken aufgetaucht sind. Zum Beispiel als Rückenschmerzen, als Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörungen usw.
Wir können davon ausgehen, dass es da eine veränderte gesellschaftliche Sensibilität gibt. Das ist auch ganz gut dokumentiert. Die DAK zum Beispiel hat eine Befragung unter Hausärzten gemacht und sie gefragt, ob und wie sich ihr Diagnoseverhalten verändert hat in den letzten Jahren. Und die Hausärzte haben sehr deutlich gesagt, dass sie selbst eine andere Sensibilität haben – also, Burnout zum Beispiel wird überhaupt erst seit 2004 diagnostiziert, das macht natürlich einen Unterschied, ob es so einen Begriff gibt oder nicht –, und dass die Patienten auch mit einer anderen Erwartung in die Praxis kommen und häufig selber schon diese Erwartung haben, dass sie eine entsprechende Diagnose bekommen.
Das bedeutet aber noch nicht, dass es eine reine Erfindung ist. Und damit sind wir jetzt bei den veränderten Arbeitsbedingungen. Die sind natürlich sehr vielfältig, weil sich da sehr viel auf unterschiedlichen Ebenen verändert hat; wichtige Stichworte: Globalisierung, Flexibilisierung. In der Soziologie setzt man so grob den Übergang, den Schnitt in den 70er Jahren an, das ist natürlich ein längerer Prozess.
Dann sprechen wir auch von der sogenannten Subjektivierung von Arbeit. Das ist ein soziologischer Begriff, der ein bisschen sperrig ist, der aber gut auf den Punkt bringt, worum es geht, nämlich, dass wir in sehr vielen Arbeitsbereichen immer mehr aufgefordert sind, uns als ganze Person, als ganze Persönlichkeit, als ganzes Subjekt in die Arbeit einzubringen.
Es reicht also nicht mehr, morgens zur Arbeit zu gehen, seine Persönlichkeit sozusagen an der Garderobe abzugeben, wie das bei dem klassischen Arbeitnehmertypus der Fall ist. Der Begriff sagt es im Grunde schon: Man geht zur Arbeit, man erledigt seine Aufgaben, Arbeit ist ein notwendiges Übel. Und wenn die Arbeit dann endlich vorbei ist, dann geht man nach Hause und wird dann eigentlich erst zum ganzen Menschen. – Das funktioniert in vielen Arbeitsbereichen schon ganz lange nicht mehr.
Größere Handlungs- und Entscheidungsspielräume
Deutschlandfunk Kultur: Jetzt ist der ganze Mensch auf der Arbeit.
Graefe: Jetzt ist der ganze Mensch auf der Arbeit gefordert. Und das bedeutet zum einen, dass ich meine eigene Motivation immer wieder selbst herstellen muss. Zum anderen bedeutet es, dass Kompetenzen eingefordert werden, die sich nicht auf eine rein funktionale Ebene oder auf eine reine Ebene von Fachwissen reduzieren lassen. Also: Ich muss teamfähig sein, ich muss kooperationsfähig sein, ich muss mich selbst organisieren können. Das ist eine Kernanforderung, weil die Arbeitsprozesse so komplex geworden sind und weil sie sich vor allen Dingen auch sehr häufig ändern. Viele Unternehmen sind in einem ständigen Reorganisationsprozess befangen. Ständig werden Abteilungen neu zusammengelegt, verlegt, geschlossen, Standorte verändert usw. Das muss ich als Beschäftigte verarbeiten können.
Deutschlandfunk Kultur: Aber sich selbst organisieren können, das klingt doch erstmal toll. Das klingt doch nach mehr Eigenverantwortung, nach mehr Autonomie. Ich muss nicht immer stumpf das machen, was meine Chefin sagt.
Graefe: Genau. Das ist die positive Seite. Die Handlungs- und Entscheidungsspielräume sind für viele Menschen in ihrer Arbeit größer geworden. Allerdings ist das ein sehr widersprüchlicher Prozess. Auf der einen Seite sind sie größer geworden, das bezieht sich aber sehr häufig auf diese Selbstorganisationsfähigkeiten. Also, ich kann selbst organisieren, wie ich das Projekt zu Ende bringe, denn Arbeit ist für mich ein Projekt geworden. Ich kriege zum Beispiel den Abgabetermin gesetzt. Und wie ich es jetzt anstelle, dass ich an dem Termin das Projekt fertig habe, bleibt mir ein Stück weit selbst überlassen. Das ist tatsächlich in gewisser Weise eine Zunahme von Autonomie.
Das beißt sich aber damit, dass häufig die Projekttermine, so eng gesetzt sind, dass mir im Grunde gar nichts anderes übrig bleibt, als alle Energie und alle Zeit, die ich habe, da rein zu investieren. Das schränkt die Freiheit dann natürlich schon wieder stark ein. Und auf der anderen Seite läuft das Ganze parallel mit Kontrollmechanismen, mit Standardisierungsprozessen, mit Dokumentationspflichten zum Beispiel, die auch dieser viel beschworenen Freiheit deutlich entgegen laufen.
Deutschlandfunk Kultur: Dazu passt auch, dass es immer häufiger eine sogenannte Vertrauensarbeitszeit gibt. Also, es wird nicht mehr kontrolliert: Du, du, bist du auch immer brav von 9 bis 17 Uhr 30 Uhr hier? Hältst du auch deine 38,5- oder Vierzig-Stundenwoche ein?
Erhebungen zeigen, dass die Menschen im Durchschnitt mehr arbeiten als sie müssten, wenn es diese Vertrauensarbeitszeit gibt.
Graefe: Ja. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Geschäft für Arbeitgeber, Vertrauensarbeitszeit einzurichten, weil es tatsächlich in aller Regel dazu führt, dass die Menschen mehr arbeiten. Ich glaube, Sie und ich können das beide aus unserem eigenen Arbeitshintergrund bestätigen. Sowohl Journalismus als auch Universität oder wissenschaftliche Arbeit sind sozusagen prototypisch für diese Form von Arbeit. In meiner Arbeit ist es vollkommen egal, ob ich das sonntagabends mache oder nachts um drei oder wann auch immer. Es muss eben gemacht werden. Für mich ist es völlig normal, am Wochenende zu arbeiten. Ich kenne es eben auch nicht anders und nehme das als gesetzt hin.
Identifikation mit der Arbeit kann zu Überlastung führen
Deutschlandfunk Kultur: Aber das galt für Professoren wahrscheinlich schon immer.
Graefe: Genau. Was jetzt neu ist, und das ist das Interessante, ist, dass diese Logik von Arbeit, die wir früher - also vor dieser Veränderung, vor diesem Übergang, der seit den 70er Jahren erfolgt - für ganz bestimmte begrenzte Segmente hatten, sich jetzt ausweitet auf sehr viele Formen von Arbeit und von Beschäftigung. Do wird diese Art von Selbstorganisation und Engagement verlangt und muss geleistet werden, wenn man die Arbeitsmenge und auch die Komplexität der Arbeit bewältigen muss.
Jetzt gibt es Unternehmen, die versuchen dagegen zu steuern. Die schalten dann beispielsweise am Freitag die Server ab. Das ist eine kleine Anerkenntnis der Problematik, aber möglicherweise verschärft sie sie nur, weil dann am Montag entsprechend die doppelte Anzahl von Emails bearbeitet werden muss, was das Problem nicht unbedingt löst.
Deutschlandfunk Kultur: Ich weiß nicht, ob die Zeit, die für die Arbeit aufgewendet wird, unbedingt das Problem ist, wir kommen ja von der Sechzigstundenwoche her, oder nicht eher die innere Verbundenheit mit der Arbeit. Wir haben über Autonomie gesprochen, der ganze Mensch ist gefordert. Die Menschen hatten ja schon immer Angst vor Arbeitslosigkeit, nicht nur aus materiellen Gründen, sondern weil Arbeit natürlich auch mit gesellschaftlichem Status einhergeht, und man hat Kolleginnen und Kollegen im Allgemeinen. Aber ich glaube, heute ist noch so etwas dazu gekommen, was ich "Sinn" nennen würde. Also, für viele Menschen ist die Identifikation mit der Arbeit einfach sehr groß.
Graefe: Ja. Das hat sich deutlich verändert, das können wir auch in Untersuchungen immer wieder feststellen, dass es für Menschen ganz wichtig ist, dass sie sich mit ihrer Arbeit identifizieren können, dass sie das Gefühl haben, sie können sich selbst einbringen, sie können sich in ihrer Arbeit selbst verwirklichen, um jetzt mal diesen Begriff zu verwenden. Das wird zum Teil durchaus so erlebt.
Aber wenn man den Eindruck hat, ich kann mich in meiner Arbeit selbst verwirklichen oder möglicherweise kann ich mich auch nur in meiner Arbeit selbst verwirklichen, dann führt es auf der anderen Seite dazu, dass man bereit ist, belastende Arbeitsbedingungen länger hinzunehmen, weil man ja immer davon ausgeht: Ich bin es ja auch selbst, die das so will. – Und da steckt natürlich in gewisser Weise eine Täuschung drin.
Deutschlandfunk Kultur: Natürlich, wenn die Arbeit den Sinn meines Lebens ausmacht, dann gibt es keinen Grund, die sinnhafte Zeit auf vierzig Stunden in der Woche zu beschränken.
Graefe: Genau. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass Menschen freiwillig sechzig, siebzig Stunden arbeiten, dann sind wir in dem Bereich dessen, wo man vielleicht sagen könnte, das ist auch pathologisch, das ist ein Thema der Arbeitssucht. Aber auch unterhalb so einer (wiederum möglicherweise problematischen) Diagnose können wir feststellen, dass die Bereitschaft, sich mit der eigenen Arbeit zu identifizieren, bei vielen Menschen sehr groß ist und damit auch die Bereitschaft, entgrenzt zu arbeiten, also Arbeitszeiten zu überschreiten, auch wenn sie nicht entlohnt werden, Arbeit mit nach Hause zu nehmen, Arbeit zumindest gedanklich oder gefühlt mit nach Hause zu nehmen, also sehr stark damit verbunden zu bleiben.
Und das hat wiederum auch damit zu tun, dass wir inzwischen auch eine Dienstleistungsgesellschaft sind. Das heißt, wir haben viele Arbeitsbereiche - viel mehr als noch vor fünfzig Jahren -, in denen Menschen am Menschen arbeiten und mit Menschen arbeiten. Das ist natürlich in einem ganz anderen Maße anfällig für diese Art von Überidentifikation und auch von Überhöhung der Bedeutung für das eigene Leben.
Arbeit mit Emotionen sehr belastend
Deutschlandfunk Kultur: Und das Tempo ist ja enorm gewachsen, die Produktivität ist enorm gewachsen. Und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier nur über wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen und Journalisten sprechen. Deswegen habe ich mir das mal rausgesucht: Die Berufsgruppe mit den meisten Arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund von Burnout-Erkrankungen ist das Dialogmarketing, also auf gut Deutsch die Arbeit im Callcenter.
Graefe: Ja. Das ist ein gutes Beispiel, die Arbeit im Callcenter, weil man daran sehen kann, was sich an der Arbeit verändert hat und was daran belastend ist. Im Callcenter arbeitet man am Telefon, logischerweise, mit Kunden, Kundinnen, denen man entweder etwas verkaufen soll, was die möglicherweise von sich aus nicht kaufen möchten, oder im Beschwerdemanagement. Das heißt, man arbeitet an Emotionen und mit Emotionen. Man muss mit Emotionen von Menschen umgehen. Man soll sie hervorrufen. Man soll sie in einer bestimmten Art und Weise lenken. Das ist für uns als Menschen sehr belastend.
Warum das belastend ist, ist eine spannende Frage und nicht ganz eindeutig zu beantworten. Am plausibelsten scheint mir die These, dass wir davon ausgehen, dass Emotionen etwas sehr Privates und zugleich der Bereich sind, wo wir so sein können wie wir sind und wo wir eben nicht fremden Anforderungen genügen müssen. Emotional zu sein verbinden wir sehr stark mit Authentizität. Dann bin ich so, wie ich bin.
Und wenn jetzt die Anforderung an mich gestellt wird, entweder eigene Emotionen produktiv zu machen oder andere Leute zu manipulieren in ihrer Emotionalität auf ein bestimmtes Ziel hin, dann widerspricht das einer Grundethik, die viele von uns noch für selbstverständlich halten.
Es gibt dazu spannende Untersuchungen. Eine klassische Untersuchung ist von Arlie Hochschild. Sie hat untersucht wie Stewardessen ausgebildet werden. Hochschild hat beschrieben, dass die Stewardessen in diesen Trainings angehalten werden, sich in der Kabine zu verhalten wie im eigenen Wohnzimmer. Sie sollen die Fluggäste als persönliche Gäste, als ihre Freunde behandeln und entsprechend auch auftreten. Und sie sollen vor allen Dingen nicht nur so tun, als wäre es so, sondern sie sollen es möglichst auch so empfinden.
Hochschild beschreibt, zu welchen Problemen das bei den Stewardessen zu Hause führt, wenn sie dann in ihrem tatsächlichen Wohnzimmer sitzen und nicht mehr genau wissen, ob sie jetzt in der Kabine sind oder im Wohnzimmer. Also, es ist für sich genommen eine Belastung, wenn ich an Emotionen arbeite.
Burnout wurde erstmalig von Herbert Freudenberger aus New York festgestellt, einem Sozialarbeiter und Psychoanalytiker, der das für seine eigene Zunft festgestellt hat. Im Klischee ist Burnout die klassische Sozialarbeiterkrankheit; Menschen, die an Menschen arbeiten, sind eben besonders gefährdet auszubrennen.
Nicht die Leistung, der Erfolg zählt
Deutschlandfunk Kultur: Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich mit Emotionen arbeite, um den anderen Menschen zu helfen, oder ob ich mit Emotionen arbeite, um ein Produkt zu verkaufen.
Graefe: Absolut. Beides ist aber Arbeit an Emotionen. Beides ist Emotionsarbeit, folgt einer anderen Logik.
Deutschlandfunk Kultur: Ich wollte nur sagen, deswegen verwundert es mich nicht, dass die Callcenter-Mitarbeiter einen höheren Krankheitsgrad haben.
Graefe: Aber das ist nur ein Punkt, die Emotionsarbeit. Der andere Punkt ist, dass Callcenter-Mitarbeiter in aller Regel schlecht bezahlt sind, häufig auch entgrenzte Arbeitszeiten haben.
Zielvereinbarung ist noch ein wichtiger Punkt. Wir haben eine grundlegende Veränderung in den Steuerungssystemen in Betrieben und Unternehmen, weg von der Leistungsorientierung hin zur Erfolgsorientierung. Das heißt, die alte Logik, nach der zum Beispiel mein Vater noch gearbeitet hat und in seiner Generation gearbeitet wurde, lautete: Du bist ein guter Arbeitnehmer, wenn du dich anstrengst, wenn du dir Mühe gibst, wenn du pflichtbewusst bist usw. Und was dann dabei herauskommt, ist ein anderer Punkt. Dafür ist im Zweifel der Chef oder das Management verantwortlich.
Die Logik jetzt ist sehr häufig: Ob du dich bemühst oder nicht, ist nachrangig. Wichtig ist, was am Ende dabei herauskommt. Wie du da hin kommst, ist wiederum deine Verantwortung. Und wir haben viele Arbeitsbereiche, in denen die Zielvereinbarungen ein ganz zentrales Steuerungsinstrument sind und vor allen Dingen permanent verändert und erhöht werden. Ich weiß das von Personal- und Betriebsräten aus dem Bereich Finanzdienstleistungen, Banken, Versicherungen, dass es da gang und gäbe ist, dass Zielvereinbarungen oder Quartalsvereinbarungen getroffen werden, die exorbitant ehrgeizig gesetzt sind, so dass man sich sehr anstrengen muss im Team.
Das ist auch nein wichtiger Aspekt, dass viel Arbeit im Team organisiert wird. Das heißt, man reißt im Zweifel auch immer die Kollegen mit rein. Und wenn man es dann gerade eben geschafft hat, die Zielvereinbarung zu erreichen, dann heißt es: Prima, dann legen wir im nächsten Quartal nochmal 15 Prozent drauf.
Streik statt Therapie?
Deutschlandfunk Kultur: Wir haben jetzt in diesem Teil des Gesprächs unsere Ausgangsfrage - warum steigt die Anzahl der psychischen Erkrankungen? - mit den Arbeitsbedingungen beantwortet, nicht mit dem Zeitgeistphänomen. Das heißt, nicht der Einzelne ist das Problem, sondern das System. Und in dieser Logik müsste man dann sagen: Liebe Leute, dann macht mal keine Therapie, sondern lieber einen Streik.
Graefe: Ja, das wäre zumindest mal eine Überlegung wert (lacht). Und das gibt es tatsächlich auch schon, Gott sei Dank. Allerdings könnte es durchaus noch häufiger stattfinden. Denn genau an der Stelle treffen die beiden Sachen zusammen. Man könnte sagen, Leute, macht einen Streik oder wehrt euch gegen die Arbeitsbedingungen. Und jetzt kommt diese Tendenz der Therapeutisierung, die setzt da ein und sagt: Du selber bist das Problem und du bist die Lösung. Also, wenn du an deiner Situation was verändern willst, dann musst du zuerst dich selbst verändern.
Es gibt im Arbeits- und Gesundheitsschutz eigentlich diese alte Regel: Verhältnisprävention vor Verhaltensprävention. Das heißt, man muss erst an den Bedingungen etwas verändern und im zweiten Schritt kann man gucken, wie verhalten sich die Beschäftigten. Heute gibt es eine deutliche Tendenz im Bereich der psychischen Belastungen, so dass wir sagen können: Der Trend geht ganz eindeutig in Richtung Verhaltensprävention.
Es gibt auch gute Gründe, warum Arbeitgeber wenig Interesse haben, im Bereich der psychischen Belastungen an den Verhältnissen zu arbeiten, denn das betrifft häufig die Grundorganisationsstrukturen des Unternehmens. Stattdessen werden Gesundheitstage angeboten oder Resilienz-Trainings, wo man an seiner eigenen Belastung und Belastbarkeit arbeiten kann. Es wird also nicht versucht, die Belastung abzustellen, sondern die Belastbarkeit zu erhöhen.
Das ist natürlich ein ganz anderer Zugang. Und das erfordert dann wiederum noch mehr Bereitschaft von den Beschäftigten, sich dagegen zu wehren, als in dem alten System, wo eine Psychologisierung in der Form nicht stattfindet.
Deutschlandfunk Kultur: Andererseits, wenn jemand tatsächlich leidet, ob an Burnout oder depressiver Erschöpfung oder Depression, würden Sie ja wahrscheinlich auch nicht sagen, dann unternimm mal nix und lass dir mal nicht helfen. Es muss ja nicht notwendigerweise so sein, dass eine Therapie dafür sorgt, dass ich noch stressresistenter bin als eigentlich gesund wäre.
Graefe: Genau, das muss nicht so sein. Es ist beides möglich. Ich habe Interviews gemacht mit Menschen, die für längere Zeit arbeitsunfähig geschrieben waren aufgrund einer Burnout-Diagnose oder ähnlich gelagerten Diagnosen. Ich habe beides feststellen können, also dass eine psychotherapeutische Unterstützung zu einer kritischen Reflektion auf die eigene Arbeit, die eigenen Arbeitsbedingungen und auf die eigene Verhaftung an die Arbeit, die eigene Überidentifikation mit der Arbeit führt, die dann auch den Rücken stärkt, um möglicherweise Konflikte einzugehen und zu versuchen, bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, was teilweise auch gelungen ist.
Ich habe aber eben auch das andere gehört, dass Psychotherapie dazu führt, dass man zurücksteckt und freiwillig kündigt zum Beispiel oder Arbeitszeit reduziert oder sich auf einen schlechter bezahlten Arbeitsplatz versetzen lässt und das Ganze dann psychologisch begründet.
Deutschlandfunk Kultur: Das ist ja der Vorwurf, der dann laut wird, dass Psychotherapie zur Entpolitisierung von eigentlich politischen, von sozialen Fragen führt.
Graefe: Ja. Der trifft leider auch sehr häufig zu. Das muss nicht so sein, aber es ist häufig so. Und das hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, dass es in Deutschland in der Psychotherapie keine ausgeprägte Tradition gibt, sich zu gesellschaftspolitischen Fragestellungen zu äußern. Das ist in Frankreich zum Beispiel ganz anders. Da hat es diese spektakulären Suizidserien bei Autokonzernen, in Atomkraftwerken und bei der France Télécom gegeben. Damals haben die Berufsverbände der Psychotherapeuten und einzelne Akteure dazu sehr deutlich Stellung bezogen und sich in die Debatte eingemischt und Forderungen aufgestellt, was geändert werden muss in der Arbeitswelt.
Das haben wir in Deutschland praktisch nicht. Da gibt es keine Stellungnahme. Auch auf der Ebene findet eine radikale Verpersönlichung statt.
Deutschlandfunk Kultur: Das wäre ein Wunsch von Ihnen an die Psychotherapeuten in Deutschland?
Graefe: Ja genau. Sowohl in der konkreten Arbeit am Patienten, als auch vor allen Dingen als Berufsverband. Es gibt Stellungnahmen, in denen gesagt wird: Doch, doch, das hat schon was mit den Veränderungen in der Arbeitswelt zu tun. Aber genauso allgemein ist es dann gehalten, so allgemein und unkonkret.
Und das ist eben die andere Seite dieser Therapeutisierung oder Psychologisierung, dass gesellschaftliche Bedingungen zunehmend als eine Art Naturbedingung gefasst werden, als wären sie etwas, was uns zustößt wie das Wetter, und wir müssten jetzt müssen lernen, damit umzugehen. Wenn es regnet, dann sollten wir uns einen Regenmantel anziehen - das ist die Logik. Das ist aber eben nicht so!
Arbeitsbedingungen sind menschengemacht und können von Menschen verändert werden. Und man sollte dazu sagen, Beispiel Callcenter, die Arbeitsstrukturen, die Arbeitslogik, die Arbeitsanforderung sind das eine. Die Prekarisierung ist das andere. Wir haben eine deutliche Zunahme atypischer Beschäftigung. Das übt auch selbst auf Menschen Druck aus - das ist vielfach belegt -, die selber gar nicht unmittelbar bedroht oder betroffen sind, die selber nicht befürchten müssen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder absteigen. Aber die Stimmung insgesamt ist: Ich muss wirklich alles geben, damit ich im Spiel bleibe.
Das ist ein erhebliches Druckinstrument, was man gut einsetzen kann. Da, denke ich, hätte Psychotherapie ein lohnendes Handlungsfeld, an dieser individuellen Sicht der Menschen zu arbeiten und sie in eine andere Richtung zu verändern.






