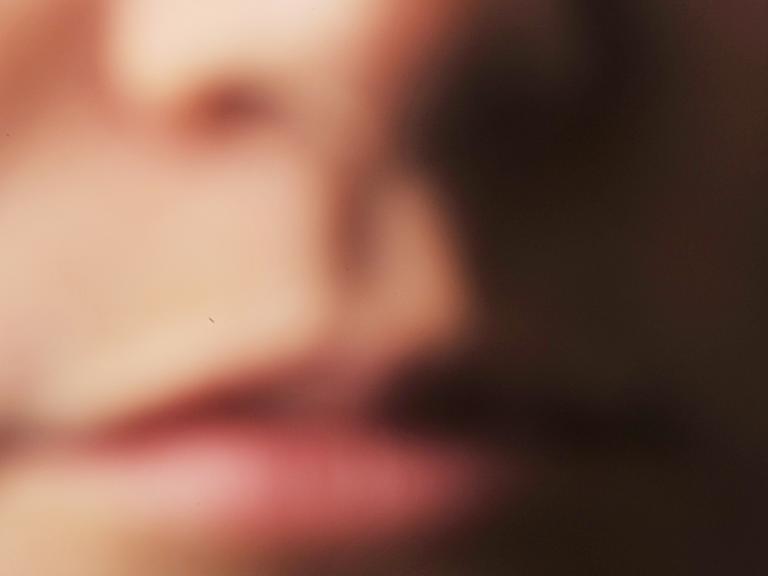Ähnlich wirksam wie Placebos

Von Julia Friedrichs und Thorsten Padberg · 02.02.2017
Die alten Griechen erklärten Depressionen mit einem Zuviel an schwarzer Galle, im Mittelalter galten sie als Strafe Gottes. Heute erklären wir Depressionen zu einer Störung der biochemischen Prozesse im Körper und designen Medikamente dagegen. Dabei gibt es viele Studien, die zeigen, dass sie gar nicht wirken.
In Deutschland hat sich - einer OECD-Studie zufolge - die Zahl der Verschreibungen von Antidepressiva deutlich erhöht: Von knapp über 20 Tagesdosen je 1000 Einwohner im Jahr 2000 auf 50 Tagesdosen je 1000 Einwohner 2011. Gleichzeitig sind Therapieplätze knapp.
Während Medikamente also immer häufiger gegeben werden, ist Zuspruch schwer zu finden. Dabei haben zahlreiche Studien Zweifel an der Wirksamkeit gesät: Großen Meta-Studien zufolge ist diese nur bei schwer Depressiven überhaupt nachweisbar, bei leichten und mittelschweren Depressionen fühlen sich die Menschen zwar besser, aber nicht besser als die, die eine Zuckerpille geschluckt haben.
Großbritannien hat inzwischen reagiert: Bei leichten und mittleren Depressionen empfiehlt das Institute for Health and Care Excellence keine Gabe von Antidepressiva mehr. Stattdessen bildet der Staat Coaches aus, die Menschen mit leichten und mittleren Depressionen durch Sport und Zuwendung wieder aktivieren. Ein Programm, das wesentlich größeren Erfolg hat als die Gabe von Antidepressiva.
In Deutschland aber steigen die Verschreibungszahlen weiter. Warum glauben wir so sehr an die Pille gegen Depressionen? Müssten Ärzte und Psychiater die Patienten nicht viel besser aufklären? Warum kopiert Deutschland ein Programm wie das britische nicht? Und sind am Ende vielleicht alle froh mit der Pille, selbst wenn sie nicht wirkt: Der Arzt, der seinem Patienten etwas anbieten kann, der Patient, der das Gefühl hat, dass etwas getan wird und die Pharmafirma, die verkauft.
Großbritannien hat inzwischen reagiert: Bei leichten und mittleren Depressionen empfiehlt das Institute for Health and Care Excellence keine Gabe von Antidepressiva mehr. Stattdessen bildet der Staat Coaches aus, die Menschen mit leichten und mittleren Depressionen durch Sport und Zuwendung wieder aktivieren. Ein Programm, das wesentlich größeren Erfolg hat als die Gabe von Antidepressiva.
In Deutschland aber steigen die Verschreibungszahlen weiter. Warum glauben wir so sehr an die Pille gegen Depressionen? Müssten Ärzte und Psychiater die Patienten nicht viel besser aufklären? Warum kopiert Deutschland ein Programm wie das britische nicht? Und sind am Ende vielleicht alle froh mit der Pille, selbst wenn sie nicht wirkt: Der Arzt, der seinem Patienten etwas anbieten kann, der Patient, der das Gefühl hat, dass etwas getan wird und die Pharmafirma, die verkauft.
Manuskript zur Sendung:
Eine belebte Kreuzung in Berlin-Mitte. Ein junger Mann, blondes Haar, blaues Shirt, zögerndes Lächeln, biegt mit dem Rennrad um die Ecke. Setzt sich zu uns an den Kaffeetisch. Zündet sich eine Zigarette an. Nippt am Kaffee. Und fängt an zu erzählen. Von der Zeit vor einem Jahr, als der Faden riss, der ihn mit dem normalen Leben verband. Tobias Schuster war damals gerade zum Studium nach Berlin gezogen. Er war viel allein, teilte eine Wohnung mit einem Bekannten, der ihn ignorierte. Der damals 20jährige erlahmte mehr und mehr. Fühlte sich leer. Quälte sich mit den immer gleichen Gedanken.
"Super negative destruktive Gedanken. Auch Zeiten, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Und nichts hinbekommen habe. Und da ist es halt so krass geworden, dass ich so suizidale Zwangsvorstellungen immer hatte, also dass ich mir immer und immer wieder so Sachen ausgemalt habe. Dann bin ich halt so zum Psychiater gegangen. Und dann, ich glaube so sind halt Psychiater, hat er fünf Minuten mit mir geredet und hat gleich gesagt: Sie haben das und das und das. Sie haben eine mittelschwere depressive Episode. Er hat mich mit den Medikamenten sehr alleine gelassen. Er hat gesagt: Ich gebe Ihnen das Rezept. Sie können es auch erhöhen und so."
Antidepressivum "Sertralin" besser bekannt als "Zoloft"
Tobias Schuster bekam ein Rezept für das Antidepressivum "Sertralin", besser bekannt unter dem Handelsnamen "Zoloft". Ein Mittel, das den Serotonin-Spiegel im Gehirn stabilisieren soll. Er stieg mit der empfohlenen Dosis von 50 Milligramm in die Behandlung ein. Und steigerte diese in Eigenregie schnell auf die Maximaldosis von 220 Milligramm am Tag.
"Ich habe schon das Gefühl, dass mir die Medikamente geholfen haben, dass ich eben sagen konnte: Es geht mir schlecht, okay, dann erhöhe ich jetzt und dann wird das wieder. Ich habe schon das Gefühl, dass mir das geholfen hat. Auch immer diese Routine. Es hat auch etwas Ritualmäßiges. Weil ich hatte vor allem morgens, dass ich super down war und dann steht man halt morgens so auf und nimmt erst mal diese Medikamente. Das hat so etwas von einem Ritual."
Ein Jahr ist es es her, seitdem er die Diagnose "Depression" erhielt: Der 21-Jährige ist damit einer von geschätzten zehn Millionen Menschen in Deutschland, die mindestens ein Mal in ihrem Leben an einer Depression erkranken. Einer Krankheit, die von vielen als anhaltende bodenlose Traurigkeit, als Verzweiflung, als nicht zu überwindende Erschöpfung beschrieben wird. Die 27-Jährige Jana erklärt ihre Symptome in der Grimme-Preisgekürten Video-Reihe "Frag ein Klischee" so:
"Das ist gar nicht so leicht, eine Depression zu beschreiben, weil jemand der keine Depression hat, kann das Gefühl wahrscheinlich gar nicht nachempfinden. Es ist auch nicht wirklich ein Gefühl, weil man sich weder sonderlich traurig fühlt, noch irgendwie fröhlich. Es gibt keinen Höhen und Tiefen, wenn man depressiv ist, sondern es fühlt sich alles sehr gleich an. Man ist am ehesten, glaube ich, niedergeschlagen und fühlt eine komplette Leere. Also eigentlich fast nichts, weder Freude noch Trauer."
Depression ist in Deutschland der Hauptgrund für Frühverrentung
Im schlimmsten Fall sind Depressive nicht mehr in der Lage das Bett zu verlassen, aufzustehen, sich zu waschen oder Essen vorzubereiten. Ein furchtbarer Zustand, den aber nicht alle Menschen, bei denen eine Depression diagnostiziert wird, erreichen. Dabei sind immer mehr Menschen betroffen. Junge Menschen wie Tobias Schuster und Jana, aber auch Väter, Mütter und Rentner, und neuerdings vermehrt sogar Kinder, weltweit jeder Zehnte, so schätzte die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, im Frühjahr 2016. Die Krankheit, die inzwischen in Deutschland der Hauptgrund für Frühverrentungen ist, ist – zum Glück – kein Tabu mehr.
Wenn jemand ernsthaft krank, ja sogar des Lebens müde ist, braucht er Hilfe. Idealerweise einen Therapeuten. Aber die Wartezeiten für einen Therapieplatz sind lang: im Schnitt sechs Monate, so das Ergebnis einer Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer aus dem Jahr 2011. So viel Zeit haben Kranke aber nicht. Also gehen die meisten - wie Tobias Schuster - erstmal zu ihrem Hausarzt. Der hat einen Menschen vor sich, der leidet und bietet das Mittel an, das schnell verfügbar ist: Medikamente.
Zwischen 2000 und 2013 hat sich in Deutschland die verschriebene Tagesmenge an Antidepressiva verdreifacht. Sechs Prozent aller Erwerbstätigen nehmen Antidepressiva.
Ein wachsender Markt. 2015 gaben allein die Gesetzlichen Krankenkassen für Antidepressiva über 750 Millionen Euro aus. Denn bei immer mehr und mehr Menschen sind Medikamente das Mittel der Wahl gegen Depression. Und bei vielen verläuft der Weg dorthin ähnlich wie bei Tobias Schuster: Sie gehen zum Arzt und der empfiehlt nach wenigen Gesprächsminuten ein Antidepressivum. Das Internetportal "Depression-Heute" hat Zuschriften gesammelt, in denen Erkrankte davon berichten.
Eine Rentnerin schreibt:
"Mein Mann hatte ein schweres Nierenproblem. Da bekam ich Angst vor dem Alleinsein. Mein Hausarzt empfahl mir Antidepressiva."
Ein Software-Entwickler erzählt:
"Ich hatte familiäre Probleme, dazu kamen unbestimmte körperliche Symptome. Erst später habe ich mich entschieden, Antidepressiva auszuprobieren. Zitat des verschreibenden Psychiaters: Die sind so gut verträglich wie Leitungswasser."
Und ein anderer schreibt:
"Ich hatte immer Rückenschmerzen und mein Hausarzt meinte, dass Antidepressiv da super wären. Ich vertraute ihm."
Auch Spitzensportler sind betroffen
Vielen Menschen scheinen die Pillen die logische Waffe in der Behandlung gegen die Depression zu sein. Denn seit einigen Jahren wird diese schwer fassbare Erkrankung auch in der Öffentlichkeit auf eindeutig körperliche Ursachen zurückgeführt, die man mit Medikamenten in den Griff bekommt. Die Skirennläuferin Lindsey Vonn beschrieb im Gespräch mit einer Zeitung ihre Depressionen so:
"Ich war wehrlos. In meinem Körper liefen chemische Prozesse ab, die ich nicht beeinflussen konnte. Ich bin zum Glück sehr bald zum Arzt gegangen. Er hat mich mit Medikamenten behandelt."
In "Drüberleben", dem viel gelobten Roman der Bloggerin Kathrin Weßling, sagt die depressive Hauptfigur Ida über sich, sie sei ein menschlicher Verkehrsunfall. In einer Klinik bringt man ihr bei, was ihr die Lust am Leben nahm:
"Kein Schicksal, keine Bestimmung, nur ein bisschen Serotonin, das fehlt."
Und der Verein "Freunde fürs Leben", der mit prominenter Unterstützung Jugendliche über Depressionen aufklärt, lässt Model Vic Voltage in der Reihe "Vicky will's wissen" die Ursachen der Krankheit so erklären:
"Bei einer Depression handelt es sich immer um ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn. Das kann man sich so vorstellen, dass bestimmte Stoffe, die dafür sorgen, dass wir glücklich sind, nicht mehr von einer Nervenzelle zur anderen transportiert werden können. Das ist natürlich blöd. Aber man kann Abhilfe schaffen, in dem man zum Beispiel Therapie macht oder, wenn Euer Arzt Euch dazu rät und ihr das auch wollte, kann man das auch mit Medikamenten behandeln."
Ist Depression ein chemisches Ungleichgewicht?
Auch in der Broschüre der Patientenorganisation "Deutsche Depressionsliga" heißt es:
"Vor dem Hintergrund, dass Depressionen biochemisch vor allem über einen gestörten Hirnstoffwechsel erklärt werden können, greifen Antidepressiva in diesen Stoffwechsel ein, in dem sie eine Fehlfunktion von Botenstoffen regulieren. Für das Depressionsgeschehen sind Serotonin und Noradrenalin die wichtigsten Botenstoffe."
Der Depressive, das zumindest vermittelt diese Aussagen, braucht Medikamente, um das chemische Ungleichgewicht in seinem Gehirn wieder in Ordnung zu bringen. Um das Serotonin, das ihm fehlt, künstlich nachzufüllen. Das ist eine Theorie, mit der viele gut leben können: Die Patienten, die eine Einfache wie logische Erklärung bekommen, was mit ihnen los ist und ein Medikament einnehmen können, das oft tatsächlich dazu führt, dass es ihnen nach einiger Zeit besser geht. Die Ärzte, die auf dieser Basis ein Heilmittel anbieten können. Und die Firmen, die genau das verkaufen. Es gibt nur ein Problem: Vermutlich stimmt dieses Erklärmaodell so nicht.
Dass das nicht so ist, erfuhr die Öffentlichkeit aber nicht von ihren Ärzten, sondern aus dem Fernsehen. Das amerikanische TV-Magazin "60 Minutes" informierte seine Zuschauer im Februar 2012 über einen Krieg, der unter Wissenschaftlern tobte.
Moderatorin Lesley Stahl sagte:
"Die medizinische Fachwelt zieht in die Schlacht. Sie streitet um die Forschung und die Schriften des Psychologen Irving Krisch. In dem Kampf geht es um Antidepressiva, deren Wirksamkeit Kirsch in Frage stellt. Kirschs Arbeiten sind von zentralem Interesse für die 17 Millionen Amerikaner, die diese Medikamente einnehmen, darunter Kinder nicht älter als sechs Jahre. Und für die Pharmaindustrie, der diese Medikamente jedes Jahr 11,3 Milliarden Dollar einbringen."
Der Erfolg der Pillen ist ein Scheinerfolg
Irving Kirsch hat über mehr als zehn Jahre die Studien der Pharmafirmen ausgewertet, mit denen sie sich um die Zulassung für ihre Antidepressiva bewarben. Kirschs Clou war: Er schaute sich nicht nur die Studien an, die die Pharmafirmen freiwillig veröffentlichten, sondern auch die, die sie geheim hielten: Über den "Freedom of Information Act", ein amerikanisches Recht auf Transparenz, verschaffte er sich Einblick. Am Ende verglich der Psychologe die Patienten, die ein Medikament erhalten hatten, mit denen, die eine Zuckerpille bekommen hatten, ein Placebo also.
Sein Ergebnis: Vielen Patienten ging es nach der Behandlung besser. Allerdings war es in den meisten Fällen egal, ob sie ein echtes Mittel oder das Placebo geschluckt hatten. Nur bei der Gruppe der sehr schwer Erkrankter übertraf die Wirkung der Medikamente die der Placebos. Für diese Menschen gibt es also sehr gute Gründe, die Tabletten einzunehmen. Über die vielen anderen aber sagt Irving Kirsch seitdem: Es seien nicht die Wirkstoffe in den Antidepressiva, die helfen. Der Erfolg der Pillen sei ein Scheinerfolg.
Bei seinem ersten großen Auftritt im US-Fernsehen kann das die Moderatorin kaum glauben.
Stahl: "Aber den Leuten geht es doch besser mit den Medikamenten. Ich kenne selber welche! Wir alle kenne welche!"
Kirsch: "Ja, sicher. Den Menschen geht es besser, wenn sie die Medikamente nehmen. Aber es sind nicht die chemischen Bestandteile der Medikamente, die ihnen helfen. Das ist weitgehend der Placebo-Effekt."
Wir wollen das von Irving Krisch selbst erklärt bekommen. Also verabreden uns mit ihm zum Interview über Skype. Er nimmt sich Zeit und betont, dass er - der seit seinen Studien von vielen Pharmafirmen heftig angegriffen ist - in diesen Kampf nur aus einem Grund hineingeraten ist: Weil seine Daten so eindeutig sind!
"Ich hatte auch gedacht, dass Antidepressiva wirken. Die Datenlage hat mich aber davon überzeugt, dass ich damit falsch lag. Es ist mit Sicherheit kein Serotonin-Defizit, es nicht das Norepinephrin. Ist nicht so wie wir ursprünglich gedacht hatten."
Es gebe, so behauptet Irving Kirsch, daran keine wirklichen Zweifel mehr. Nur noch Diskussionen um Details: Anfang 2016 haben Forscher aus Göteborg zum Beispiel eine Untersuchung veröffentlicht, die noch einmal bestätigt, dass es, betrachtet man alle Depressions-Symptome, tatsächlich kaum Unterschiede zwischen Medikament und Placebo gibt. Allerdings hätte bei einem Teil der Patienten, die Pillen nahmen, sich - die depressive Stimmung - doch verbessert. Ein nicht ganz unwichtiges Symptom. Weitere große Studien haben Kirschs Resultate in Gänze bestätigt. Obwohl manche Forscher angetreten waren, ihn zu widerlegen.
"Es gibt Leute, die haben unsere Daten genommen und sie neu analysiert. Sie haben behauptet, wir hätten Fehler in den Berechnungen gemacht. Dass der Unterschied zwischen Medikament und Placebo auf der Messskala für Depressionen nicht 1.8, sondern 2.26 ist. Und dann hat sich rausgestellt, dass sie einen noch dümmeren Fehler in ihren Berechnungen hatten, den dann wiederum wir finden konnten. Ich habe auch eine unveröffentlichte Untersuchung der amerikanischen Zulassungsbehörde für Medikamente, der FDA, gesehen. Das waren erfahrene Statistiker, erfahrene Gutachter, alle je gemachten Untersuchungen mit mehr als 23.000 Patienten und die sind bei exakt dem gleichen Wirkunterschied zwischen Medikament und Placebo gelandet: 1,8."
Zum gleichen Schluss wie in den Vereinigten Staaten kam man nach Sichtung der Daten auch in Großbritannien. Der Psychiater Tim Kendall, Director der britischen "Centre for Mental Health" wurde von der britischen Regierung beauftragt, die Behandlungsleitlinien für Depressionen in Großbritannien zu erstellen. Man merkte ihm an, dass ihn das simplifizierende Gerede über Serotonin persönlich ärgert.

"Das ist alles totaler Unsinn" - der Psychiater Tim Kendall, Director der britischen "Centre for Mental Health" glaubt nicht, dass Depressive ein Serotonindefizit haben. © imago/STPP
"Das ist alles totaler Unsinn. Die Serotonin-Hypothese hält keiner Überprüfung stand. Ich habe ein Prädikatsexamen in Neurochemie. Ich habe mir deren Daten angeschaut und glaube, dass sie Müll sind. Es gibt wirklich keine belastbaren Untersuchungen dazu, dass Depressive ein Serotonindefizit hätten oder dergleichen."
"Ein Großteil der Wirkung ist Placebo"
Die Schlossparkklinik in Berlin Charlottenburg, ein funktionaler, schmuckloser Bau. Laut Ranking aber eine der besten Adressen für die Behandlung einer Depression in Deutschland. Auch hier klingt das Urteil eindeutig. Der Chefarzt der Psychiatrie, Tom Bschor - graues Hemd, graue Krawatte, gerader Rücken - ist eine wissenschaftliche Instanz: Er ist Mitglied der Arzneimittelkommission, Mitautor der deutschen Behandlungsleitlinien, Vorsitzender der Berliner Gesellschaft für Psychiatrie.
"Wir wissen aus Analysen, das der Großteil der Wirkung, die wir sehen, wenn wir einem Patienten ein Antidepressivum geben, auf einen Placebo-Effekt zurückgeht. Das ist wissenschaftlich eigentlich nicht zu bezweifeln. Das wissen wir deshalb so gut, weil Placebo weltweit das mit großem Abstand am besten untersuchte Medikament ist, weil das in ganz vielen Studien immer als Vergleichsgruppe mitgeführt wird."
Trotzdem verabreicht Tom Bschor in seiner Klinik auch Antidepressiva. Vor allem bei Schwerkranken hält er die Medikamente für hilfreich. Selbst wenn der Psychiater nicht genau sagen kann, warum und wie der Wirkmechanismus der Antidepressiva funktioniert. Auch als wir ihn auf die These ansprechen, dass die Medikamente das chemische Ungleichgewicht im Gehirn ausbalancieren, dass angeblich die Erkrankung verursacht.
"Dass Depression eine Verschiebung von Neurotransmittern sei, die man durch AD ausgleichen könne, das stimmt mit Sicherheit nicht. Das würde heute auch ein informierter Kollege auch nicht mehr so sehen. Aber das wurde mit sekundären Interessen auch von den Firmen so verbreitet. Da gabs Broschüren an die Ärzte und auch Patientenbroschüren, in denen das in dieser Weise, wie Sie es gerade formuliert haben, dargestellt wurde."
Warum aber war die Mär vom Serotonin dann so erfolgreich?
Tom Bschor erklärt:
"Das ist das Ergebnis von Marketing. Das ist eine Kampagne aus den 90er Jahren der pharmazeutischen Industrie, die genau dieses simplifizierende, unzutreffende Modell primär auch unter die Ärzte gebracht hat. Die ärztliche Weiterbildung wurde und wird immer noch in großen Teilen von der Industrie durchgeführt. Die Meinungsbildner sind im großen Umfang finanziell verknüpft mit der Industrie, haben Beraterverträge, bekommen Honorare, bekommen Symposien bezahlt. Und keiner dieser Kollegen würde sagen, ich bin dadurch beeinflusst. Und doch ist es so."
Das Märchen sei notwendig - für die Pharmakonzerne
Der Arzt Peter Ansari veröffentlicht im September 2016 gemeinsam mit seiner Frau Sabine das Buch "Die Antidepressiva-Lüge". Auch sie legen überzeugend dar, dass es keine Beweise für die Serotonin Theorie gibt. In Irland und Schweden hätten die Arzneimittelbehörden den Herstellern sogar verboten, zu behaupten, ihre Mittel würden ein chemisches Ungleichgewicht im Patienten korrigieren. Für die Pharmakonzerne, so die Autoren, sei dieses Märchen aber überlebensnotwendig. Und zwar:
"Weil sämtliche Antidepressive Medikamente auf dieser Theorie basieren. Ist die Theorie falsch, wackelt das gesamte Gebäude der antidepressiven medikamentösen Therapie."
Depressionen – die große Schwermut, die, so scheint es, jeden befallen kann – hat die Menschheit schon immer vor Rätsel gestellt. Die Griechen lieferten das erste Erklärungsmodell: die Säftelehre. Die Depression, so glaubten sie, werde durch ein Zuviel an schwarzer Galle verursacht. Im Mittelalter dachte man, die Schwermut sei eine Strafe Gottes. Man betete und hielt sich von den Verzweifelten fern. Und heute glaubt man eben, dass es eine Krankheit des Gehirns ist und geht sie seit Ende der 1980er Jahre mit Pillen an. Trotz aller Zweifel. Auch Tom Bschor, der skeptische Chefarzt verschreibt Antidepressiva. Seinen schwerkranken Patienten – weil sie, so zeigen die Daten, in dieser Patientengruppe tatsächlich messbar besser wirken als Placebos.
"Wenn wir sagen, ein Großteil der Wirkung eines AD ist ein Placebo-Effekt, dann ist das ja ein Effekt, das ist ein positiver Effekt. Im Sinne des Patienten, ist es deswegen denn ärztlich falsch, wenn man ein Medikament mit einem großen Placebo-Effekt gibt? Hoffnung auslösen, das hat immer schon zur Heilkunst gehört. In einer indianischen Kultur, wenn ich es mir mal laienhaft vorstelle, sind vielleicht schamanische Rituale wirksam, um einen Selbstheilungsprozess auszulösen und nicht eine chemische Tablette wie bei uns. Bei uns würden die schamanischen Rituale nicht sehr gut als Placebo funktionieren. Aber letztlich macht man was ähnliches."
Aber darf ein Arzt seinem Patienten etwas vormachen? Vor allem der mitunter starken Nebenwirkungen wegen? Und helfen die Antidrepressiva auf Dauer? Als Tobias Schuster die Antidepressiva schluckte, hatte er sofort den Eindruck, dass die Tabletten wirken. Vor allem aber, weil er die Nebenwirkungen spürte.
"Was man stärker noch merkt als die positiven Wirkungen sind glaube ich die Nebenwirkungen. Das merkt man halt super stark so. Vor allem am Krassesten merkt man halt, dass man beim Sex nicht mehr kommen kann. Dass ist das, was ich am eindeutigsten gemerkt habe, weil es eben auch sehr konkret ist."
Oftmals starke Nebenwirkungen
Sexuelle Funktionsstörungen heißt das im Beipackzetteljargon. Sie sind relativ häufig. Und für Tobias waren sie paradoxerweise ein Segen: Die klare Reaktion seines Körpers, so erzählt er, stärkte in ihm den Glauben, dass das Medikament auch in seinem Kopf etwas bewirkt. Ob der Effekt nun Placebo ist oder nicht, ist ihm eigentlich egal.
"Dieses Medikament hat mich nicht geheilt. Das ist jetzt nicht wie ein Antibiotika oder so. Verändert hat sich für mich, dass ich an meinen äußeren Lebensumständen unglaublich viel verändert hat. Also diese Vorstellung, dass sich da in diesen Rezeptoren wieder etwas ausgleicht, das ist für mich nicht so."
Gerade schleicht der 21-Jährige die Pillen aus. Er wird wohl auf Dauer ohne sie leben können. Tobias Schusters Geschichte ist gut ausgegangen. Die vieler anderer Patienten aber nicht.
Robert Whitaker sitzt in seinem Büro in Boston. Wir reden per Skype. Aber auch über die Distanz wird klar: Wenn Robert Whitaker über die Gefahren von Antidepressiva spricht, tut er das mit der Inbrunst eines Konvertiten. Der einstige Tageszeitungsjournalist gründete in den Neunzigern eine Firma, die Pharmaunternehmen Berichte über Medikamententests lieferte, war, wie er selber sagt, ein Freund der Industrie. Dann aber stolperte er über zwei Studien, die ihn zweifeln ließen: Sowohl die Harvard Medical School als auch die WHO berichteten, dass die Zahl der dauerhaft psychisch Kranken in den USA angestiegen sei, zeitgleich zur Menge der verordneten Medikamente. Robert Whitaker stellte sich die naive Frage: Wie kann das sein, wenn wir Pillen haben, die wirklich helfen? Whitaker wühlte sich tief in die Medizin-Archive hinein und tauchte mit interessanten Daten wieder auf:
"Wenn Sie in die medizinischen Lehrbücher aus der Zeit vor den Antidepressiva schauen, dann sehen Sie, dass Depressionen damals bei den meisten Menschen nach sechs bis zehn Monaten wieder verschwunden waren. Auf irgendwie mysteriöse Weise. Wenn Sie sich die Auftretensraten von Depressionen, die stationär behandelt werden mussten, also aus der Zeit vor den 1950ern, anschauen, ist das eine ziemlich seltene Erkrankung. In einer Studie aus dem Jahr 1955 die von der Nationalen Behörde für mentale Gesundheit NIMH durchgeführt wurde gab es 7.000 Erstaufnahmen, 7250 wegen Depressionen in den ganzen Vereinigten Staaten. Und insgesamt gab es nur 38.000 Depressive in amerikanischen Krankenhäusern. Das ist sehr wenig."
Und in der Tat. Damals bilanzierten die Forscher des National Instituts for Mental Health:
"Depressionen sind eine der psychiatrischen Erkrankungen mit der besten Aussicht auf eine komplette Erholung - mit oder ohne Behandlung."
Mittlerweile sind Depressionen eine nationale Epidemie
Heute bezeichnet dasselbe Institut die Depression als nationale Epidemie, die jeden Zehnten trifft, viele dauerhaft. Auch in Deutschland ist die Anzahl der Fehltage wegen Depressionen seit 1997 um 162 Prozent angestiegen. Die Frühverrentungen aufgrund von depressiven Störungen haben sich innerhalb von zehn Jahren verdreifacht. Und das, obwohl die Kranken so viele Antidepressiva nehmen wie nie zuvor. In den USA nehmen 11 Prozent der Bevölkerung die Medikamente dauerhaft ein. Antidepressiva sind dort die am zweithäufigsten verschriebenen Medikamente. Wie, so fragt Robert Whitaker, können wir da weiter daran glauben, dass die Medikamente auf Dauer heilen?
Nun kann man seinen einiges Daten entgegenhalten: Unsere Lebensumstände sind anders als vor 40 Jahren. Vielleicht trauen sich heute mehr Kranke zum Arzt. Aber, so fragten auch isländische Forscher, die ähnliche Daten gesammelt haben wie Robert Whitaker: Wenn Antidepressiva wirklich helfen würden, dann wäre doch zu erwarten, dass es weniger dauerhaft Kranke gibt, als vor dem massenhaften Einsatz der Pillen?
In einem lauten Café treffen wir Stefan Zeignitz. Er hat den Ort vorgeschlagen. Möglichst anonym. Der 46-Jährige versinkt in der Menge, in deren lebhaften Gesprächen. Stefan Zeignitz ist seit 20 Jahren depressiv. Es begann während seiner Zeit als Berufssoldat.
"Das war schon so, dass ich zum einen meinen Dienst nicht mehr wahrnehmen konnte. Also ich konnte mich nicht mehr aufraffen, zu sagen, ich gehe jetzt zur Arbeit. Ich war richtig schlapp, die Gelenke waren schlapp. Das kann man sich manchmal wie bei so einer Grippe vorstellen, wo man körperlich so richtig down ist."
"Depression" diagnostizierte der Truppenarzt und verschrieb das erste Antidepressivum. Seitdem schluckt Stefan Zeignitz die Pillen. Besser geht es ihm nicht.
"Ich habe bis heute alles durch, was der Markt zu bieten hat, das kann man wirklich sagen. Ich habe alle Wirkstoffgruppen durch, ich habe in den Wirkstoffgruppen noch mal verschiedene Medikamente durch. Das ist auf jeden Fall niederschmetternd, wenn man zu seinem Arzt geht und jedes Mal hört: Was können wir denn noch mit Ihnen machen? Das war auch so gewesen, dass ich zum Teil manchmal auch Medikamente ausprobiert haben, die ich vor sechs sieben Jahren genommen habe. Wo die Ärztin gleich gesagt hat: Viel Hoffnung mache ich Ihnen da nicht. Aber das ist zumindest so, dass man selber sagt: So ein Stückchen Hoffnung ist das wieder. Vielleicht klappt es ja doch."
Viele Patienten verzweifeln, wenn sie merken, dass die Medikamente, an die sie glauben, die Depression nicht bezwingen. Gerade, wenn sie an die Theorie vom chemischen Ungleichgewicht glauben. Peter und Sabine Ansari schreiben:
"Die Hypothese, Depressionen seien eine rein organische Erkrankung, kann sich negativ auf den Patienten auswirken. Wird diese Auffassung einem Patienten vermittelt, entbindet es ihn vom Aufarbeiten der Schwierigkeiten, die die Depression ausgelöst haben."
Trotzdem betonen selbst die größten Kritiker der Tabletten: Niemals sollte man die Medikamente abrupt und ohne Rücksprache mit Ärzten einfach absetzten. Robert Whitaker:
"Es führt zu Problemen, wenn man einfach aufhört, die Pillen zu nehmen. Es ist so, dass sich das Gehirn an das Medikament gewöhnt hat. Deswegen gibt es da ein Risiko. Über dieses Risiko sollte die Psychiatrie sprechen. Und die Psychiatrie sollte darüber informieren, dass einer der Nachteile, wenn man einmal anfängt die Medikamente zu nehmen, das Risiko eines abrupten Entzugs von diesen angeblich so sicheren Medikamenten ist."
Auch der Brite Tim Kendall warnt vor dieser Gefahr:
"Ich weiß, dass die Entzugssymptome beim Absetzen von Antidepressiva einer Depression sehr ähnlich sind. Das ist so, als hätte man eine ausgeprägte Depression plus Angst. Das würde mich sehr zurückhaltend machen, wenn es um die Verschreibung geht. Man sollte bei der Verschreibung immer beachten, welche Nebenwirkungen es gibt."
Bei leichten Depressionen ist Sport hilfreich
Deshalb hat Tim Kendall darauf gedrungen, dass in Großbritannien Antidepressiva bei leichten und mittelschweren Depressionen nur noch in Ausnahmefällen empfohlen werden. Kindern und Jugendlichen sollen diese Medikamente dort gar nicht mehr verabreicht werden. Denn es gibt Alternativen: Eine Therapie, in der eine feste Tagesstruktur erarbeitet wird, Lebenshilfe und - in leichten Fällen - ist auch Sport hilfreich. In Großbritannien haben sie Coaches ausgebildet, die Depressiven helfen sollen.
"Am Ende von zehn Wochen erzielt man eine genauso große Veränderung durch diese Depressionsschule wie nach zehn oder zwölf Wochen mit einem Antidepressivum."
Dennoch sind viele Betroffene mit ihren Medikamenten zufrieden. Einige fühlen sich angegriffen, wenn sie hören, dass der größte Teil ihrer Wirkung in leichten bis mittelschweren Fällen auf den Placebo-Effekt zurückzuführen ist: Viele Depressionspatienten kommentieren die Berichterstattung über Kirschs Studien im Internet so wie dieser:
"Schämen Sie sich. Jeder wirklich an Depression Erkrankte weiß über Für und Wider der Medikation durch Antidepressiva Bescheid. Mein Leben wurde dadurch gerettet. Und zwar durch die Medikation, denn wenn ich es bei der Behandlung durch meine damalige tiefenpsychologische Psychotherapeutin belassen hätte, wäre ich heute nicht mehr am Leben."
Es gibt viele, denen es geholfen hat, sich vorzustellen, dass in ihrem Gehirn etwas aus dem Takt geraten ist. Ethan Watters, der für sein Buch "Crazy Like Us" durch die ganze Welt gereist ist, um sich mit Betroffenen und Therapeuten zu treffen, kennt Fälle, in denen diese Sichtweise lebenswichtig war:
"Wenn ich im Radio über das Buch gesprochen habe, haben Leute angerufen und mir gesagt: Dieses biomedizinische
Erklärungsmuster hat mein Leben gerettet. Dass ich sagen konnte, es waren nicht die Entscheidungen, die ich getroffen habe, sondern biomedizinische Gründe. Das war hochwichtig für mich und die Menschen, die mir nahestehen."
Erklärungsmuster hat mein Leben gerettet. Dass ich sagen konnte, es waren nicht die Entscheidungen, die ich getroffen habe, sondern biomedizinische Gründe. Das war hochwichtig für mich und die Menschen, die mir nahestehen."
Es gibt vieles, was funktionieren kann, wenn der Faden, der einen Menschen mit dem Leben verbindet, reißt: Medikamente, eine Therapie, Sportstunden, das Ende einer unglücklichen Beziehung oder der Beginn einer neuen. Bei einer Krankheit, die so stark durch Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet ist, hilft alles, was Hoffnung gibt. Wichtig ist nur: Es gibt eine Wahl. Und zwar immer. Das ist die gute Nachricht, die sich hinter den Zweifeln an der Wirksamkeit der Antidepressiva verbirgt.