Wachsendes Unbehagen angesichts der virtuellen Realität
Rezensiert von Moritz Schuller · 21.11.2010
Als sich vor ein paar Monaten die Schülerin Phoebe Prince erhängte, weil sie von ihren Klassenkameraden im sozialen Netzwerk Facebook gemobbt wurde, flackerte in den USA kurz eine Debatte auf über die sozialen und psychologischen Kosten des Internets.
Sie wurde vor allem in dem virtuellen Kondolenzbuch für die Schülerin geführt, das dort eingerichtet war, woher auch ihr Leid gekommen war: auf Facebook. Im sozialen Netzwerk lebt man auch tot weiter.
Wir erleben Hilflosigkeit und wachsendes Unbehagen angesichts der menschlichen Entblößung, die das Internet befördert. Dabei klingen die Kritiker noch wie die Christen, die sich in den Katakomben von Rom verstecken, während die Mehrheit fröhlich im Circus Maximus sitzt. Der durchschnittliche Jugendliche in den USA verbringt schließlich siebeneinhalb Stunden täglich mit Computer, Smartphone und Fernseher.
Doch nun klingt eine Stimme etwas lauter, weil sie anders als der deutsche Innenminister street credibility im Netz genießt. Es ist eine Stimme direkt aus dem Silicon Valley: Jaron Lanier, Computerpionier und Vordenker der virtuellen Realität, beschreibt in seinem Buch das Internet als eine totalitäre Religion, die geprägt ist von ‚antihumanen Denkweisen’. Wie ein digitaler Dr. Frankenstein rechnet Lanier mit seiner Schöpfung ab. Seine These lautet, dass ‚die tiefe Bedeutung der Person durch Illusionen der digitalen Welt ausgehöhlt’ wird.
"Der zentrale Fehler der neueren digitalen Kultur liegt in dem Bestreben, ein Netzwerk von Individuen so fein zu zergliedern, dass am Ende nur ein Brei übrig bleibt. Dann beginnt man, mehr auf die abstrakten Merkmale des Netzwerks als auf die realen, im Netzwerk zusammengeschlossenen Menschen zu achten, obwohl das Netzwerk selbst weder Sinn noch Bedeutung hat."
Diese Missachtung des Einzelnen zu Gunsten des Web-Kollektivs lässt Lanier von einem ‚kybernetischen Totalitarismus’ sprechen, dem wir uns überlassen haben, einem ‚digitalen Maoismus’. Das Internet lebe auch ideologisch von der Masse, nicht von dem Einzelnen. Der totalitäre, antiindividualistische Grundgedanke sei, dass alle Nutzer des Web gemeinsam ein kollektives Bewusstsein hervorbrächten. In diesem pulsierenden Informationsfluss werde das, was Menschen aus Fleisch und Blut ausmacht, deshalb fragmentiert. Und anzunehmen, dass alle diese Fragmente ein neues Ganzes ergäben, sei absurd.
"Einige meiner Kollegen glauben, eine Million oder vielleicht auch eine Milliarde Fragmente aus lauter Beschimpfungen würden am Ende eine größere Weisheit ergeben, als jeder wohldurchdachte Essay sie zu bieten vermag, sofern diese Fragmente nur durch ausgeklügelte, geheime, statistische Algorithmen rekombiniert werden. Da bin ich anderer Meinung. In der Frühzeit der Computerwissenschaft gab es einen Spruch. Er lautete: Wer Müll eingibt, bekommt Müll heraus."
Aus einem noch immer bemerkenswert offenen Informationsmittel wird so ein Instrument der Meute, das Mainstream und Mobbing befördert und Moral zerstört, eine Gratiskultur befördert, geistige Urheberschaft ignoriert und Kunst produziert, die Vergangenes lediglich neu aufbereitet. Das Internet weckt, aber erfüllt die Hoffnung nicht, aus Nichts Geld machen zu können, es verstärkt die eigenen Vorurteile und es belohnt Personen, die in soziale Normen passen.
"Am Ende des Weges unserer technologischen Verbesserungen…scheint ein Spielzimmer zu liegen, in dem die Menschheit auf den Stand eines Kindergartens regrediert."
schreibt Lanier. Sein Buch ist eine leidenschaftliche, im eigenartigen Jargon des Web 2.0 verfasste Abrechnung mit der Dynamik eines Internets, das nur die Gegenwart kennt und die Macht der Masse. Denn nur so kann dieses algorithmische System funktionieren. Lanier ist jedoch kein Internet-Renegat, der die Online-Aktivitäten der Menschen auf ein gesünderes Maß zurückdrängen wollte. Auch wenn er einige Ratschläge parat hat - man sollte zum Beispiel lieber eigene Webseiten schaffen, als sich Facebook oder Wikipedia anzuvertrauen - geht es ihm in Wahrheit um etwas anderes als die Gefahren, die von Facebook ausgehen. Jaron Lanier will der orthodoxen Vorstellung darüber, wie man das Netz nutzen kann, sein eigenes, ,romantisches Technologieverständnis’ entgegensetzen. Sein digitaler Humanismus will dem Einzelnen die Stimme im Netz zurückgeben.
Er will den Menschen auch im algorithmischen Zeitalter das bieten, was sie erst zu Menschen macht: die Mysterien des Erlebens. Seine Lösung ist deshalb kein Rückzug aus der Technologie, sondern das Gegenteil: die Interaktion in der virtuellen Realität. Wenn wir unser Aussehen und unsere Gestalt nach Belieben verändern könnten, würde unsere Kommunikation eine höchst lebendige Erweiterung erfahren.
"Dann hätten wir die Möglichkeit, auf direktem Wege und ohne Vermittlung durch Symbole ein gemeinsames Erleben zu schaffen."
Wie das gehen wird, räumt Lanier ein, wisse er aber auch noch nicht.
Die Bedrohungen, die Jaron Lanier so eindrucksvoll beschreibt, sind real und sein Unbehagen zeitgemäß. Aus seiner Kritik spricht eine geradezu snobistische Nostalgie für die guten alten Tage; seine Flucht in die virtuelle Realität ist auch eine Flucht aus der Realität. Dass der Konflikt zwischen Individuum und Schwarm, um in Laniers Terminologie zu bleiben, Jahrhunderte alt ist, reflektiert er nicht. Den Preis, den der Einzelne bezahlen muss, wenn das Internet diese Machtverhältnisse mal wieder verschiebt, dokumentiert Lanier eindrucksvoll. Für die gesellschaftlichen, für die politischen Kosten interessiert er sich nicht. So bleibt der Text vor allem eine eindrucksvoll romantische Klage über den Sog des Schwarms.
Jaron Lanier: "Gadget. Warum die Zukunft uns noch braucht"
aus dem Englischen von Michael Bischoff
SuhrkampVerlag, Berlin 2010
Wir erleben Hilflosigkeit und wachsendes Unbehagen angesichts der menschlichen Entblößung, die das Internet befördert. Dabei klingen die Kritiker noch wie die Christen, die sich in den Katakomben von Rom verstecken, während die Mehrheit fröhlich im Circus Maximus sitzt. Der durchschnittliche Jugendliche in den USA verbringt schließlich siebeneinhalb Stunden täglich mit Computer, Smartphone und Fernseher.
Doch nun klingt eine Stimme etwas lauter, weil sie anders als der deutsche Innenminister street credibility im Netz genießt. Es ist eine Stimme direkt aus dem Silicon Valley: Jaron Lanier, Computerpionier und Vordenker der virtuellen Realität, beschreibt in seinem Buch das Internet als eine totalitäre Religion, die geprägt ist von ‚antihumanen Denkweisen’. Wie ein digitaler Dr. Frankenstein rechnet Lanier mit seiner Schöpfung ab. Seine These lautet, dass ‚die tiefe Bedeutung der Person durch Illusionen der digitalen Welt ausgehöhlt’ wird.
"Der zentrale Fehler der neueren digitalen Kultur liegt in dem Bestreben, ein Netzwerk von Individuen so fein zu zergliedern, dass am Ende nur ein Brei übrig bleibt. Dann beginnt man, mehr auf die abstrakten Merkmale des Netzwerks als auf die realen, im Netzwerk zusammengeschlossenen Menschen zu achten, obwohl das Netzwerk selbst weder Sinn noch Bedeutung hat."
Diese Missachtung des Einzelnen zu Gunsten des Web-Kollektivs lässt Lanier von einem ‚kybernetischen Totalitarismus’ sprechen, dem wir uns überlassen haben, einem ‚digitalen Maoismus’. Das Internet lebe auch ideologisch von der Masse, nicht von dem Einzelnen. Der totalitäre, antiindividualistische Grundgedanke sei, dass alle Nutzer des Web gemeinsam ein kollektives Bewusstsein hervorbrächten. In diesem pulsierenden Informationsfluss werde das, was Menschen aus Fleisch und Blut ausmacht, deshalb fragmentiert. Und anzunehmen, dass alle diese Fragmente ein neues Ganzes ergäben, sei absurd.
"Einige meiner Kollegen glauben, eine Million oder vielleicht auch eine Milliarde Fragmente aus lauter Beschimpfungen würden am Ende eine größere Weisheit ergeben, als jeder wohldurchdachte Essay sie zu bieten vermag, sofern diese Fragmente nur durch ausgeklügelte, geheime, statistische Algorithmen rekombiniert werden. Da bin ich anderer Meinung. In der Frühzeit der Computerwissenschaft gab es einen Spruch. Er lautete: Wer Müll eingibt, bekommt Müll heraus."
Aus einem noch immer bemerkenswert offenen Informationsmittel wird so ein Instrument der Meute, das Mainstream und Mobbing befördert und Moral zerstört, eine Gratiskultur befördert, geistige Urheberschaft ignoriert und Kunst produziert, die Vergangenes lediglich neu aufbereitet. Das Internet weckt, aber erfüllt die Hoffnung nicht, aus Nichts Geld machen zu können, es verstärkt die eigenen Vorurteile und es belohnt Personen, die in soziale Normen passen.
"Am Ende des Weges unserer technologischen Verbesserungen…scheint ein Spielzimmer zu liegen, in dem die Menschheit auf den Stand eines Kindergartens regrediert."
schreibt Lanier. Sein Buch ist eine leidenschaftliche, im eigenartigen Jargon des Web 2.0 verfasste Abrechnung mit der Dynamik eines Internets, das nur die Gegenwart kennt und die Macht der Masse. Denn nur so kann dieses algorithmische System funktionieren. Lanier ist jedoch kein Internet-Renegat, der die Online-Aktivitäten der Menschen auf ein gesünderes Maß zurückdrängen wollte. Auch wenn er einige Ratschläge parat hat - man sollte zum Beispiel lieber eigene Webseiten schaffen, als sich Facebook oder Wikipedia anzuvertrauen - geht es ihm in Wahrheit um etwas anderes als die Gefahren, die von Facebook ausgehen. Jaron Lanier will der orthodoxen Vorstellung darüber, wie man das Netz nutzen kann, sein eigenes, ,romantisches Technologieverständnis’ entgegensetzen. Sein digitaler Humanismus will dem Einzelnen die Stimme im Netz zurückgeben.
Er will den Menschen auch im algorithmischen Zeitalter das bieten, was sie erst zu Menschen macht: die Mysterien des Erlebens. Seine Lösung ist deshalb kein Rückzug aus der Technologie, sondern das Gegenteil: die Interaktion in der virtuellen Realität. Wenn wir unser Aussehen und unsere Gestalt nach Belieben verändern könnten, würde unsere Kommunikation eine höchst lebendige Erweiterung erfahren.
"Dann hätten wir die Möglichkeit, auf direktem Wege und ohne Vermittlung durch Symbole ein gemeinsames Erleben zu schaffen."
Wie das gehen wird, räumt Lanier ein, wisse er aber auch noch nicht.
Die Bedrohungen, die Jaron Lanier so eindrucksvoll beschreibt, sind real und sein Unbehagen zeitgemäß. Aus seiner Kritik spricht eine geradezu snobistische Nostalgie für die guten alten Tage; seine Flucht in die virtuelle Realität ist auch eine Flucht aus der Realität. Dass der Konflikt zwischen Individuum und Schwarm, um in Laniers Terminologie zu bleiben, Jahrhunderte alt ist, reflektiert er nicht. Den Preis, den der Einzelne bezahlen muss, wenn das Internet diese Machtverhältnisse mal wieder verschiebt, dokumentiert Lanier eindrucksvoll. Für die gesellschaftlichen, für die politischen Kosten interessiert er sich nicht. So bleibt der Text vor allem eine eindrucksvoll romantische Klage über den Sog des Schwarms.
Jaron Lanier: "Gadget. Warum die Zukunft uns noch braucht"
aus dem Englischen von Michael Bischoff
SuhrkampVerlag, Berlin 2010
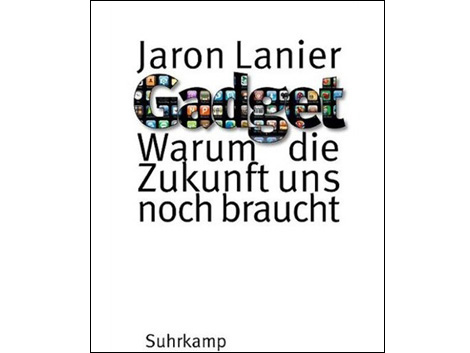
Jaron Lanier: "Gadget. Warum die Zukunft uns noch braucht".© SuhrkampVerlag
