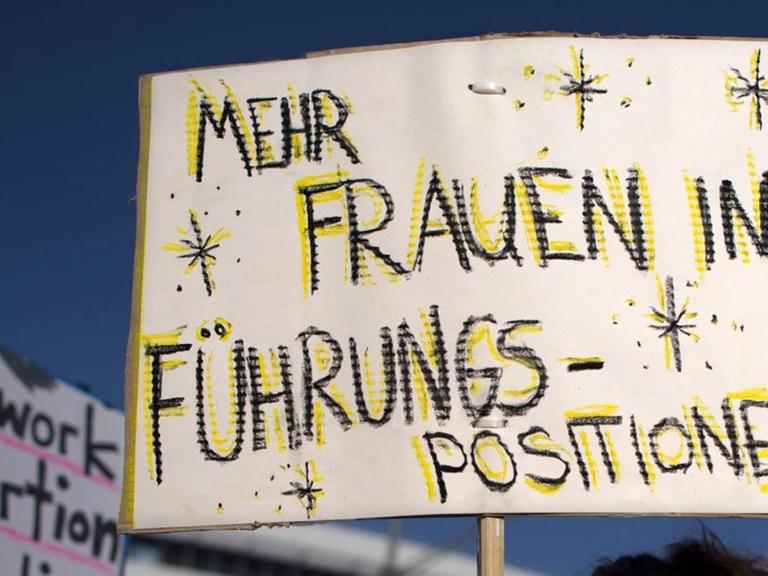Autorin und Autor: Pia Masurczak und Andreas Kirchner
Es sprachen: Ilka Teichmüller, Rosario Bona und Torsten Föste
Regie: Stefanie Lazai
Technik: Martin Eichberg
Redaktion: Martin Mair
Ich doch nicht!
29:11 Minuten
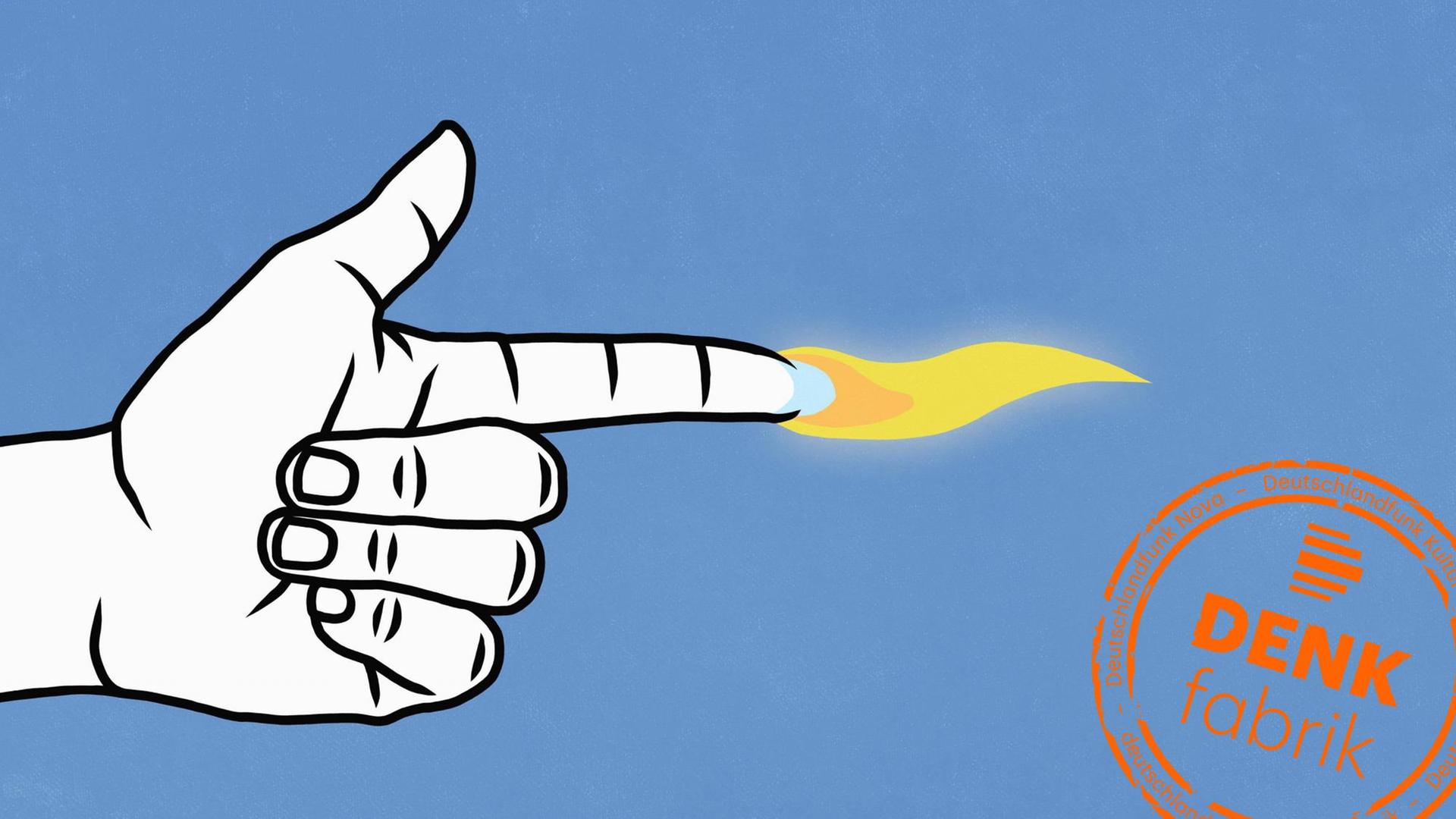
Von Pia Masurczak und Andreas Kirchner · 28.01.2021
Wir haben alle Vorurteile. Für queere Menschen und People of Color sind sie aber oft auch mit Diskriminierung und Gewalterfahrungen verbunden. Die gute Nachricht: Jeder und jede kann etwas dagegen tun.
"Dadurch, dass ich viel unterwegs bin auf der Straße, ist es einfach dieses komplett blöde Vorurteil, dass Frauen schlechter Autofahren können. Und dann fahre ich vorbei an demjenigen, wo ich denke, dass er schlecht fährt, und dann sitzt halt doch ein Mann drin und ich denke, man, das ist jetzt kompletter Blödsinn, das so zu denken. Und ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt", sagt Daniel.
"Da sind die durch das Schulhaus gerannt und meinten: 'Die Schwulen kommen!'", berichtet Carina Utz.
Und Anja erzählt: "Dass ich auch Mitarbeiterinnen auch aus dem Osten habe und die dann wirklich sagen, so wir haben das aber so und so gemacht und die Kinder werden zack, zack, zack, zack, zack hingesetzt zum Topfen. Und Topfzeiten und was weiß ich. Und da habe ich schon in mir drin: Ja, die kommen aus dem Osten."
"Da sind die durch das Schulhaus gerannt und meinten: 'Die Schwulen kommen!'", berichtet Carina Utz.
Und Anja erzählt: "Dass ich auch Mitarbeiterinnen auch aus dem Osten habe und die dann wirklich sagen, so wir haben das aber so und so gemacht und die Kinder werden zack, zack, zack, zack, zack hingesetzt zum Topfen. Und Topfzeiten und was weiß ich. Und da habe ich schon in mir drin: Ja, die kommen aus dem Osten."
Sätze wie diese haben alle schon gehört – oder gedacht. Vorurteile sind weitverbreitet, unabhängig von Bildung, Milieu oder Herkunft. Und sie beeinflussen unser Verhalten. Etwa dann, wenn wir instinktiv unsere Handtasche festhalten, sobald wir an einem Obdachlosen vorbeilaufen oder uns in der Straßenbahn nicht neben eine Frau mit Kopftuch setzen. Doch obwohl sie so tief in uns verankert sind, sind wir uns kaum der eigenen Vorurteile bewusst.
Woran liegt das? Der Bielefelder Sozialpsychologe Andreas Zick forscht seit fast 30 Jahren an dieser Frage. Was Vorurteile überhaupt sind, lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht so einfach beschreiben.
"Wir brauchen, um Vorurteile zu verstehen, eigentlich drei Konzepte, das erste Konzept ist die Kategorisierung. Vorurteile basieren darauf, dass wir andere als Mitglieder einer bestimmten Gruppe zuordnen, kategorisieren, sie dort einordnen. Männer, Frauen, Junge, Ältere, Inländer, Ausländer. Das ist zunächst kein Vorurteil, aber diesen Kategorien, diesen Schubladen werden Stereotype zugeordnet. Eigentlich in der Forschung haben wir uns darauf geeinigt, dass wir von Vorurteilen dann reden, wenn diese Zuschreibung von Stereotypen mit dem Motiv einer Abwertung einhergeht. Das heißt, Vorurteile sind sozial motivierte Abwertungen von Gruppen oder Personen, weil wir sie Gruppen zuordnen."
Woran liegt das? Der Bielefelder Sozialpsychologe Andreas Zick forscht seit fast 30 Jahren an dieser Frage. Was Vorurteile überhaupt sind, lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht so einfach beschreiben.
"Wir brauchen, um Vorurteile zu verstehen, eigentlich drei Konzepte, das erste Konzept ist die Kategorisierung. Vorurteile basieren darauf, dass wir andere als Mitglieder einer bestimmten Gruppe zuordnen, kategorisieren, sie dort einordnen. Männer, Frauen, Junge, Ältere, Inländer, Ausländer. Das ist zunächst kein Vorurteil, aber diesen Kategorien, diesen Schubladen werden Stereotype zugeordnet. Eigentlich in der Forschung haben wir uns darauf geeinigt, dass wir von Vorurteilen dann reden, wenn diese Zuschreibung von Stereotypen mit dem Motiv einer Abwertung einhergeht. Das heißt, Vorurteile sind sozial motivierte Abwertungen von Gruppen oder Personen, weil wir sie Gruppen zuordnen."
Aus Abwertungen folgen konkrete Handlungen
Diese Abwertung von bestimmten Gruppen hat meist nichts mit konkreten, negativen Erlebnissen zu tun. Wir suchen uns die negativen Einstellungen auch nicht bewusst aus. Dennoch haben sie Folgen, weil aus unbewussten Denkweisen konkrete Handlungen werden können.
"Vorurteile können eben eine sogenannte konative Dimension haben, das ist die Verhaltensdimension. Im Verhalten werte ich die anderen ab und Diskriminierung wäre dann ein bestimmtes Verhalten, was auf Vorurteilen basiert."
Heißt das, Denkmuster sind nur dann ein Problem, wenn sie zu Handlungen werden? Im Gegenteil betont Karin Joggerst. Die Freiburgerin berät Menschen, die sich mit ihren eigenen Vorurteilen auseinandersetzen wollen. Sie sagt: Auch unbewusste Haltungen schlagen sich im Alltag nieder.
"Viele denken, Vorurteile sind gar nicht wirksam, wenn ich sie nicht bewusst sozusagen umsetze in diskriminierendes Verhalten. Und das glaube ich persönlich nicht, weil auch unbewusste Vorurteile wirksam sind. Indem Menschen die Straßenseite wechseln, oder bestimmte Menschen eben nicht zum Vorstellungsgespräch einladen. Oder Menschen nicht in unserem Freundinnen-, Freundeskreis vorkommen."
"Vorurteile können eben eine sogenannte konative Dimension haben, das ist die Verhaltensdimension. Im Verhalten werte ich die anderen ab und Diskriminierung wäre dann ein bestimmtes Verhalten, was auf Vorurteilen basiert."
Heißt das, Denkmuster sind nur dann ein Problem, wenn sie zu Handlungen werden? Im Gegenteil betont Karin Joggerst. Die Freiburgerin berät Menschen, die sich mit ihren eigenen Vorurteilen auseinandersetzen wollen. Sie sagt: Auch unbewusste Haltungen schlagen sich im Alltag nieder.
"Viele denken, Vorurteile sind gar nicht wirksam, wenn ich sie nicht bewusst sozusagen umsetze in diskriminierendes Verhalten. Und das glaube ich persönlich nicht, weil auch unbewusste Vorurteile wirksam sind. Indem Menschen die Straßenseite wechseln, oder bestimmte Menschen eben nicht zum Vorstellungsgespräch einladen. Oder Menschen nicht in unserem Freundinnen-, Freundeskreis vorkommen."
Vorurteile sind historisch gewachsen
Wen kann ich mir als Kollegin am Arbeitsplatz vorstellen? Warum habe ich Angst, nachts allein nach Hause zu gehen? Wer ist schuld an der Wirtschaftskrise? Vorurteile sind auch deshalb so attraktiv, weil sie uns in einer Welt voller widersprüchlicher Informationen scheinbar instinktiv Orientierung bieten und Entscheidungen erleichtern. Ob die richtig und rational begründet sind, spielt erst einmal keine Rolle. Wichtiger ist, ob uns andere in unseren Vorurteilen bestätigen.
"Menschen haben Vorurteile, weil sie in einer bestimmten Situation sich mit anderen Gruppen identifizieren, weil sie in einem bestimmten sozialen Umfeld diese Vorurteile entwickeln und dann auch äußern. Und ganz wesentlich ist, dass Vorurteile dann in Diskriminierung münden, wenn Menschen feststellen: Dieses soziale Vorurteil wird geteilt."
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit – mit diesem sperrigen Begriff bezeichnen die Sozialwissenschaften das Phänomen. Menschen werden abgewertet und ausgegrenzt, weil sie vermeintlich zu einer Gruppe gehören, die als "anders", "fremd" oder "unnormal" gebrandmarkt wird. Wen es trifft, ist keinesfalls willkürlich, sondern historisch gewachsen. Vorurteile über Jüdinnen und Juden halten sich beispielsweise seit 2000 Jahren hartnäckig.
"Menschen haben Vorurteile, weil sie in einer bestimmten Situation sich mit anderen Gruppen identifizieren, weil sie in einem bestimmten sozialen Umfeld diese Vorurteile entwickeln und dann auch äußern. Und ganz wesentlich ist, dass Vorurteile dann in Diskriminierung münden, wenn Menschen feststellen: Dieses soziale Vorurteil wird geteilt."
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit – mit diesem sperrigen Begriff bezeichnen die Sozialwissenschaften das Phänomen. Menschen werden abgewertet und ausgegrenzt, weil sie vermeintlich zu einer Gruppe gehören, die als "anders", "fremd" oder "unnormal" gebrandmarkt wird. Wen es trifft, ist keinesfalls willkürlich, sondern historisch gewachsen. Vorurteile über Jüdinnen und Juden halten sich beispielsweise seit 2000 Jahren hartnäckig.
Und sie werden immer wieder aktualisiert: Das anonym verfasste antisemitische Pamphlet "Die Protokolle der Weisen von Zion" behauptet um 1900, die Welt werde von Juden beherrscht. Heute werden judenfeindliche Stereotype im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verbreitet. "Ungeimpft" stand etwa auf einem Judenstern, den sich ein Teilnehmer auf einer Berliner Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen auf die Jacke geklebt hatte. Ähnlich weitergetragen werden auch rassistische Denkmuster aus dem Kolonialismus. Sie haben nach wie vor große Auswirkungen auf unser Bild von Schwarzen Menschen.
Andreas Zick und Karin Joggerst sind sicher: Vorurteile können verlernt werden. Doch je fester sie in unserer Gesellschaft verankert sind, desto schwieriger ist es, sich dagegen zu wehren. Und die Prägung auf Denkmuster passiert früh: Schon Kinder haben eine konkrete Vorstellung, wie Mädchen und Jungs zu sein haben.
"Die wachsen in einer sehr eindeutigen, zweigeschlechtlichen Gesellschaft auf, die orientieren sich an Kategorien, an Stereotypen, an ´was dürfen Mädchen, was Jungs nicht dürfen`. Die Wirtschaft funktioniert sehr nach so einem entweder oder. Du musst dich immer irgendwie entscheiden. Beim Klamottenkaufen, beim ´Wen mag ich?`. Ich sehe es bei meinem Sohn, der ist acht. Der hat sich lange nicht getraut zu sagen, dass er Bibi und Tina cool findet, weil das sofort abgewiegelt wird von wegen: ´Boah, ist doch nix für Jungs, ist doch voll eklig. Und warum Pferde?` Und so, ne. Die ganze Gesellschaft, und auch die Konsumgesellschaft ist sehr rosa-hellblau geworden."
Andreas Zick und Karin Joggerst sind sicher: Vorurteile können verlernt werden. Doch je fester sie in unserer Gesellschaft verankert sind, desto schwieriger ist es, sich dagegen zu wehren. Und die Prägung auf Denkmuster passiert früh: Schon Kinder haben eine konkrete Vorstellung, wie Mädchen und Jungs zu sein haben.
"Die wachsen in einer sehr eindeutigen, zweigeschlechtlichen Gesellschaft auf, die orientieren sich an Kategorien, an Stereotypen, an ´was dürfen Mädchen, was Jungs nicht dürfen`. Die Wirtschaft funktioniert sehr nach so einem entweder oder. Du musst dich immer irgendwie entscheiden. Beim Klamottenkaufen, beim ´Wen mag ich?`. Ich sehe es bei meinem Sohn, der ist acht. Der hat sich lange nicht getraut zu sagen, dass er Bibi und Tina cool findet, weil das sofort abgewiegelt wird von wegen: ´Boah, ist doch nix für Jungs, ist doch voll eklig. Und warum Pferde?` Und so, ne. Die ganze Gesellschaft, und auch die Konsumgesellschaft ist sehr rosa-hellblau geworden."

Andreas Zick: "Vorurteile sind sozial motivierte Abwertungen von Gruppen oder Personen."© picture alliance/dpa/Marcel Kusch
Mobbing bis aufs Klo
Carina Utz macht für den Freiburger Verein Fluss e.V. Bildungsarbeit zu geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung. Dafür besuchen sie und ihre Kolleg*innen auch Schulen.
"Da sind die durchs Schulhaus gerannt und meinten: ´Die Schwulen kommen!` Das war die volle Sensation, dass wir zu viert da sind und einfach offen sind damit."
"Die Schwulen kommen!" – Diesen Satz von vor zehn Jahren hört Utz im Klassenzimmer mittlerweile nicht mehr. Homosexualität ist in der Gesellschaft sichtbarer geworden. Dennoch seien die Grenzen noch sehr eng, wenn es um Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit gehe. Und die Folgen für Betroffene sind gravierend: Von abfälligen Bemerkungen reichen sie über Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung bis hin zu massiver Gewalt.
"An einer Schule hier wurde bei einer Schuldisco ein Junge gefilmt, der Bauchtanz getanzt hat, und das war Mobbing über soziale Medien. Und das Video wurde geteilt, das Kind wurde verfolgt bis aufs Klo, ihm wurde die Hose runtergezogen, weil ihm nicht geglaubt wurde, dass er ein Junge ist."
Tiefe Verunsicherung, Rückzug und Angst können Folgen solcher Erlebnisse sein. Wer aufgrund seiner – womöglich nur vermeintlichen – Zugehörigkeit zu einer Gruppe wiederholt Ablehnung oder Gewalt erfährt, stellt sich mitunter selbst infrage. Sind womöglich nicht die anderen das Problem, sondern ich?
"Also dass Menschen merken, hey, ich verlieb mich in Jungs, ich bin aber ein Junge und das darf ich nicht. Weil ich habe das so gelernt. Schwul ist negativ, schwul ist als Schimpfwort verwendet in meinem Umfeld, es ist nicht Thema in der Schule, meine Eltern haben mit mir vielleicht noch nie darüber geredet oder haben mit mir insofern darüber geredet, als dass es krank sei, in Anführungszeichen. Das erlebe ich schon im Kontext von Beratung, aber im Kontext auch von unserer Bildungsarbeit, dass viele sehr ablehnend sind sich selbst gegenüber, weil die ebenso eine internalisierte Ablehnung von Homosexualität erlernt haben."
"Da sind die durchs Schulhaus gerannt und meinten: ´Die Schwulen kommen!` Das war die volle Sensation, dass wir zu viert da sind und einfach offen sind damit."
"Die Schwulen kommen!" – Diesen Satz von vor zehn Jahren hört Utz im Klassenzimmer mittlerweile nicht mehr. Homosexualität ist in der Gesellschaft sichtbarer geworden. Dennoch seien die Grenzen noch sehr eng, wenn es um Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit gehe. Und die Folgen für Betroffene sind gravierend: Von abfälligen Bemerkungen reichen sie über Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung bis hin zu massiver Gewalt.
"An einer Schule hier wurde bei einer Schuldisco ein Junge gefilmt, der Bauchtanz getanzt hat, und das war Mobbing über soziale Medien. Und das Video wurde geteilt, das Kind wurde verfolgt bis aufs Klo, ihm wurde die Hose runtergezogen, weil ihm nicht geglaubt wurde, dass er ein Junge ist."
Tiefe Verunsicherung, Rückzug und Angst können Folgen solcher Erlebnisse sein. Wer aufgrund seiner – womöglich nur vermeintlichen – Zugehörigkeit zu einer Gruppe wiederholt Ablehnung oder Gewalt erfährt, stellt sich mitunter selbst infrage. Sind womöglich nicht die anderen das Problem, sondern ich?
"Also dass Menschen merken, hey, ich verlieb mich in Jungs, ich bin aber ein Junge und das darf ich nicht. Weil ich habe das so gelernt. Schwul ist negativ, schwul ist als Schimpfwort verwendet in meinem Umfeld, es ist nicht Thema in der Schule, meine Eltern haben mit mir vielleicht noch nie darüber geredet oder haben mit mir insofern darüber geredet, als dass es krank sei, in Anführungszeichen. Das erlebe ich schon im Kontext von Beratung, aber im Kontext auch von unserer Bildungsarbeit, dass viele sehr ablehnend sind sich selbst gegenüber, weil die ebenso eine internalisierte Ablehnung von Homosexualität erlernt haben."
Menschen, die von Rassismus betroffen sind
Internalisierung bedeutet, dass gesellschaftliche Werte und Normen verinnerlicht werden. Das geschieht manchmal selbst dann, wenn sie der eigenen Identität widersprechen. Menschen können dabei in einen nur schwer auflösbaren Konflikt mit sich selbst geraten. Der Psychotherapeut Eben Louw sieht diese Erklärung allerdings kritisch. Er ist als Schwarzer Jugendlicher im Apartheidsstaat Südafrika aufgewachsen und berät Menschen, die von Rassismus betroffen sind.
"Internalisierung implizieren, dass ich das nicht in mich hatte und dass es dann in mich von außen gekommen ist. Ich sehe das für mich auch als ein gefährliches Konzept, wo die Möglichkeit des Missbrauchs sehr groß ist. Dass Menschen aus unterdrückten Gruppen kollaboriert haben mit deren Peinigern, da könnte es bei vielen auch eine Bewältigungsstrategie sein, mit den eigenen Entmenschlichung umzugehen."
Doch wie können Betroffene anders mit einer solch fundamentalen Ablehnung umgehen? Eben Louw setzt in seiner Praxis vor allem darauf, seine Klienten zu stärken. Mit Rassismus leben lernen – so traurig sich das anhört – kann eine Strategie sein:
"Das ist ein Päckchen, die Menschen zu tragen haben, und der Wunsch, dieses Päckchen einfach verschwinden zu lassen, hilft den Menschen eigentlich sehr wenig. Sondern es wäre wichtig, Menschen dazu befähigen, dass sie damit für sich leben können und dass sie intern sich vielleicht davon lösen können. Zu sagen: Rassismus ist nicht mein Problem. Ich trage die Folgen davon, aber er ist Dein Problem."
"Internalisierung implizieren, dass ich das nicht in mich hatte und dass es dann in mich von außen gekommen ist. Ich sehe das für mich auch als ein gefährliches Konzept, wo die Möglichkeit des Missbrauchs sehr groß ist. Dass Menschen aus unterdrückten Gruppen kollaboriert haben mit deren Peinigern, da könnte es bei vielen auch eine Bewältigungsstrategie sein, mit den eigenen Entmenschlichung umzugehen."
Doch wie können Betroffene anders mit einer solch fundamentalen Ablehnung umgehen? Eben Louw setzt in seiner Praxis vor allem darauf, seine Klienten zu stärken. Mit Rassismus leben lernen – so traurig sich das anhört – kann eine Strategie sein:
"Das ist ein Päckchen, die Menschen zu tragen haben, und der Wunsch, dieses Päckchen einfach verschwinden zu lassen, hilft den Menschen eigentlich sehr wenig. Sondern es wäre wichtig, Menschen dazu befähigen, dass sie damit für sich leben können und dass sie intern sich vielleicht davon lösen können. Zu sagen: Rassismus ist nicht mein Problem. Ich trage die Folgen davon, aber er ist Dein Problem."
Sich bewusst seinen Vorurteilen stellen
"Geht das dann zurück zu diesem Vorurteil, dass du gestern genannt hast? Dass du dich da manchmal dann ertappst. Weil Bildung ist ja wahrscheinlich auch so ein Wert, den haben wir ja auch nicht so ausdrücklich genannt. Aber dass gebildet sein, Akademiker sein, superwichtig ist."
"Mein Mann kommt aus dem völligen Gegenteil, seine Eltern sind ungelernte Arbeiter, leben auf dem Dorf, können kein Hochdeutsch… Ich hatte schon das Gefühl, dass mein Vater damit ein bisschen Schwierigkeiten hat."
Barbara und Karin wollen sich ihren Vorurteilen bei einer Anti-Bias-Weiterbildung stellen. Das Ziel von Anti-Bias: Diskriminierung vermeiden durch vorurteilsbewusstes Denken und Handeln. In einer der ersten Übungen reflektieren die zehn Teilnehmer*innen in kleinen Gruppen ihre persönliche Geschichte. Mit welchen Werten bin ich aufgewachsen? Welches Verhalten wurde in meiner Familie oder meinem Freundeskreis belohnt? Welches bestraft? Denkmuster ändern wir nur dann, wenn wir verstehen, woher sie kommen, sagt Seminarleiterin Karin Joggerst.
"Wir haben da ja gestern schon mal kurz drauf geguckt, da habe ich euch gesagt: Die Besonderheit ist, dass wir Erscheinungsformen von Diskriminierung und Diskriminierungsmerkmale sowohl kognitiv und emotional begreifbar machen. Die Arbeit, die wir bisher machen, ich denke, das merkt ihr auch schon sehr schnell, dass wir von uns selbst ausgehen, also dass Anti-Bias ein ganz erfahrungsorientierter Ansatz ist. Anti-Bias ist ein Ansatz, der nach Veränderung trachtet."
Barbara und Karin wollen sich ihren Vorurteilen bei einer Anti-Bias-Weiterbildung stellen. Das Ziel von Anti-Bias: Diskriminierung vermeiden durch vorurteilsbewusstes Denken und Handeln. In einer der ersten Übungen reflektieren die zehn Teilnehmer*innen in kleinen Gruppen ihre persönliche Geschichte. Mit welchen Werten bin ich aufgewachsen? Welches Verhalten wurde in meiner Familie oder meinem Freundeskreis belohnt? Welches bestraft? Denkmuster ändern wir nur dann, wenn wir verstehen, woher sie kommen, sagt Seminarleiterin Karin Joggerst.
"Wir haben da ja gestern schon mal kurz drauf geguckt, da habe ich euch gesagt: Die Besonderheit ist, dass wir Erscheinungsformen von Diskriminierung und Diskriminierungsmerkmale sowohl kognitiv und emotional begreifbar machen. Die Arbeit, die wir bisher machen, ich denke, das merkt ihr auch schon sehr schnell, dass wir von uns selbst ausgehen, also dass Anti-Bias ein ganz erfahrungsorientierter Ansatz ist. Anti-Bias ist ein Ansatz, der nach Veränderung trachtet."
Anti-Bias-Kurs erlaubt viel Platz für eigene Gefühle
Auch Anja und Daniel nehmen an der knapp einjährigen Weiterbildung teil. Beide arbeiten in der Leitung eines Kindergartens. Was erhoffen sie sich von dem Kurs?
"Ich denke, einige Vorurteile kann ich auch nicht ablegen. Oder sind schwer abzulegen. Aber ich kann sie zumindest bearbeiten, wie ich damit umgehe. Und damit helfe ich dann automatisch im Umgang mit den Menschen, helfe ich den anderen auch. So hoffe ich es."
"Dass es ganz grundlegend ansetzt, wenn man in der inneren Haltung dann halt ansetzt, und erst mal sich selber erlebt, in was man für Bias, oder was man für Vorurteile hat. Und wo die überhaupt herkommen, dass man es dann nur ganz grundlegend ändern kann."
Weil Vorurteile einen emotionalen Anteil haben, ist im Anti-Bias-Kurs viel Platz für die eigenen Erfahrungen und Gefühle. Das bedeutet auch, dass Anja, Daniel und die anderen ihre eigenen Vorurteile – etwa über Ostdeutsche oder Frauen am Steuer – aussprechen.
"Wir gehen von eigenen Erfahrungen aus, um zunächst mal ein Gefühl herzustellen, also eine emotionale Verbindung zu dem Thema. Und auch eine Gemeinsamkeit, eventuell. Wir stellen fest, zum Beispiel: Alle Menschen haben Vorurteile. Ok, ich bin nicht alleine. Oder wir stellen fest: Alle Menschen teilen Diskriminierungserfahrungen, wenngleich die Auswirkungen und die strukturellen Bedingungen sehr, sehr erheblich unterschiedlich sind für Menschen. Wichtig ist, dass der Anti-Bias-Ansatz von der Erfahrungsorientierung ausgeht, um darüber zu sprechen: Wie wirkt sich das strukturell aus? Wie wirkt sich das institutionell aus?"
Diese Auseinandersetzung fällt oft schwer. Schließlich gibt kaum jemand bereitwillig zu, rassistische Vorurteile zu haben. Wer Kurse wie den von Karin Joggerst besucht, bringt zwar meist schon die Bereitschaft für einen solchen Prozess mit.
"Ich denke, einige Vorurteile kann ich auch nicht ablegen. Oder sind schwer abzulegen. Aber ich kann sie zumindest bearbeiten, wie ich damit umgehe. Und damit helfe ich dann automatisch im Umgang mit den Menschen, helfe ich den anderen auch. So hoffe ich es."
"Dass es ganz grundlegend ansetzt, wenn man in der inneren Haltung dann halt ansetzt, und erst mal sich selber erlebt, in was man für Bias, oder was man für Vorurteile hat. Und wo die überhaupt herkommen, dass man es dann nur ganz grundlegend ändern kann."
Weil Vorurteile einen emotionalen Anteil haben, ist im Anti-Bias-Kurs viel Platz für die eigenen Erfahrungen und Gefühle. Das bedeutet auch, dass Anja, Daniel und die anderen ihre eigenen Vorurteile – etwa über Ostdeutsche oder Frauen am Steuer – aussprechen.
"Wir gehen von eigenen Erfahrungen aus, um zunächst mal ein Gefühl herzustellen, also eine emotionale Verbindung zu dem Thema. Und auch eine Gemeinsamkeit, eventuell. Wir stellen fest, zum Beispiel: Alle Menschen haben Vorurteile. Ok, ich bin nicht alleine. Oder wir stellen fest: Alle Menschen teilen Diskriminierungserfahrungen, wenngleich die Auswirkungen und die strukturellen Bedingungen sehr, sehr erheblich unterschiedlich sind für Menschen. Wichtig ist, dass der Anti-Bias-Ansatz von der Erfahrungsorientierung ausgeht, um darüber zu sprechen: Wie wirkt sich das strukturell aus? Wie wirkt sich das institutionell aus?"
Diese Auseinandersetzung fällt oft schwer. Schließlich gibt kaum jemand bereitwillig zu, rassistische Vorurteile zu haben. Wer Kurse wie den von Karin Joggerst besucht, bringt zwar meist schon die Bereitschaft für einen solchen Prozess mit.
"Es geht drum, lieb gewonnenes Denken zu bewahren"
Und trotzdem:
"Viele Menschen sagen ja zum Beispiel: Ja, das kann schon sein, dass es Sexismus gibt, aber doch nicht bei mir! Oder es ist eine Form von Leugnung. Also hier in Deutschland gibt's doch keinen Rassismus, vielleicht in Amerika. Das sind ja Formen von Widerstand, wo Menschen versuchen, zwischen sich und dem Thema eine Distanz zu bekommen. Und das finde ich erst mal legitim, dass Menschen das versuchen. Um nicht sich hinterfragen zu müssen. Widerstand kann viele Funktionen haben. Oft hat er eben die Funktion, Abstand zwischen mich und das Thema zu bringen. Ich habe Angst mich damit zu beschäftigen, vielleicht muss ich entdecken, dass ich Teil von einem System bin, was mir gar nicht so gut gefällt. Schutz. Es geht drum, lieb gewonnenes Denken zu bewahren, Privilegien zu wahren."
Das gilt selbst dann, wenn die Beziehung zu den eigenen Kindern unter Vorurteilen leidet. Carina Utz erlebt in ihrer Arbeit mit Schüler*innen und Eltern immer wieder, wie schwer es fallen kann, sich den eigenen Denkmustern zu stellen.
"Gerade habe ich in der Beratung eine Mama, die eine lesbische Tochter hat, die über 30 ist und die den Kontakt zur Tochter verloren hat aufgrund ihrer Vorurteile gegenüber lesbischen Menschen. Und die ist einfach sehr, sehr gewillt, diese Vorurteile zu überwinden, sie will das verlernen, sie will einfach diesen offenen Zugang zu ihrer Tochter wiederfinden. Das find ich schön, weil da einfach so ein Wille da ist, manchmal auch eine Verzweiflung, weil diese Denkmuster sehr tief sind oder auch vielleicht diese Vorstellung davon, wie die Tochter hätte sein sollen für die Mutter. Da werden manchmal ganze Lebensmodelle oder Weltbilder auch infrage gestellt."
"Viele Menschen sagen ja zum Beispiel: Ja, das kann schon sein, dass es Sexismus gibt, aber doch nicht bei mir! Oder es ist eine Form von Leugnung. Also hier in Deutschland gibt's doch keinen Rassismus, vielleicht in Amerika. Das sind ja Formen von Widerstand, wo Menschen versuchen, zwischen sich und dem Thema eine Distanz zu bekommen. Und das finde ich erst mal legitim, dass Menschen das versuchen. Um nicht sich hinterfragen zu müssen. Widerstand kann viele Funktionen haben. Oft hat er eben die Funktion, Abstand zwischen mich und das Thema zu bringen. Ich habe Angst mich damit zu beschäftigen, vielleicht muss ich entdecken, dass ich Teil von einem System bin, was mir gar nicht so gut gefällt. Schutz. Es geht drum, lieb gewonnenes Denken zu bewahren, Privilegien zu wahren."
Das gilt selbst dann, wenn die Beziehung zu den eigenen Kindern unter Vorurteilen leidet. Carina Utz erlebt in ihrer Arbeit mit Schüler*innen und Eltern immer wieder, wie schwer es fallen kann, sich den eigenen Denkmustern zu stellen.
"Gerade habe ich in der Beratung eine Mama, die eine lesbische Tochter hat, die über 30 ist und die den Kontakt zur Tochter verloren hat aufgrund ihrer Vorurteile gegenüber lesbischen Menschen. Und die ist einfach sehr, sehr gewillt, diese Vorurteile zu überwinden, sie will das verlernen, sie will einfach diesen offenen Zugang zu ihrer Tochter wiederfinden. Das find ich schön, weil da einfach so ein Wille da ist, manchmal auch eine Verzweiflung, weil diese Denkmuster sehr tief sind oder auch vielleicht diese Vorstellung davon, wie die Tochter hätte sein sollen für die Mutter. Da werden manchmal ganze Lebensmodelle oder Weltbilder auch infrage gestellt."
Kontakt mit anderen Menschen ist wichtig, reicht aber nicht
Das Gegenüber als Individuum wahrnehmen. Das ist eine Voraussetzung, um Vorurteile nachhaltig abbauen zu können. Damit das gelingt, braucht es nach Auffassung des Sozialpsychologen Andreas Zick dreierlei: Information, Bildung und der Kontakt mit den Menschen, denen wir mit Vorbehalten begegnen.
"Der Kontakt, die Erfahrung mit anderen. Und tatsächlich, dieser Königsweg, zeigt sich empirisch, ist ganz wesentlich. Auch wenn Menschen Vorurteile haben und sie nicht aufgeben wollen, sobald sie in Kontaktsituation kommen, dann hilft das."
Aber das Beispiel von Carina Utz zeigt auch: Bloßer Kontakt allein reicht nicht aus. Sonst dürfte die Mutter einer lesbischen Tochter kaum noch Vorurteile gegenüber Homosexuellen insgesamt haben. Auch Eben Louw, der sich mit rassistischen Stereotypen beschäftigt, ist skeptisch, dass die Begegnung mit marginalisierten Gruppen genügt.
"Oft wird ja gesagt, wir müssen uns nur begegnen – Begegnungen, Erfahrungen miteinander verändert dann. Aber das sind Beziehungs- und Kommunikationsstil sehr schwer zu überbrücken und da ist Begegnung nur bedingt hilfreich."
"Der Kontakt, die Erfahrung mit anderen. Und tatsächlich, dieser Königsweg, zeigt sich empirisch, ist ganz wesentlich. Auch wenn Menschen Vorurteile haben und sie nicht aufgeben wollen, sobald sie in Kontaktsituation kommen, dann hilft das."
Aber das Beispiel von Carina Utz zeigt auch: Bloßer Kontakt allein reicht nicht aus. Sonst dürfte die Mutter einer lesbischen Tochter kaum noch Vorurteile gegenüber Homosexuellen insgesamt haben. Auch Eben Louw, der sich mit rassistischen Stereotypen beschäftigt, ist skeptisch, dass die Begegnung mit marginalisierten Gruppen genügt.
"Oft wird ja gesagt, wir müssen uns nur begegnen – Begegnungen, Erfahrungen miteinander verändert dann. Aber das sind Beziehungs- und Kommunikationsstil sehr schwer zu überbrücken und da ist Begegnung nur bedingt hilfreich."
Haben alle Diskriminierungserfahrungen ihre Berechtigung?
Karin Joggerst sieht das ähnlich. Zwar korrigiert sich so vielleicht ein konkretes Vorurteil, doch die Ablehnung überträgt sich dann einfach auf eine andere gesellschaftliche Gruppe, sagt sie. Das Denkmuster – andere Menschen sind weniger wert als meinesgleichen – bleibt erhalten. Für die Anti-Bias-Trainerin liegt der eigentliche Schlüssel für den Abbau von Vorurteilen deshalb tiefer. Jede Erfahrung von Diskriminierung muss anerkannt werden. Jede. Denn sie ist überzeugt:
"Alle Menschen teilen Diskriminierungserfahrungen."
Also auch der sprichwörtlich gewordene alte, weiße, heterosexuelle Mann, der keine strukturellen Hindernisse zu überwinden hat? Für viele Betroffene klingt das zynisch. Mit dieser Kritik ist die Anti-Bias-Trainerin immer wieder konfrontiert. Denn klar ist: Die Herabwürdigung von Obdachlosen oder Menschen mit Behinderung, der Hass auf Jüdinnen und Juden – das lässt sich nicht mit einzelnen, unangenehmen Erfahrungen vergleichen. Doch beide Erfahrungen haben für Karin Joggerst ihre Berechtigung.
"Im Anti Bias-Ansatz geht es nicht ums Vergleichen, im Sinne von: Wer ist von was schlimmer betroffen? Sondern es geht zunächst mal darum, festzustellen, dass Menschen unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen machen, aber nicht im Sinne von Diskriminierung zu hierarchisieren, sondern eher im Sinn von Verständnis generieren für die Wirkungsweise, für die Auswirkung von Diskriminierung. Es geht eben nicht um Gleichmacherei, im Gegenteil, sondern es geht um eine sehr differenzierte Sicht und auch um einen schmerzhaften Austausch."
"Alle Menschen teilen Diskriminierungserfahrungen."
Also auch der sprichwörtlich gewordene alte, weiße, heterosexuelle Mann, der keine strukturellen Hindernisse zu überwinden hat? Für viele Betroffene klingt das zynisch. Mit dieser Kritik ist die Anti-Bias-Trainerin immer wieder konfrontiert. Denn klar ist: Die Herabwürdigung von Obdachlosen oder Menschen mit Behinderung, der Hass auf Jüdinnen und Juden – das lässt sich nicht mit einzelnen, unangenehmen Erfahrungen vergleichen. Doch beide Erfahrungen haben für Karin Joggerst ihre Berechtigung.
"Im Anti Bias-Ansatz geht es nicht ums Vergleichen, im Sinne von: Wer ist von was schlimmer betroffen? Sondern es geht zunächst mal darum, festzustellen, dass Menschen unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen machen, aber nicht im Sinne von Diskriminierung zu hierarchisieren, sondern eher im Sinn von Verständnis generieren für die Wirkungsweise, für die Auswirkung von Diskriminierung. Es geht eben nicht um Gleichmacherei, im Gegenteil, sondern es geht um eine sehr differenzierte Sicht und auch um einen schmerzhaften Austausch."
Aktionismus allein hilft Betroffenen nicht
Verantwortung für Vorurteile und Diskriminierung übernehmen: Beim Thema Rassismus oder Antisemitismus fällt das scheinbar leicht. Attacken auf Jüdinnen und Juden werden lautstark verurteilt. Rassistische Übergriffe angeprangert. So wichtig Zeichen gegen Menschenfeindlichkeit sind: Aktionismus allein hilft Betroffenen nicht – selbst wenn er gut gemeint ist, sagt Eben Louw. Wichtig ist es, bei sich selbst anzusetzen:
"Auch eine rassistische Dynamik oder historische Dynamik da drin ist, dass Menschen, die dem privilegierten weißen Teil dieser Gesellschaft zugehören, denken sie müssten Rassismusbetroffene retten, aber sie müssen sich selbst retten. Das ist gefährlich, sich selbst als den zentralen Punkt der Welt zu sehen und als das Normal."
Können Kurse wie der von Karin Joggerst dabei helfen? Gefragt sind Diversity-Schulungen auf jeden Fall, auch Unternehmen und Behörden haben das Thema für sich entdeckt. Die Bereitschaft, sich mit den eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen, scheint zu wachsen. Doch es gibt auch kritische Stimmen: Dienen diese Kurse nicht vor allem dazu, sich selbst zu entlasten?
"Auch eine rassistische Dynamik oder historische Dynamik da drin ist, dass Menschen, die dem privilegierten weißen Teil dieser Gesellschaft zugehören, denken sie müssten Rassismusbetroffene retten, aber sie müssen sich selbst retten. Das ist gefährlich, sich selbst als den zentralen Punkt der Welt zu sehen und als das Normal."
Können Kurse wie der von Karin Joggerst dabei helfen? Gefragt sind Diversity-Schulungen auf jeden Fall, auch Unternehmen und Behörden haben das Thema für sich entdeckt. Die Bereitschaft, sich mit den eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen, scheint zu wachsen. Doch es gibt auch kritische Stimmen: Dienen diese Kurse nicht vor allem dazu, sich selbst zu entlasten?
Sich die anti-rassistische, anti-sexistische Haltung zertifizieren zu lassen? Karin Joggerst entgegnet, sie achtet sehr genau darauf, wie ernst es den Teilnehmer*innen ist. Wer freiwillig kommt, habe meist ein ernsthaftes Interesse an konkreten Verbesserungen. Das kann auch dann gelingen, wenn die Initiative nicht von den Teilnehmenden selbst ausgegangen ist. Carina Utz weiß aus ihrer Bildungsarbeit, dass es vor allem darum geht, miteinander ins Gespräch zu kommen:
"Wir gehen immer in den Schulbesuch und sagen: He, hört mal, wir sind da, nicht um eure Meinung zu ändern, das ist nicht unser Anspruch. Deswegen erlauben wir einfach ganz viel in diesem Rahmen und erlauben auch Abneigung. Wenn wir über das Thema sprechen, fragen wir die Jugendlichen oft: He, argumentierst du jetzt gerade mit einem Argument oder mit einem Vorurteil? Und das finde ich total wichtig, dass die da in einen Reflexionsprozess kommen."
"Wir gehen immer in den Schulbesuch und sagen: He, hört mal, wir sind da, nicht um eure Meinung zu ändern, das ist nicht unser Anspruch. Deswegen erlauben wir einfach ganz viel in diesem Rahmen und erlauben auch Abneigung. Wenn wir über das Thema sprechen, fragen wir die Jugendlichen oft: He, argumentierst du jetzt gerade mit einem Argument oder mit einem Vorurteil? Und das finde ich total wichtig, dass die da in einen Reflexionsprozess kommen."
Racial Profiling trotz Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz
Aber reicht es wirklich aus, die eigenen Denkmuster zu hinterfragen? So fest wie Diskriminierung in Strukturen und Institutionen unserer Gesellschaft verankert ist? Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Racial Profiling, also Polizeikontrollen allein aufgrund der Hautfarbe oder der vermeintlichen Herkunft einer Person. Der afrodeutsche Autor David Mayonga beschreibt eine Begegnung mit zwei Polizisten in seiner Autobiografie "Ein Neger darf nicht neben mir sitzen".
"Schönen guten Tag, die Polizei. Ich hätte dann gern einmal Ihren Personalausweis gesehen." Bitte was? Ich war völlig perplex. Ich war 13 Jahre alt. Ich hatte also noch nicht einmal einen Kinderausweis bei mir, allerhöchstens meinen Schülerausweis, wie ich den Zivilbeamten dann auch erklärte. Meine Erklärung wurde mit einem mürrischen Nicken abgewunken. Ich musste mich an den Wagen stellen und meine Hände auf die Motorhaube legen. Der kleinere Polizist durchsuchte meinen Rucksack und klapperte meine Hosenbeine ab. Im Hintergrund gingen Nachbarn vorbei und beobachteten die Szene argwöhnisch.
Tatsächlich verbietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Racial Profiling. Trotzdem gehören solche Kontrollen für viele zum Alltag. Denn bei strukturellen Benachteiligungen geraten Anti-Diskriminierungsgesetze schnell an ihre Grenzen, weil sie nur das Fehlverhalten Einzelner betreffen. Besonders problematisch wird es, wenn Betroffene auch vor Gericht kein Gehör finden, wie die Juristin Doris Liebscher erklärt.
"Wir haben Fälle begleitet von Menschen, jungen Männern, die nicht typisch deutsch aussehen, die nicht in die Disko reinkommen. Ja, dieses Racial Profiling an der Discotür ist ein bundesweit bekanntes Phänomen. Die Beweislage ist auch in dem Fall sehr klar gewesen, weil es gab Zeuginnen, die gesehen haben, also alle weißen, biodeutsch aussehenden Männer sind reingekommen und der schwarze Kläger kommt nicht rein. Und dann sitzen wir in einer Gerichtsverhandlung und dann sagt der Richter, ein älterer weißer Mann: 'Naja, wissen sie, ich bin auch schon einmal in einen Klub nicht reingekommen, weil ich nicht die richtigen Schuhe anhatte.' Und das aus dieser Position zu sagen, zeugt von einer fundamentalen Unkenntnis dieser alltäglichen Lebenserfahrung dieses jungen schwarzen Mannes."
"Schönen guten Tag, die Polizei. Ich hätte dann gern einmal Ihren Personalausweis gesehen." Bitte was? Ich war völlig perplex. Ich war 13 Jahre alt. Ich hatte also noch nicht einmal einen Kinderausweis bei mir, allerhöchstens meinen Schülerausweis, wie ich den Zivilbeamten dann auch erklärte. Meine Erklärung wurde mit einem mürrischen Nicken abgewunken. Ich musste mich an den Wagen stellen und meine Hände auf die Motorhaube legen. Der kleinere Polizist durchsuchte meinen Rucksack und klapperte meine Hosenbeine ab. Im Hintergrund gingen Nachbarn vorbei und beobachteten die Szene argwöhnisch.
Tatsächlich verbietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Racial Profiling. Trotzdem gehören solche Kontrollen für viele zum Alltag. Denn bei strukturellen Benachteiligungen geraten Anti-Diskriminierungsgesetze schnell an ihre Grenzen, weil sie nur das Fehlverhalten Einzelner betreffen. Besonders problematisch wird es, wenn Betroffene auch vor Gericht kein Gehör finden, wie die Juristin Doris Liebscher erklärt.
"Wir haben Fälle begleitet von Menschen, jungen Männern, die nicht typisch deutsch aussehen, die nicht in die Disko reinkommen. Ja, dieses Racial Profiling an der Discotür ist ein bundesweit bekanntes Phänomen. Die Beweislage ist auch in dem Fall sehr klar gewesen, weil es gab Zeuginnen, die gesehen haben, also alle weißen, biodeutsch aussehenden Männer sind reingekommen und der schwarze Kläger kommt nicht rein. Und dann sitzen wir in einer Gerichtsverhandlung und dann sagt der Richter, ein älterer weißer Mann: 'Naja, wissen sie, ich bin auch schon einmal in einen Klub nicht reingekommen, weil ich nicht die richtigen Schuhe anhatte.' Und das aus dieser Position zu sagen, zeugt von einer fundamentalen Unkenntnis dieser alltäglichen Lebenserfahrung dieses jungen schwarzen Mannes."
Behandlung aufgrund von Vorurteilen ist schwer nachweisbar
Der Fall zeige, wie eng persönliche Kompetenzen und gesetzlicher Rahmen verknüpft sind. Um alltäglicher Diskriminierung zu begegnen braucht es beides. Denn der Rollstuhlfahrer, der einen Job wegen seiner Behinderung nicht bekommt, kann sich zwar auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz berufen. Dass sich hinter einer Absage Vorurteile verbergen, ist aber oft nur schwer nachweisbar.
Liebscher, die seit Oktober die Antidiskriminierungsbeauftragte von Berlin ist, fordert deshalb: Angehende Juristen müssen besser im Anti-Diskriminierungsrecht ausgebildet werden. Obwohl das Gleichbehandlungsgebot prominent im Grundgesetz verankert ist, wird dem Thema in Studium und Referendariat kaum Platz eingeräumt.
"In der juristischen Ausbildung wird zum einen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gelehrt, das ist dann Teil quasi des Arbeitsrechts, zum anderen kommt Antidiskriminierungsrecht über das internationale Recht rein. Und schließlich natürlich über Artikel 3 Grundgesetz, und da ist es so, dass insbesondere Art. 3 GG, das hat das Bundesverfassungsgericht mal gesagt, ein Schattendasein unter den Grundrechten führt.
Das sieht man nicht nur, dass es in der Rechtsprechung relativ wenig angefasst wird, sondern auch in der juristischen Ausbildung. Wir merken, dass sich das jetzt langsam ändert. Das hat zum Beispiel was mit der Diskussion um den Rassebegriff zu tun, das hat was mit den Entscheidungen von Oberverwaltungsgerichten zu Racial Profiling zu tun, das hat aber auch etwas damit zu tun, dass es feministische Lehrstühle gibt."
Auch Eben Louw vermisst bei staatlichen Institutionen das nötige Fachwissen.
"Wie können alle Strukturen in Deutschland, insbesondere die Polizei, die so eine wichtige Institution ist, eine Haltung entwickeln, dass Rassismus einfach in keiner einzigen Form geduldet wird? Das würde auch bedeuten, dass Führungskräfte sich ernsthafte Fragen stellen. Wenn Anti-Rassismus eine Fachlichkeit gewinnen könnte bei der Polizei, wo sind die Lücken bei so Praxissachen und nicht als Moralisches betrachtet würde, das wäre schön aus meiner Sicht."
Auch Eben Louw vermisst bei staatlichen Institutionen das nötige Fachwissen.
"Wie können alle Strukturen in Deutschland, insbesondere die Polizei, die so eine wichtige Institution ist, eine Haltung entwickeln, dass Rassismus einfach in keiner einzigen Form geduldet wird? Das würde auch bedeuten, dass Führungskräfte sich ernsthafte Fragen stellen. Wenn Anti-Rassismus eine Fachlichkeit gewinnen könnte bei der Polizei, wo sind die Lücken bei so Praxissachen und nicht als Moralisches betrachtet würde, das wäre schön aus meiner Sicht."
Viel kann in Schulen und im Gesundheitswesen erreicht werden
Trotz Gesetzesinitiativen, trotz der gewachsenen gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für Rassismus und Sexismus: Die persönliche Verantwortung für die eigenen Vorurteile liegt bei uns selbst. Und die Anti-Bias-Trainerin Karin Joggerst ist überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit eigenen Vorbehalten etwas bewirkt. Sie trage dazu bei, dass sich die Gesellschaft verändere.
"Indem ich mich frage, welche Funktion diese Vorurteile für mich haben, aber auch für meinen Status in dieser Gesellschaft, erlauben sie mir Macht auszuüben. Indem ich mich nach dem Sinn und Zweck dieser Vorurteile für mich frage, lande ich unweigerlich bei mir, das heißt, ich kann diese Vorurteile nicht mehr so unreflektiert auf mein Gegenüber projizieren."
Wirksam werden veränderte Denkmuster erst, wenn sie im Alltag dazu führen, dass wir uns anders verhalten. Das gilt insbesondere dort, wo Identität und Normen eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel in Schulen und im Gesundheitswesen. Wer hier arbeitet, sollte die eigenen Vorurteile reflektieren, fordert Carina Utz. Sie wünscht sich gleichzeitig:
"Ich appelliere auch immer an die queeren Menschen, queere Menschen müssen sichtbar sein, weil ich auch der Überzeugung bin, dass Vorurteile auch abgebaut werden können durch Sichtbarkeit. Indem ich auf den Straßen wahrnehme, dass es Paare gibt, die eben nicht heterosexuell sind. Oder indem ich mein Kind vielleicht in einem katholischen Krankenhaus zur Welt bringe als Frauenpaar."
Aber das Dilemma bleibt: Wer sichtbar ist, wird womöglich angefeindet. Gleichzeitig können Minderheiten ihre Interessen nur vertreten, wenn sie sich öffentlich dafür einsetzen. Auch wenn die Betroffenen damit wieder einen Teil der Arbeit übernehmen. Zudem muss sich die Mehrheit einer Gesellschaft nicht nur zur Gleichwertigkeit aller bekennen, sondern sie konkret werden lassen. Vorurteile, Diskriminierung, Beleidigung, gar Gewalt dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Wer in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz erlebt, wie Menschen bedroht oder beschimpft werden, kann und sollte eingreifen. Theoretisch ist das den meisten auch bewusst. Doch das Wissen allein reicht nicht, denn: Die aktive Arbeit gegen Diskriminierung beginnt lange vor der Zivilcourage.
"Das kommt nun immer darauf an, ob ich einen sozialen Kontext so gestalte, dass dort die Norm, sich nicht nach den Vorurteilen zu verhalten, besonders bedeutsam ist. Wir würden sagen: Wir müssen die Räume und die Kontexte von Menschen so gestalten, dass, wenn sie in diesen Raum hineinkommen, sie merken: Hier sind bestimmte Abwertungen von Gruppen unerwünscht. Hier gilt die Würde der anderen".
"Indem ich mich frage, welche Funktion diese Vorurteile für mich haben, aber auch für meinen Status in dieser Gesellschaft, erlauben sie mir Macht auszuüben. Indem ich mich nach dem Sinn und Zweck dieser Vorurteile für mich frage, lande ich unweigerlich bei mir, das heißt, ich kann diese Vorurteile nicht mehr so unreflektiert auf mein Gegenüber projizieren."
Wirksam werden veränderte Denkmuster erst, wenn sie im Alltag dazu führen, dass wir uns anders verhalten. Das gilt insbesondere dort, wo Identität und Normen eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel in Schulen und im Gesundheitswesen. Wer hier arbeitet, sollte die eigenen Vorurteile reflektieren, fordert Carina Utz. Sie wünscht sich gleichzeitig:
"Ich appelliere auch immer an die queeren Menschen, queere Menschen müssen sichtbar sein, weil ich auch der Überzeugung bin, dass Vorurteile auch abgebaut werden können durch Sichtbarkeit. Indem ich auf den Straßen wahrnehme, dass es Paare gibt, die eben nicht heterosexuell sind. Oder indem ich mein Kind vielleicht in einem katholischen Krankenhaus zur Welt bringe als Frauenpaar."
Aber das Dilemma bleibt: Wer sichtbar ist, wird womöglich angefeindet. Gleichzeitig können Minderheiten ihre Interessen nur vertreten, wenn sie sich öffentlich dafür einsetzen. Auch wenn die Betroffenen damit wieder einen Teil der Arbeit übernehmen. Zudem muss sich die Mehrheit einer Gesellschaft nicht nur zur Gleichwertigkeit aller bekennen, sondern sie konkret werden lassen. Vorurteile, Diskriminierung, Beleidigung, gar Gewalt dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Wer in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz erlebt, wie Menschen bedroht oder beschimpft werden, kann und sollte eingreifen. Theoretisch ist das den meisten auch bewusst. Doch das Wissen allein reicht nicht, denn: Die aktive Arbeit gegen Diskriminierung beginnt lange vor der Zivilcourage.
"Das kommt nun immer darauf an, ob ich einen sozialen Kontext so gestalte, dass dort die Norm, sich nicht nach den Vorurteilen zu verhalten, besonders bedeutsam ist. Wir würden sagen: Wir müssen die Räume und die Kontexte von Menschen so gestalten, dass, wenn sie in diesen Raum hineinkommen, sie merken: Hier sind bestimmte Abwertungen von Gruppen unerwünscht. Hier gilt die Würde der anderen".